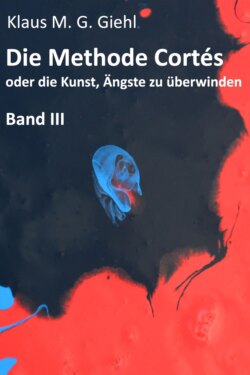Читать книгу Die Methode Cortés - Klaus M. G. Giehl - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4 Entdeckung
ОглавлениеIch beschloss, das Wochenende der Lösung des Problems zu widmen. Die Lage war ernst. Mittlerweile lag nämlich auf der Hand, dass mir meine gegenwärtige Arbeit deutlich weniger zusagte als die Arzttätigkeit, die ich im Jahr zuvor schon ein paar Monate hatte „ausprobieren“ können. Der besorgniserregende Punkt hierbei war, dass dieser „Lustwandel“ nicht auf einer unverhofft alles überstrahlenden Begeisterung für eine ärztliche Tätigkeit beruhte. Ich stand auch dieser distanziert und desinteressiert gegenüber. Aber ich konnte mir bei ihr wenigstens die Zeit durch amüsante Gespräche mit Patienten und Mitarbeitern vertreiben. Im Gegensatz dazu empfand ich meinen Forschungsalltag auf einmal einsam und trostlos. Ich saß – von Tiefkühltruhengebrumme und surrendem Neonlicht umwabert – in fensterlosen Gruften, um Zahlen– und Buchstabensequenzen anzustarren, die mir einen Lufthauch bedeuteten, glibberige Lösungen auf irgendwelche Gewebeproben zu träufeln, oder bedauernswerten Mäusen die Köpfe auf– oder abzuschneiden. Und der Reiz, das „Unbekannte“ zu erkunden, war verschwunden und damit verloren, was mich einst so fasziniert hatte an diesem Tun. Doch ich wusste nicht, warum.
An der Art der Forschung lag es nicht. Ich war, von trivialen Variationen abgesehen, mit meinem alten Forschungsschwerpunkt befasst. Gut, mein Projekt mit Günter (mein ehemaliger Kollaborationspartner in Austin), das ich gerne weitergeführt hätte, lag momentan wegen gewisser Egoismen Ming Lis auf Eis (diese Egoismen waren auch Günter aufgefallen, wie er mir in einem Telefonat vor ein paar Tagen anvertraut hatte; und es sei daher wohl derzeit vernünftiger, hatte er gemeint, unsere Studie noch ein wenig ruhen zu lassen). Aber dieses Projekt mit Günter hätte im Vergleich mit meinem augenblicklichen lediglich eine banale Wortrochade bedeutet, was die Grundmechanik des Vorgehens betraf. Was also konnte der Grund meines Desinteresses sein? Ich zermarterte mir den gesamten Samstag den Kopf über diese Frage, ohne auch nur einen Mikrometer voranzukommen.
Gegen neun Uhr am Abend gab ich auf und fuhr in den „Whole Foods Market“, um mir eine Flasche Rioja zu besorgen. Beim Schlürfen des Weins spielte ich noch mit diversen Lösungsansätzen, aber es nutzte nichts. Vergeblich, meine Denkesmüh. Ich ging zu Bett. Möglicherweise brachte der Sonntag die Antwort.
Zunächst brachte er sie nicht, denn am Sonntagmorgen rauschte es zwischen meinen Ohren, als ich aufwachte, und mein Kopf schmerzte. Offensichtlich hatte ich am Vorabend zu viel geraucht. Ich bereitete mir einen Kaffee, schluckte eine „Aspirin“, und checkte wie gewohnt meine E–Mail:
Mein alter Freund Gonzalo hatte geschrieben. Ihm hatte ich zu verdanken, dass ich in der Forschung gelandet war. Er war mein Doktorvater gewesen. Nach seiner Emeritierung hatte er eine Offerte einer Universität in Madrid bekommen und war daraufhin mit seiner Frau in die alte Heimat zurückgekehrt. Er konnte es nicht lassen. Vollblutforscher durch und durch! Bei meiner jüngsten Stippvisite in Madrid, als ich mein Visum für die Staaten hatte abholen müssen, hatte ich die Gelegenheit genutzt, mich mit ihm zu treffen. Er erkundigte sich jetzt, wie mir St. Louis gefalle und wie meine Projekte liefen.
Ich wollte gleich antworten. Als ich aber den Text nach Rechtschreibfehlern überflog, fielen mir einige „stilistische“ Besonderheiten auf. In dieser Weise pflegte ich Gonzalo nicht zu schreiben! Ich bejubelte nicht wie früher meine unfassbaren Entdeckungen und verbrodelte nicht die sich aus ihnen entfachenden brennenden Fragen. Auch sprudelten keine begnadeten Eingebungen, wie ich die ersehnten Antworten aus dem sie ummantelnden Brodem enthüllen würde. Und ich frohlockte nicht fiebernd, welche Erleuchtungsportale ich mit der Offenbarung aufstieße, die bald in meinen Händen glänzen würde. Nein. Monoton berichtete ich von einem Projekt X, das mir Ming Li zum Weiterbearbeiten überlassen habe, von einem Projekt Y, das ich vielleicht auch noch machen solle, von diesem und jenem, das ich besser nicht vergessen würde, und dass sich aus der einen oder anderen Studie eventuell ein neuer Aspekt ergebe, den man ganz gut für eine Antragsstellung bei dieser oder jener Organisation verwenden könne. Als ich den Text in diesem Lichte gelesen hatte, klappte mir die Kinnlade herunter und ich fragte mich:
Was für ein Langeweiler hatte das denn geschrieben? Angewidert lehnte ich mich zurück und hielt inne. Nein, so würde ich Gonzalo diese E–Mail nicht schicken. Das wäre erbärmlich und beschämend, ihn mit derartigem Gallert zu degoutieren!
Mir fiel jedoch nichts anderes ein. Aber ich erinnerte mich an die Zeit meiner Doktorarbeit: Viel Freud und viel Leid – und am Ende ein beachtlicher Erfolg, der sogar mit dem „Rudolf–Ratte–Preis“ anerkannt worden war.
Schon dereinst war ich mit Gonzalo befreundet gewesen. Aber manchmal hätte ich ihn verfluchen können. In seiner sanguinisch–mediterranen Art hatte er mich einfach machen lassen. Und ich hatte gemacht und gemacht und gemacht und manchmal gar nicht mehr so recht gewusst, wo mir der Kopf gestanden hatte vor lauter Machen. Hätte mir dieser Hansdampf nicht mehr Direktiven geben können? Aber nein! Er hatte mir „meine Freiheit“ gelassen und mich machen lassen.
Meine Mühen waren schließlich doch von Erfolg gekrönt gewesen und ich hatte verstanden, dass es genau die seien, die die Spreu vom Weizen trennten: Direktiven befolgen könne jeder Kretin. Probleme aus sich heraus mit aller erforderlichen Zähigkeit, auch Widrigkeiten zum Trotz, zu lösen, sei dagegen genau das, was man in der Wissenschaft benötige. Gonzalo hatte um diese Mechanismen schon lange gewusst. Wie gesagt, ich hatte sie (letztlich) auch begriffen und Gonzalo „verziehen“, dass er mich wie einen Brummkreisel hatte rotieren lassen. Ich war Gonzalo, um es präzise zu formulieren, dankbar gewesen – und war es noch immer. Die Erinnerung an die guten alten Zeiten erfüllte mich mit Wehmut:
Damals war die Welt noch in Ordnung! Ich griff mir ein großes Taschentuch und schnäuzte mich. Und mit dem Rotz, den ich meiner Nase entblies, schoss es mir wie ein Blitz in den Kopf: Was wäre passiert, wenn ich mich bei Ming Li dissertiert hätte? Und die Antwort folgte wie ein Donner: Garantiert wäre ich nicht in der Forschung gelandet! Direktiven anderer auszuführen, war schlicht nicht mein Ding!
Mit einem Mal sah ich alles klar und deutlich vor mir: An der Forschung faszinierte mich nicht das simple Benutzen ihrer Werkzeuge, sondern die geistige Freiheit, diese Werkzeuge nach meiner Überzeugung anzuwenden. Die Freiheit, zu bestimmen, welche Fragen mich interessierten. Die Freiheit, wie ich deren Beantwortung anginge. Und die Freiheit, wie ich mit den Antworten verfahren würde. Ebenso klar war, dass mir nicht im Geringsten gefallen konnte, Werkzeug zur Beantwortung der Fragen eines anderen Wissenschaftlers zu sein. War mir als unabhängigem Wissenschaftler das Träufeln der Lösung auf die Gewebeprobe meditativer Genuss, war mir drögster Stumpfsinn, meine Lösungen auf die Ideen eines anderen zu träufeln. Ich hatte auf einmal nicht den geringsten Zweifel, dass ich an der Forschung so lange keinen Spaß haben würde, wie ich Verrichtungsgehilfe war.
Könnte sich an meinem Status als Verrichtungsgehilfe etwas ändern? Die Chancen hierfür standen, vorsichtig gesagt, überhaupt nicht gut. Ich kannte das Geschäft. Einem Typen, der zwei Mal ob „familiärer Gründe“ eine Professur geschmissen hatte, gibt man nicht noch eine dritte Chance, vor allem nicht, wenn man eine Menge in diese Chance würde investieren müssen. Die sich mir im Dezember bietende Möglichkeit an UT Austin (siehe Band II: „Überraschungen“) war insofern anders gewesen, als keine Investitionen erforderlich gewesen wären, mich zu re–installieren. Mein Labor dort war noch eingerichtet gewesen! Doch meine Möglichkeiten, wieder in UT Austin einzusteigen, hatten sich inzwischen „verflüchtigt“, und zwar gänzlich!
Ich hatte kurz nach meiner Ankunft in St. Louis mit Günter über die Sache gesprochen. Er sah die Dinge wie ich: Die Sorge darüber, meine Ex–Frau könne ihre Finger in die noch bestehende Wunde meines laufenden Strafverfahrens legen, existiere nach wie vor (was Günter gemeint hatte, war das Verfahren wegen des Unterhalts, den ich im vergangenen Jahr zwischen August und Dezember nicht geleistet hatte). Zudem sei Bill genesen und als Head of Department re–installiert. Laut Günter war es mit Bill nicht zu machen, dass ich zurückkäme. Das sei damals ein einmaliges „Window of Opportunity“ gewesen, das wir leider nicht hatten nutzen können.
Existierte ein Weg, der mich – auch ohne unabhängige Stelle – unabhängige Forschung betreiben ließe? Theoretisch ja. In den Vereinigten Staaten ist es möglich, sich über bestimmte Drittmittel nicht nur die Forschung, sondern sogar das eigene Gehalt zu finanzieren. Ergatterte ich solche Drittmittel, könnte ich auch ohne „Stelle“ unabhängig forschen. Ein so ausgestatteter Forscher fände nämlich jederzeit eine Forschungsinstitution, seine Studien durchzuführen. Um jedoch diese Art Drittmittel zu bekommen, musste man extrem erfolgreiche Forschung über Jahre hinweg gemacht haben!
Es gibt – relativ gesehen – einige wenige Wissenschaftler, die Derartiges schaffen. Und deren überwiegende Mehrheit arbeitet an Harvard auf einem Niveau, das ich nie erreicht hatte. Ich war sehr gut, aber eben nicht absolute Spitzenklasse. Und ich kam soeben – mit fünfundvierzig Lenzen auf dem Buckel und nach Jahren professioneller Unbelecktheit! – von meinem Bötchen aus La Graciosa zurück, und wollte in mäßigem Umfeld wieder anfangen zu forschen. Was sprach dafür, dass ich gerade jetzt und hier in diese exosphärischen Forschungsgefilde aufstiege? Zuweilen ist es nützlich, die eigenen Grenzen zu kennen. In diesem Punkt kannte ich sie: Der Zug, unabhängige Forschung machen zu können, war für mich abgefahren. Endgültig!
Was blieb, war die Erkenntnis, dass mir forschen im zweiten Glied keine Freude bereitete. Ich hatte vormals ähnliche Ahnungen gehabt, allerdings eher „hypothetisch“ und offenbar nicht tief genug, die rechten Schlüsse zu ziehen. Nun hatte ich durch Dienst im zweiten Glied empirisch „begriffen“.
Welche Konsequenzen ergaben sich hieraus? Ich könnte bei Ming Li bleiben und später ein anmutigeres Pöstchen suchen, auf dem mich helleres Licht beschiene. Vielleicht würde es so mancher gar für meines halten. Warum nicht? Aber nein, das war mein Ding nicht. Und vor allem: Warum sollte ich dies tun? Mir brächte es weder Zerstreuung noch Vorzüge: Auch im zweiten Forschungslied schuftet man mehr als in den meisten anderen Berufen, verdient jedoch weniger, als ich mühelos als Arzt hätte verdienen können. Und zuoberst fehlte in der Forschung – für mich mittlerweile – ein wesentlicher Vorzug, den die Heilkunde – mir mittlerweile – zu bieten hatte: Freiheit!
Meine Freiheit in der Forschung war verloren. Doch als Arzt hätte ich eine andere Freiheit gewonnen: ein Leben auf Reisen. Wie das? Ganz einfach: Als Arzt könnte ich überall arbeiten und mir ein Leben auf meinem Boot ermöglichen. Im Gegensatz dazu wäre ich als Forscher an wenige Ballungsräume gebunden und lange nicht so flexibel. Und was ich, wie bereits gedacht, nicht vergessen sollte: Als Arzt würde ich besser verdienen! – Ich musste mir eingestehen, dass für mich kein Argument mehr dafürsprach, in der Forschung zu bleiben. Im Gegenteil: Jedes gewichtige Argument sprach dagegen.
Mir fiel auf, dass sich meine Überlegungen zu den Konsequenzen meines verlorenen Forschungsenthusiasmus reflektorisch um meine „Freiheit“ drehten. Der Wunsch nach der war offensichtlich stark ausgeprägt in mir. Und im Grunde war es auch in meinem Wissenschaftlerleben um sie gegangen: um das Ausleben wissenschaftlicher Freiheit. Die war zwar letztlich nur eine „Freiheit im Kästchen“. Aber ich hatte sie genossen und mich intellektuell austoben können. Beides ging jetzt nicht mehr. Zum Glück hatte ich in einem Leben auf dem Boot einen alternativen Weg gefunden, meinem Freiheitsbedürfnis nachzukommen. Und dies in recht konkreter Weise.
Darüber hinaus konnte ich mir diese neue Freiheit auch tatsächlich leisten: Ich hatte keine Verpflichtungen und eine Jobalternative, die mir große Flexibilität bot (als „Beruf“ hätte ich eine ärztliche Tätigkeit trotz meines „Wandels“ nach wie vor nicht bezeichnen mögen; nach wie vor war der Term „Beruf“ für mich ausschließlich für „meine“ Forschung [als Nummer 1!] reserviert). Warum also sollte ich diesen Weg nicht gehen?
Die Erkenntnisse des Wochenendes waren neu für mich. Ich war mir zwar sicher, dass sich Wesentliches nicht an ihnen ändern würde. Aber ich wollte dem Ganzen ein wenig Zeit geben, sich zu setzen. Vielleicht hatte ich mich ja doch getäuscht. Oder ich hatte Angst vor dem, was sich konsequenterweise aus ihnen ergeben würde.