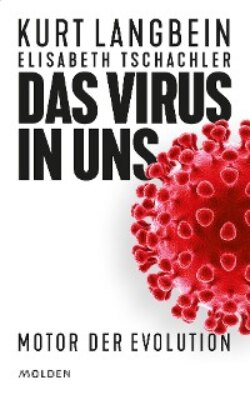Читать книгу Das Virus in uns - Kurt Langbein - Страница 10
Оглавление2
Wir sind der Gast
Sie sind viele. Sie sind überall. Und sie sind keine Killer: Viren. Diese raffinierten Überlebenskünstler, so alt wie das Leben selbst, haben die Evolution entscheidend vorangetrieben, auch die des Menschen.
Wer an Viren denkt, denkt an grässliche Krankheiten, an outbreaks aus Katastrophenfilmen. An Ebola oder Aids, an Pocken und Influenza, an Masern und Schnupfen und in letzter Zeit an das Coronavirus SARS-CoV-2. Viren werden gleichgesetzt mit Bedrohung, mit Epidemie und Pandemie, mit Abwehr und Abscheu, mit Tod. Das ist offenbar schon länger so, denn das lateinische Wort virus bedeutet Schleim oder Gift.
Aber dieses Bild hat sich in den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten gründlich gewandelt. Erst seit 100 Jahren kann man Viren und Bakterien voneinander unterscheiden, seit 80 Jahren können Viren sichtbar gemacht werden. Erstmals war es seit der Entwicklung der gigantisch schnellen Sequenziermaschinen in den vergangenen zwei Jahrzehnten möglich, nicht nur das menschliche Genom zu entschlüsseln, sondern auch das der vielen Mikroben, die uns umgeben. Und da zeigt sich nach und nach, dass Viren keineswegs ausschließlich Krankheitserreger sind. Diese winzigen Eiweißpartikel, in die Erbinformation verpackt ist, sind unerlässliche Wegbegleiter, ja Architekten sämtlichen Lebens. »Galten Viren bislang nur als die Feinde von Mensch und Tier, ja allen Lebens, so zeigt sich nun, dass sie zur Entstehung und Entwicklung des Lebens entscheidend beigetragen haben«, schreibt die in der Aidsforschung bekannt gewordene Berliner Virologin Karin Mölling in ihrem Buch »Supermacht des Lebens«.24
Viele Forscher meinen nach wie vor, Viren seien keine Lebewesen. Aber so richtig leblos sind sie auch nicht: Seit Milliarden Jahren reproduzieren und verändern sie sich und sie spielten bei der Entstehung der ersten komplexen Lebensformen wahrscheinlich eine entscheidende Rolle. Viren sind überall, sie sind die ältesten biologischen Elemente auf unserem Planeten. Und sie sind auch mit Abstand die häufigsten. Oft wird immer noch der Mensch als »Wirt« der Mikroorganismen beschrieben. Aber angesichts der Erkenntnisse über deren Rolle in unserem Leben und deren Menge ist man geneigt, das Bild umzudrehen: Wir sind der Gast. In unserem Körper gibt es hundertmal mehr Viren als menschliche Zellen, und unser Erbgut wird von Viren maßgeblich mitgestaltet: Immerhin zur Hälfte besteht das menschliche Erbgut aus Viren oder, genauer, aus Virenresten.25
Viren sind raffinierte Überlebenskünstler, so alt wie das Leben selbst, und sie haben als Motoren der Evolution andere Lebewesen vorangebracht – auch den Menschen. Mit ihm und seinen Vorfahren verbindet sie eine jahrmillionenalte Wechselbeziehung. Dabei sind Viren und Menschen eine vorwiegend friedliche Koexistenz eingegangen. Krankheiten entstehen erst dann, wenn die Balance des Systems gestört wird, durch reduzierte Artenvielfalt, bedrohte Lebensräume für einzelne Arten, übervölkerte Städte.
Wollte man den Erfolg einer Kreatur danach bemessen, wie viele Exemplare es davon gibt, dann wären Viren die Sieger der Evolution. 1033 Virenpartikel gibt es auf dem Planeten, damit sind sie zehnmal häufiger als Bakterien. Wären einzelne Virenpartikel so groß wie ein Sandkorn, dann würde allein ihre Menge die gesamte Erdoberfläche mit einer 15 Kilometer dicken Schicht bedecken.26
In jedem Kubikmillimeter Meerwasser finden sich zehn Millionen Viren27, 100 Millionen verschiedene Virentypen werden insgesamt vermutet, 320.000 davon kommen in Säugetieren vor. Und unser Wissen ist trotz der rasanten Entwicklung in den vergangenen zehn Jahren immer noch marginal: Gerade einmal 5630 Virenarten sind bisher identifiziert und beschrieben.28
Viren sind – mit Ausnahme der sogenannten Riesenviren – winzig, wesentlich kleiner als Bakterien, selbst unter dem Lichtmikroskop nicht auszumachen. Wäre ein Mensch so groß wie ein Fußballstadion, hätte ein Bakterium die Größe eines Fußballs und ein Virus wäre so groß wie eines der schwarzen achteckigen Felder auf dem Ball. Oder ein anderes Bild: 20.000 von ihnen aneinandergereiht, messen gerade einmal einen Millimeter.29
Viren sind allgegenwärtig – im Meer, an Land, tief unter der Erde, zu finden überall dort, wo es Zellen gibt. Denn sie brauchen, um sich fortzupflanzen, andere Mikroorganismen. Im Grunde sind Virenpartikel (Virologen nennen sie »Viria«) nichts anderes als proteinbesetzte Kapseln mit Erbgut darin, manchmal noch mit einer Hülle rundherum. Träger der Erbinformation sind die Nukleinsäuren DNA oder RNA.
Dass sich Viren nicht selbst vermehren können, ist der Grund, warum sie bei den meisten Wissenschaftlern auch nicht als Lebewesen gelten. Als solche müssten sie zudem wachsen, Energie und Eiweiß erzeugen können. Dazu sind Viren nicht in der Lage. Auf der Suche nach dem geeigneten Wirt, den sie für ihre Fortpflanzung brauchen, helfen Rezeptoren an der Oberfläche der Viruskapsel, die zu jenen der Wirtszelle passen. Einmal angedockt, schleust das Virus seine Erbinformation in das Innere der Zelle und veranlasst sie, Viren-Bruchteile zu produzieren, die sich in der Zelle zu Viren-Kopien zusammenfügen. Damit ist der Reproduktionszyklus komplett, und die aus der Wirtszelle austretenden Abertausenden Viren-Kopien kapern ihrerseits weitere Zellen.
Manchmal ist dieser Vorgang allerdings äußerst aggressiv. Die befallene Zelle wird dann veranlasst, so viele Kopien herzustellen, dass sie vor Erschöpfung zerplatzt. Ein Beispiel dafür ist das Ebolavirus, das beim Menschen nicht nur die Zellen der Leber und anderer Organe befällt, sondern auch Lymphknoten und Abwehrzellen des Immunsystems. Ein Großteil seiner Opfer stirbt rasch. Aus Sicht der Viren sind Menschen damit freilich ein Fehlwirt, da sie oft nicht lange genug leben, um die Viren-Kopien weiterzugeben. Die meisten der bisher beobachteten Ebola-Ausbrüche waren deshalb auch schnell wieder zu Ende.
Die überwiegende Mehrzahl der Viren pflegt einen deutlich weniger radikalen Stil. Besonders schlau machen es Rhinoviren, die häufigsten Auslöser von Schnupfen. Sie verbreiten sich in der Nasenschleimhaut von Zelle zu Zelle. Als Immunreaktion schwillt die Nasenschleimhaut an und bildet größere Mengen eines schleimhaltigen Sekrets: Die Nase läuft – und Unmengen frisch geschlüpfter Viren laufen mit, um sich neue Wirte zu suchen, die sie mit Schnupfen anstecken können. Die Viren verwenden das Immunsystem also gleichsam als Helfer bei ihrer Vermehrung.
Lebendige Flüssigkeit
Das erste Virus, das sichtbar gemacht werden konnte, war der Erreger der Mosaikkrankheit auf Tabakpflanzen, die sich in gekräuselten Blättern und mosaikartiger Marmorierung äußert.30 Das war 1940, doch diesem Fund war eine 50 Jahre dauernde Suche vorangegangen. Der deutsche Agrikulturchemiker Adolf Mayer hatte sich bereits seit 1889 bemüht, die Ursache für die welkenden Tabakpflanzen zu finden, konnte im Mikroskop jedoch keinen Erreger ausmachen. Dabei musste es einen solchen geben, denn Mayer hatte den Saft kranker Pflanzen gesunden injiziert, deren Blätter sich ebenfalls zu verfärben begannen. Selbst wenn der Pflanzensaft ganz fein gefiltert wurde, blieb er infektiös. Der russische Biologe Dmitri Iwanowski, der sich der Sache ebenfalls annahm, vermutete, eine lebendige Flüssigkeit müsse Ursache der Infektion sein, und sprach von einem »Virus«, einem Gift. Das wurde allerdings nicht schwächer, wenn man es verdünnte, es musste sich also irgendwie vermehren.
Viel wurde spekuliert, was dahinterstecken könnte, zumal zur selben Zeit auch die Jagd nach bis dahin unbekannten Erregern anderer Krankheiten begonnen hatte.31 Etwa nach jenem der Maul- und Klauenseuche, bis heute eine der gefährlichsten Infektionserkrankungen bei Tieren.
Immer wieder vertieften sich Wissenschaftler auf der ganzen Welt in das Problem des unsichtbaren Tabakpflanzenschädlings, ohne eine Lösung zu finden. Erst 1935 entdeckte der US-amerikanische Biochemiker und Virologe Wendell M. Stanley winzige Kristallnadeln im Saft einer befallenen Pflanze. Bestätigt werden konnte Stanleys Fund mithilfe des ersten Elektronenmikroskops 1940. Sechs Jahre später bekam er dafür den Nobelpreis für Chemie.
Lange Zeit nach ihrer Entdeckung beschäftigten die Viren die Forscher jedoch hauptsächlich wegen ihrer krankmachenden Eigenschaften. Das ist nicht verwunderlich, denn gegen viele der Krankheiten, die die Menschheit – oft seit Jahrtausenden – plagten, gab es lange kein Mittel: Die Masern haben ganze Kulturen ausgelöscht, die Pocken hinterließen bei jenen, die sie nicht dahinrafften, bleibende Entstellungen, die Spanische Grippe forderte mehr Todesopfer als der Erste Weltkrieg.
Dass wir mit jedem Salatblatt eine große Anzahl harmloser Viren mitessen und bei jedem Gang nach draußen durch einen Schwarm Virenpartikel wandern, die uns nichts anhaben, ist eine relativ neue Erkenntnis.
Viren, so groß wie Bakterien
Im Wasser eines Kühlturms in England hatten Mikrobiologen 1992 eine bis dahin unbekannte Mikrobe entdeckt – und hielten sie aufgrund ihrer Größe für ein Bakterium. Zehn Jahre sollte es dauern, bis ein Team um den südfranzösischen Infektiologen Didier Raoult, der während der Corona-Krise mit der Propagierung des Medikaments Hydroxychloroquin überregionale Bekanntheit erlangte, den Irrtum entdeckte. Es handelte sich um ein Virus, er nannte es »Mimivirus« – ein Virus, das so tut, als wäre es eine Mikrobe, ein lebendiger Organismus. In den folgenden Jahren wurden noch etliche weitere solcher Riesenviren gefunden, die allesamt ganz besondere Merkmale tragen. Ihr Wirt sind Amöben und ihre Erbsubstanz ist von einer Doppelhülle umgeben, deren äußere einen vieleckigen Körper darstellt. Andere, etwas später isolierte Riesenviren haben die Form einer griechischen Amphore und werden deshalb Pandoraviren genannt. Im Gegensatz zu ihren winzigen Verwandten verfügen sie alle über ein üppiges Erbgut. Bei Pandoraviren ist es nahezu so umfangreich wie jenes von Einzellern, und genetisch verfügen sie über fast alles, was zur Eiweißproduktion benötigt wird. Damit verschwimmt die Grenze zwischen Viren und Lebewesen. 2013, als die französische Forschergruppe weitere Riesenviren entdeckte, hieß es im Wissenschaftsmagazin »Nature«, diese neu identifizierten Mikroben würden einen bis dahin unbekannten Teil des Lebensbaums sichtbar machen.32
Auch wenn die Existenz der Riesenviren erst unlängst bekannt wurde, so sind sie doch steinalt. Mindestens 30.000 Jahre, denn in einem so alten Stück sibirischen Permafrostbodens wurde ebenfalls ein Riesenvirus entdeckt. Seine DNA hatte überdauert und das Virus konnte wieder infektiös gemacht werden.33
Obwohl Viren für gewöhnlich immer noch nicht zu den Lebewesen gezählt werden, können sie sich verändern. Oft sind sie schlampig, wenn es um Vermehrung geht, und mutieren innerhalb des Reproduktionszyklus. Danach können sie anders aussehen oder sich anders verhalten. Das kann langsam vor sich gehen, oder es können mit einem Schlag mehrere Eigenschaften verändert werden. Und aus einer harmlosen Mikrobe kann, wenn sie einen anderen Wirt befällt, etwa von Tieren auf Menschen überspringt, eine Bedrohung werden, ein Supervirus, das sich schnell verbreitet und schwerwiegende Gesundheitsschäden verursacht.
Erhöhte Wachsamkeit
»Wir brauchen eine permanente Beobachtung und erhöhte Wachsamkeit gegenüber dem Auftauchen neuer Virusstämme durch zoonotische Übertragung«, sagt Rasmus Nielsen, Evolutionsbiologe an der University of California.34 Er untersucht, was auf molekularer Ebene passiert, wenn Viren ihre Wirtszellen wechseln. Dass Viren den Sprung über die Artengrenze schaffen, ist kein neues Phänomen. Wenn sie dann nicht nur von Tieren auf Menschen übergehen, sondern sich so anpassen, dass sie von Mensch zu Mensch übertragen werden können, wird es wirklich unangenehm. Denn dann können sie sich schnell ausbreiten und je nachdem, wie ansteckend sie sind, zu Epidemien oder Pandemien führen. Die Zahl der Säugetier- und Vogelviren, die theoretisch den Menschen zum Wirt nehmen können, wird auf 700.000 geschätzt, 260 haben es bisher tatsächlich geschafft.35
Das war vor mehr als 130 Jahren so, als ein im Nachhinein Betacoronavirus genannter Keim von Mäusen auf Kühe und dann auf den Menschen übersprang und wahrscheinlich Auslöser einer Pandemie war, die weltweit mehr als eine Million Menschen tötete.36 Das war bei HIV so, da kam das Virus von Schimpansen und Gorillas; das ist beim Influenzavirus so; und bei den Coronaviren SARS 1 und MERS, die sich ursprünglich in Fledermäusen und dann Schleichkatzen bzw. Dromedaren breitmachten. Und beim Coronavirus SARS 2.