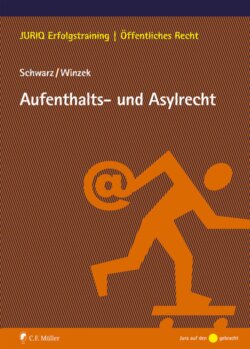Читать книгу Aufenthalts- und Asylrecht - Kyrill-Alexander Schwarz - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II. Der Aufenthalt
Оглавление25
Wir haben bereits gesehen, dass für den Aufenthalt eines Ausländers in der Bundesrepublik Deutschland ein Aufenthaltstitel nach § 4 Abs. 1 S. 2 AufenthG erforderlich ist. Diese Norm stellt ein ganzes Bündel an möglichen Aufenthaltstiteln zur Verfügung. Es ist zu beachten, dass ein Aufenthaltstitel im Sinne des § 4 Abs. 1 S. 2 AufenthG grundsätzlich befristet ist und nicht zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigt, wie sich aus § 4 Abs. 2 S. 1 AufenthG ergibt. Letzteres ist nur der Fall, wenn dies im Aufenthaltsrecht ausdrücklich normiert ist. Die Dauer der Befristung und die Möglichkeit einer Verlängerung ist nicht allgemein geregelt, sondern hängt vom jeweiligen Aufenthaltstitel ab.
Beispiel
So ist zum Beispiel die Niederlassungserlaubnis nach § 9 Abs. 1 AufenthG ein auf Dauer, also unbefristet ausgelegter Aufenthaltstitel, der darüber hinaus auch zur Erwerbstätigkeit berechtigt. Dem gegenüber ist die Aufenthaltserlaubnis nach § 7 Abs. 1 AufenthG ein befristeter Aufenthaltstitel, der mangels ausdrücklicher gesetzlicher Vorgabe nicht zur Erwerbstätigkeit berechtigt.
26
Auf diese Thematik werden wir an anderer Stelle (Rn. 169) noch vertiefend eingehen.
Darüber hinaus ermöglicht ein Aufenthaltstitel den Aufenthalt nur zu dem mit ihm verbundenen Zweck. Ändert sich dieser oder fallen bestimmte Voraussetzungen für die Erteilung des Aufenthaltstitels nachträglich weg, so kann dieser auch entzogen oder die Aufenthaltsfrist verkürzt werden (vgl. § 7 Abs. 2 AufenthG).
27
Zu beachten ist, dass ein Aufenthaltstitel nach § 4 Abs. 1 S. 1 AufenthG dann nicht erforderlich ist, wenn der Betroffene eines der dort genannten Aufenthaltsrechte besitzt. Ein solches Aufenthaltsrecht kann sich zum einen aus einer Rechtsverordnung und/oder dem Recht der EU ergeben, oder aus dem Assoziationsabkommen EWG/Türkei. Insbesondere das Letztere war für die jüngere deutsche Geschichte von besonderer Relevanz und soll daher kurz umrissen werden.
Das Assoziationsabkommen EWG/Türkei ist ein Abkommen zwischen der Europäischen Union (damals noch Europäische Wirtschaftsgemeinschaft) und der Türkei aus dem Jahre 1963. Das Abkommen sollte aus deutscher Sicht vor allem der Öffnung des Arbeitsmarktes für türkische Arbeitnehmer dienen, um dringend benötigte Arbeitskräfte in die Bundesrepublik Deutschland zu holen. In der Bundesrepublik herrschte nach dem Mauerbau im Jahre 1961 ein Arbeitskräftemangel. Die Türkei versprach sich durch das Abkommen zum einen Devisenzuflüsse, zum anderen eine Entlastung des eigenen Arbeitsmarktes. Vorrangiges Ziel des Abkommens war daher die schrittweise Herstellung einer Arbeitnehmerfreizügigkeit, geleitet von den Art. 48 bis 59 des Vertrages zur Gründung der Gemeinschaft (EWGV, heute inhaltsgleich Art. 45 ff. AEUV). Auf Grund dieses Abkommens ist unter anderem der Assoziationsratsbeschluss 1/80 (ARB 1/80) erlassen worden. Der Art. 6 I ARB 1/80 verbürgt den Anspruch türkischer Arbeitnehmer auf die Erteilung einer Arbeitsgenehmigung, soweit sie die Voraussetzungen der Norm erfüllen, sich ordnungsgemäß in einem Assoziationsstaat aufhalten und dort ebenso ordnungsgemäß erwerbstätig sind.[1]
[Bild vergrößern]
2. Teil Das allgemeine Ausländerrecht › B. Einreise und Aufenthalt › III. Die Aufenthaltstitel