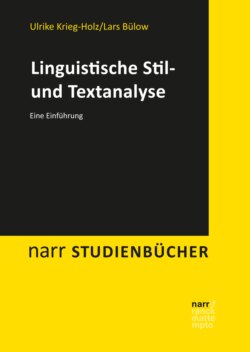Читать книгу Linguistische Stil- und Textanalyse - Lars Bülow - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.1.1 Textgliederung
ОглавлениеDen Ausgangspunkt für die Beschreibung der Gliederung eines Textes bildet die Abgrenzung eines textuellen Ganzen nach außen. In vielen Fällen ist die Festlegung der Außengrenzen unproblematisch, wenn die materiellen Grenzen des Zeichenträgers mit den Textgrenzen übereinstimmen oder eine typische Technik der Textsammlung (z.B. eine Zeitschrift) vorliegt, die klare Hinweise für die Abgrenzung einzelner Texte liefert (z.B. eine Geburtsanzeige innerhalb dieser Zeitschrift).
Die Außengrenzen – in Form von außersprachlichen Abgrenzungshinweisen und innersprachlichen Ganzheitshinweisen – zeigen den Umfang eines Textes an und legen damit zugleich die textuelle Obereinheit fest, auf die sich die weitere Differenzierung von Textteilen bezieht. Die Aufteilung der Innenwelt eines Textes in unterschiedliche (teils hierarchisch strukturierte) Einheiten erfolgt aufgrund von Gliederungs- und Musterhinweisen und basiert zum großen Teil auf einem Musterwissen im Sinne einer Top-down-Verarbeitung. Diese beteiligt unsere Vorerfahrungen, unser Wissen, unsere Erwartungen, unsere Motive und den kulturellen Hintergrund bei der Wahrnehmung der Welt. In Bezug auf die Prozesse der Textproduktion und Textrezeption ist davon auszugehen, dass die Kommunikationsbeteiligten ihre im Bewusstsein gespeicherte kommunikative Erfahrung und das entsprechende Wissen über Texte, das das Ergebnis einer Verallgemeinerung bestimmter Qualitäten von Texten ist, intuitiv oder bewusst einsetzen. Musterwissen ist folglich eine integrale Komponente vorgängiger Kommunikationserfahrung. Es beruht darauf, dass sich durch das Hören und Lesen von Textexemplaren gleiche oder ähnliche Texte im Hinblick auf Varianten und Invarianten miteinander verbinden, verallgemeinert abgebildet werden und somit Prototypen und Strukturmodelle, eben Muster von Texten herausbilden können.
Aus dem Umstand, dass bei der Textproduktion zwangsläufig auf überlieferte Vorgaben, Einheiten und Muster zurückgegriffen wird, resultiert jedoch nicht, dass jeder Text unbedingt ein vorgegebenes Muster realisiert. Denn auch relativ freie Kompositionen, im Sinne von untypischen Kombinationen von Einzelmerkmalen, können dazu geeignet sein, eine Kommunikationsaufgabe optimal/adäquat zu lösen. Ausschlaggebend ist die Frage, wie deutlich eine bestimmte Menge von Texten spezifiziert ist bzw. wie standardisiert eine Textsorte ist. Hinsichtlich einer Textsortenklassifikation (vgl. Kap. 4.3.4) ist demgemäß eine Skala anzunehmen, an deren einem Ende Texte in Formularform1 stehen, am anderen Texte, bei denen die individuelle Aussage- und Gestaltungsabsicht eine zentrale Rolle spielt. Dazwischen befinden sich Textsorten, die mehr oder weniger stark standardisiert sind und insofern als kommunikative Routinen auf der Textebene bezeichnet werden können, als sie einander unter verschiedenen Gesichtspunkten sehr stark ähneln.
Abb. 4:
Beispiel Geschäftsbrief (Narr Francke Attempto Verlag 2016)
Gliederungs- und Musterhinweise kennzeichnen nicht nur bestimmte (oft hierarchische) Relationen zwischen textuellen Einheiten, sondern können durch ihren Bezug auf ein Textganzes zugleich auch eine thematische Verbindung der gegliederten Textteile bewirken. Im Falle von stärker standardisierten bzw. formalisierten Textsorten wie einem Geschäftsbrief (vgl. Abb. 4) sind Gliederungs- und Musterhinweise wie die Platzierung von Anschrift, Datumsangabe, Betreff, Anrede- und Verabschiedungsformen großenteils normiert und vorgegeben, während bei denjenigen Textsorten, bei denen die individuelle Aussage- und Gestaltungsabsicht des Textproduzenten eine weit größere Rolle spielt, nur noch bestimmte Eckdaten angegeben werden können. Die Ebene der Textgliederung lässt sich deshalb bei diesen zuletzt genannten, wenig standardisierten Textsorten insbesondere anhand der Frage, in welchem Ausmaß ein Text eine Textsorte repräsentiert und wie er mit den entsprechenden Vorgaben umgeht, beschreiben. Dies wird im Folgenden exemplarisch an der Textsorte ‚Werbeanzeige‘ gezeigt, weil Werbeanzeigen die Aufmerksamkeit des Rezipienten erregen sollen und deshalb sehr verschieden gestaltet sind, um jede Stereotypisierung zu vermeiden. Gleichwohl ergeben sich Gemeinsamkeiten vieler ein- bis zweiseitiger Printanzeigen bezüglich der äußeren Gliederung des Textes in mehrere, meistens drei funktionale Textelemente. Im Schema des dreiteilig gegliederten Werbetextes sind dies Schlagzeile, Fließtext und Slogan:
Besonders auffällig sind die unterschiedlichen Erscheinungsformen der Schlagzeile (Headline), die sich nicht zwangsläufig über der Gesamtanzeige befinden muss, sondern auch zwischen Bild und Fließtext, innerhalb des Bildes oder seltener am Anzeigenrand platziert sein kann. Schlagzeilen können auch aus zwei oder mehreren sich ergänzenden Teilen bestehen (Topline und/oder Subheadline) oder einem optisch hervorgehobenen Kurztext. Ein eindeutiges Identifikationsmerkmal der Schlagzeile ist ihre Typographie, denn sie erscheint im Vergleich zu anderen Textelementen fast ausnahmslos in fetteren und größeren Lettern oder ist in Form von Kursiv- und/oder Versal- und/oder Sperrdruck usw. hervorgehoben.
In den meisten Anzeigen findet sich in variierender Position ein Fließtext (Copy), der der differenzierten Produktpositionierung dienen soll, indem er das Thema der Schlagzeile näher ausführt und präzisiert oder das Bildmotiv der Anzeige sprachlich formuliert bzw. mit weiteren Angaben ergänzt. Der Fließtext kann auch ein lediglich graphisches Kommunikationselement der Anzeige sein, das insbesondere bei kurzzeitig betrachteten Anzeigen allein durch die Form eines zusammenhängenden Schriftblocks eine gewisse Glaubwürdigkeit erzeugt. Das heißt, dem Fließtext als kommunizierendem Anzeigenelement können prinzipiell zwei Funktionen zugeordnet werden: eine informatorische, denn dem Leser soll Wissenswertes über das Beworbene mitgeteilt werden, und eine suggestive, die Kompetenz und Glaubwürdigkeit vermittelt und damit zur Übernahme der werblichen Behauptungen führen soll.
Hinsichtlich der Textlänge und der äußerlichen Gestalt variieren Fließtexte sehr. Längere Texte enthalten vielfach Gliederungsmerkmale wie Einzüge, Absätze oder Zwischenüberschriften (Sublines). Letztere sollen dem Rezipienten einen Überblick über die einzelnen Textabschnitte ermöglichen, indem sie deren Inhalt prägnant zusammenfassen. Sie können so vor allem dem wenig involvierten Leser einen komprimierten Eindruck über die im Fließtext enthaltenen Informationen verschaffen. Zu diesem Zweck werden auch häufig einzelne Wörter oder Wortgruppen innerhalb des Textes unterstrichen, fett oder andersfarbig gedruckt, um auch beim flüchtigen Betrachten der Anzeige die Wahrnehmung der wichtigsten Informationen über das Beworbene zu ermöglichen. Weitere Gestaltungsmerkmale bilden Vorlauftexte (sog. Intros), die meistens fett oder halbfett gedruckt sind und sich insofern gegenüber dem Rest des Fließtextes abheben. Sie dienen als Vorspann, mit dem durch Teilinformationen die Aufmerksamkeit der Rezipienten auf das Thema des Gesamttextes gelenkt werden soll. In vielen Anzeigen folgen auf den Fließtext sog. Claims, d.h. kurze Zusammenfassungen, die inhaltlich eng an den jeweiligen Fließtext gebunden sind. Sie treten nicht in anderen Anzeigen auf, die dasselbe Produkt unter verändertem Aspekt bewerben, und sind dadurch von Slogans abzugrenzen.
Der Slogan wird anzeigen-, häufig auch medienübergreifend eingesetzt und als eine Textkonstante verstanden, die unabhängig vom jeweiligen Werbemittel an ein bestimmtes zu Bewerbendes gebunden ist. Er beinhaltet immer den Firmen-, Marken- oder Produktnamen, da es eine seiner wichtigsten Funktionen ist, diesen Namen bekannt zu machen. In der Regel befindet sich der Slogan an einer exponierten Position innerhalb der Printanzeige, vorzugsweise am unteren rechten Ende.
Neben diesen drei zentralen Textelementen haben vor allem Bildmotive eine besondere Bedeutung für die Gliederung von Printanzeigen, denn unabhängig vom Involvement2 des Rezipienten werden Bilder fast immer als erstes und am längsten betrachtet, wodurch dem Bild als Anzeigenelement eine herausragende kommunikative Funktion zukommt.
Die Bildelemente von Werbeanzeigen können nach ihrer Funktion in Key-Visual, Catch-Visual und Focus-Visual unterschieden werden, wobei das erstgenannte „Schlüsselbild“ in der Regel das Beworbene selbst, etwa ein konkretes Produkt, abbildet. Mit dem Begriff ‚Catch-Visual‘ wird der künstlerisch gestaltete Bezugsrahmen bezeichnet, der das Beworbene jeweils situativ umgibt. Das Catch-Visual soll folglich als Blickfang fungieren, indem es den Blick des potentiellen Rezipienten auf sich zieht, um ihn danach auf das Key-Visual zu dirigieren.
Die Bezeichnung ‚Focus-Visual‘ erfasst bestimmte Wiederholungen von Teilen des Bildmotivs, wobei es sich in der Regel um einzeln stehende, kleinere Bildelemente handelt, die die Realität stark abstrahieren und der Erklärung bestimmter Verwendungs- oder Einsatzbedingungen des Beworbenen dienen sollen. Dementsprechend liegt ihre Funktion auch darin, dem Rezipienten das Verständnis bestimmter sprachlich beschriebener Vorgänge durch Abbildungen zu erleichtern.
Hinsichtlich der funktionalen Unterscheidung einzelner Text- und Bildelemente ist zudem zu bemerken, dass Schlagzeilen und Bildelemente normalerweise insofern in ihrer Funktion übereinstimmen, als sie den Rezipienten zum Betrachten der gesamten Anzeige veranlassen sollen. Dabei können sie sich in vielen Fällen kommunikativ ergänzen, indem etwa durch Wechselbeziehungen zwischen Schlagzeile und Bildelement das Erzielen witziger Effekte ermöglicht wird. In Bezug auf die Form der Informationsvermittlung sind Bilder gegenüber sprachlichen Anzeigenelementen prinzipiell weniger eingeschränkt, sie sind vielfach nicht klar abgrenzbar und enthalten zahlreiche Interpretationsmöglichkeiten. Deshalb haben die sprachlichen Elemente innerhalb von Text-Bild-Zusammenhängen oft die Funktion, die Interpretation einzuschränken bzw. sie in eine vom Produzenten intendierte Richtung zu lenken.
Beispielanalyse
Anhand dieser – hier nur grob skizzierten – Beschreibungskriterien lassen sich nun einzelne Vertreter der Textsorte ‚Werbeanzeige‘ im Hinblick auf die Ebene der Textgliederung beschreiben. Dies soll exemplarisch an der Printanzeige „Audi“ (vgl. Abb. 5) gezeigt werden:
Die einseitige Printwerbung ist in vier ungleich große Felder unterteilt, deren farbliche und typographische Gestaltung die inhaltliche Zusammengehörigkeit des linken oberen Viertels mit dem rechten unteren Viertel signalisiert. Verstärkt durch den Doppelpfeil wird eine semantische Beziehung zwischen der abgewandelten Form des Produktnamens Audi ultra (für Audi TTRS) und der Wortneubildung Leichtgeschwindigkeit nahe gelegt. Funktionell sind die Textteile als Schlagzeile zu interpretieren, das Textelement Die Zukunft automobilen Leichtbaus entsprechend als Subheadline. Durch die Zusammensetzung der beiden Textteile zur Aussage Audi ultra >> Leichtgeschwindigkeit entsteht zugleich ein bestimmter Typ des strukturell determinierten stilistischen Handlungsmusters (vgl. Kap. 3.3.3). Die Verwendung solcher stilistischer Muster gilt wiederum als typisches Textsortenmerkmal von Werbeanzeigen (vgl. Kap. 4.3.5) und ist dabei vor allem an syntaktisch reduzierte Textsortenelemente wie Schlagzeile oder Slogan gebunden, die die zweigliedrige Minimalstruktur des deutschen Satzes (Subjekt und Prädikat) in der Regel unterschreiten. Typisch für Slogan- und Schlagzeilenelemente ist darüber hinaus ihre Extrastellung, die erheblich zur Figurierung und Stilisierung beiträgt. Im Beispieltext nimmt das Sloganelement Audi Vorsprung durch Technik gemeinsam mit dem Firmenlogo eine Einzelposition im oberen rechten Anzeigenviertel ein. Der Fließtext findet sich demgegenüber am linken unteren Ende und weist deutliche Gliederungsmerkmale wie Absätze, Fettdruck oder Schriftartwechsel auf, die eine drei- bis vierfache Unterteilung bewirken.
Abb. 5:
Werbeanzeige (Audi TTRS3)
Formal stellt die Überschrift Der Audi TTRS mit 4,5 kg/PS Leistungsgewicht dabei erneut ein strukturell determiniertes stilistisches Muster dar, das inhaltlich als Verdichtung von Informationen des darauf folgenden kohärenten Haupttextes zu deuten ist. Inwiefern die Internetadresse www.audi.de/vorsprung-durch-technik (letzter Zugriff: August 2016) als separates Teilelement des Fließtextes zu verstehen ist, bleibt offen: dafür sprechen Fettdruck und fehlendes Satzschlusszeichen, dagegen die syntaktische Integration in die vorhergehende Äußerung. Getrennt durch einen Absatz schließt sich ein weiterer kurzer Textabschnitt an, in dem stichpunktartig zwei technische Angaben genannt werden.
Als zentrales Bildelement ist die Abbildung des beworbenen Produktes (das Schlüsselbild) im rechten unteren Anzeigenviertel anzusehen, das als Referenzobjekt zum Anzeigentext eindeutig identifizierbar ist. Außerdem bildet eine Abbildung den Hintergrund des oberen linken Viertels. Dieses Focus-Visual dient zur Erklärung des produktspezifischen Zusatznutzens (Audi Space Frame-Bauweise), indem es durch Visualisierung das Verständnis der sprachlich beschriebenen Produkteigenschaften erleichtern soll.
Die Analyse macht deutlich, dass sich die Printanzeige „Audi“ anhand der oben genannten Kriterien, die Eckdaten für die Gestaltung der wenig standardisierten Textsorte ‚Werbeanzeige‘ angeben, bezüglich der Ebene der Textgliederung gut beschreiben lässt:
Als Außengrenzen, die die textuelle Obereinheit festlegen, sind die Ränder der Zeitschriftenseite zu betrachten. Auch wenn diese nur teilweise mit den materiellen Grenzen des Zeichenträgers (ADAC Motorwelt 11/2011) übereinstimmen, so gelten doch eine oder zwei Seiten umfassende Printanzeigen als sinnlich stark wahrnehmbar – zumal es sich um eine typische Technik der Textsammlung (Zeitschrift) handelt, die vielfach selbige integriert. Die Textgliederung der Printanzeige weicht deutlich von anderen, vor allem den in Zeitschriften üblichen journalistischen Darstellungsformen ab, woraus wiederum deutliche Abgrenzungs- und Ganzheitshinweise4 resultieren.
In Bezug auf bestimmte Gliederungshinweise, die die außersprachliche Gestaltung betreffen, sind hauptsächlich die typographischen Besonderheiten des Layouts zu nennen. Musterhinweise ergeben sich hingegen durch das Vorhandensein der typischen Textelemente sowie der Musterhaftigkeit des textuellen Gewebes. So kommen ebenso wie zentrale Bildelemente alle drei funktionalen Textelemente (Schlagzeile, Fließtext und Slogan) im untersuchten Textsortenexemplar vor. Die Schlagzeile ist zweiteilig gegliedert, wobei der erste Teil, der den Produktnamen enthält, zusammen mit der Subheadline abgebildet ist, während der zweite Teil auf den produktspezifischen Zusatznutzen verweist und eine Einheit mit dem Schlüsselbild herstellt. Die Spaltung der Schlagzeile wirkt ebenso wie die Vierteiligkeit des Anzeigenhintergrundes einer stereotypen Gestaltung des Werbemittels entgegen.
Den Musterhinweisen können auch die verwendeten stilistischen Handlungsmuster zugeordnet werden, die hier in allen drei funktionalen Textelementen vorkommen und damit sowohl zur Stilisierung des Textes beitragen, als auch die Möglichkeit implizieren, von üblichen Formen des expliziten Bewertens abzuweichen.
Alles in allem ergibt sich daraus, dass das analysierte Textsortenexemplar als repräsentativer Vertreter der Textsorte ‚Werbeanzeige‘ angesehen werden kann, weil es einerseits der Erwartungsnorm entspricht, andererseits deutlich als Ergebnis einer individuellen Lösung der Kommunikationsaufgabe interpretiert werden kann.
Auch wenn die Problematik der Gliederung von Texteinheiten innerhalb von weniger standardisierten Textsorten hier am Beispiel ‚Werbeanzeige‘ diskutiert wird, scheint in diesem Zusammenhang erstens der Hinweis wichtig, dass es längst nicht für alle Textsorten vergleichbare Beschreibungskriterien gibt. Für den weitaus größeren Teil der in der Kommunikationsgemeinschaft vorkommenden Textsorten liegen lediglich grobe Beschreibungs- bzw. Klassifikationsvorschläge vor (vgl. Kap. 4.1), die die Ebene der Textgliederung kaum berücksichtigen. Zweitens ist prinzipiell auf die Verschiedenartigkeit von wissenschaftlichen Analyseergebnissen und einer Textsortenkompetenz im Sinne von Sprachbewusstsein hinzuweisen. Denn Textsorten stellen nicht nur das Ergebnis der theoretisch-analytischen Tätigkeit von Linguisten5 dar, die die kommunikative Realität mehr oder weniger detailliert abzubilden versuchen, sondern haben vor allem eine durch vielfältige intuitive Lernprozesse ausgebildete Existenz im Sprachbewusstsein der Kommunikationsteilnehmer. Dies spiegelt sich u.a. in selbständigen Benennungen von Textsorten wider, in denen sich das Alltagswissen der Sprecher über situationsgebundene Differenzierungen von Texten niederschlägt. Dabei ist zu beachten, dass das Sprachbewusstsein – also die Fähigkeit, über Sprache reflektieren zu können, sprachliche Ausdrucksmittel bewusst einzusetzen und zu bewerten – eine graduelle Größe ist. Sie reicht vom Sprachgefühl als dem relativ ungenauen, methodisch nicht kontrollierten Bewusstwerden einzelner Aspekte der Sprachfähigkeit bis zum wissenschaftlich reflektierten Sprachbewusstsein. Auch für den Bereich der Textsorten trifft diese Graduierung zu, wobei das bewusste Reflektieren über Textsorten in hohem Maße von der Lebenserfahrung, der Bildung und den beruflichen Kontexten des Sprechers abhängt. Aus dem Einfluss dieser Parameter ergeben sich unterschiedliche Grade an Textsortenkompetenz, worunter die Fähigkeit verstanden wird, auf der Grundlage eines mehr oder weniger bewussten Wissens über Textsortenqualitäten in der sprachlichen Kommunikation operieren zu können. Ein bestimmtes Maß an Textsortenkompetenz befähigt Sprecher zugleich, aufgrund bestimmter Gliederungs- und Musterhinweise mehr oder weniger intuitiv Einheiten und Hierarchien innerhalb von Texten zu identifizieren. Derartige Einheiten ergeben sich in vielen Texten unmittelbar durch das Druck- oder Schriftbild, sie werden dann z.B. verallgemeinernd als ‚Absatz‘ o.ä. bezeichnet oder textsortenspezifisch benannt (z.B. Lead).
Textuelle Einheiten kennzeichnen nicht nur bestimmte (häufig hierarchische) Relationen innerhalb eines Textes, sondern können durch den Bezug auf ein Textganzes auch die thematische Verbindung der Textteile bewirken. So ist im Falle von Überschriften, die ebenfalls zur typographischen Gliederung textueller Einheiten beitragen, einerseits zwischen solchen zu unterscheiden, die den Stellenwert der textuellen Einheit für das Textganze angeben. Andererseits gibt es Überschriften, die sich auf das Thema der dazugehörigen textuellen Einheit beziehen, und drittens solche, die gleichermaßen Hierarchie- bzw. Gliederungshinweise sowie Themahinweise darstellen. Im erstgenannten Fall handelt es sich um reine Gliederungsüberschriften, die auf die hierarchische Struktur der Teiltexte eines Textganzen verweisen und sich in einem System der Unter- und Überordnung befinden (z.B. Erster Teil, Erstes Kapitel). Enthalten solche Gliederungsüberschriften neben einer numerischen oder alphabetischen Angabe, die auf den hierarchischen Stellenwert verweist, auch thematische Aussagen, handelt es sich um Mischformen aus Gliederungs- und Themahinweisen, die sowohl der Orientierung des Lesers als auch der Einführung in die textuelle Thematik dienen (z.B. 2.1.1 Textgliederung). Thematische Überschriften stehen wie Titel über der textuellen Einheit und werden graphisch durch verschiedene Mittel hervorgehoben. Charakteristisch für solche thematischen Überschriften ist in sprachlicher Hinsicht eine bestimmte Figuriertheit (vgl. Kap. 3.3).
Die Ebene der Textgliederung bezieht sich primär auf die Erfassung und Beschreibung wahrnehmungsabhängiger Aspekte von Texten, die sogar dann als Textualitätshinweise erkannt werden, wenn die Sprache in einem Text (einer Fremdsprache) weder gelesen noch verstanden werden kann. Im Vergleich dazu setzen die Elemente der Textkonstitution bereits eine sehr spezialisierte Wahrnehmung voraus, die die Basis für das Verständnis sprachlicher Einheiten ist. Da Hinweise auf Musterhaftigkeit vielfach in der Lage sind, Verknüpfungshinweise zu ersetzen, tragen sie entsprechend auch zur Textkonstitution bei.