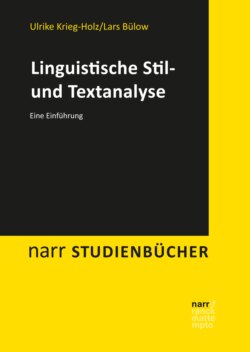Читать книгу Linguistische Stil- und Textanalyse - Lars Bülow - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Textkonstitution durch Kontext und Weltwissen: Kohärenz
ОглавлениеThematische Progression
Die Verbindung zwischen Kohäsion und Kohärenz verdeutlicht insbesondere die Beschreibung der Thema-Rhema-Gliederung.1 Im Zuge der Thema-Rhema-Gliederung eines Textes werden die Satz-für-Satz-Beziehungen nicht, wie bei den oben genannten Formen der Wiederaufnahme, nur in der Markierung der Ausdrücke, die direkten Bezug aufeinander nehmen, gesehen, sondern „darin, in welcher Weise das Darunterliegende erfasst wird, wie also Sätze mit ihren deiktischen Ausdrücken und nun vor allem mit ihren Prädikaten direkt aufeinander bezogen sind“ (Eroms 2008, S. 45).
Das Modell der Thema-Rhema-Gliederung basiert auf dem Ansatz der Funktionalen Satzperspektive, der im Kontext der Prager Schule entstand (Mathesius 1929). Für die Textanalyse unterscheidet Daneš (vgl. 1970, S. 72ff.) zwischen Thema und Rhema, wobei unter ‚Thema‘ das verstanden wird, worüber etwas mitgeteilt wird. Dabei handelt es sich unter kontextuellem Aspekt um die Information, die bekannt, vorgegeben, aufgrund der Situation erschließbar oder vom Rezipienten aufgrund seines Vorwissens bzw. seiner Weltkenntnis erkennbar ist. Als ‚Rhema‘ wird das bezeichnet, was über das Thema mitgeteilt wird. Das Rhema besteht also in der neuen, nicht vorher erwähnten und nicht aus dem Text- bzw. Situationszusammenhang ableitbaren Information.
Im Rahmen der Thema-Rhema-Gliederung wird die Textstruktur als eine Sequenz von Themen dargestellt,2 wobei die thematische Struktur eines Textes in der Verbindung der Themen, ihren Wechselbeziehungen und ihrer Hierarchie besteht. Der Komplex von thematischen Relationen im Text wird als ‚thematische Progression‘ bezeichnet, Daneš (vgl. 1970, S. 75ff.) unterscheidet fünf Typen von thematischen Progressionen:
1 Bei der einfachen linearen Progression wird das Rhema des Vorgängersatzes zum Thema des folgenden Satzes (z.B. Hans hat ein Fahrrad gekauft. Das Fahrrad steht im Keller. Im Keller …).
2 Im Falle der Progression mit durchlaufendem Thema bleibt das Thema einer Satzfolge konstant und den einzelnen Sätzen wird jeweils nur ein neues Rhema hinzugefügt (z.B. Mein Fahrrad ist neu. Es ist ein Geschenk meines Vaters. Es steht zur Zeit im Keller … vgl. Brinker 2005, S. 50). Die Beibehaltung des Themas bedeutet jedoch nicht, dass immer genau derselbe Ausdruck das Thema repräsentieren muss, weshalb die Formen der grammatischen und lexikalischen Wiederaufnahme Variation am Satzanfang ermöglichen.Im Zuge einer Progression mit abgeleiteten Themen werden die Themen der einzelnen Sätze von einem Oberthema aus entwickelt. So bildet für den folgenden Beispieltext das ‚Außendesign des Volvo C 70‘ das Hyperthema, z.B.:
3 Die Frontpartie des neuen Volvo C 70 drückt Kraft und Stärke aus. Seine fließenden Konturen vermitteln Leichtigkeit und Eleganz. Die ansteigende Gürtellinie leistet einen harmonischen Beitrag zum charakteristischen Auftritt … (Direct Marketing Volvo)
4 Der vierte Typ besteht in der Progression mit gespaltenem Rhema, wobei das Rhema des vorausgehenden Satzes in den folgenden Äußerungen in mehrere Themen zerlegt wird, z.B.:Ein über Jahre erhöhter Blutzuckerspiegel führt zur Veränderung der Blutgefäße. Die Blutgefäße erweitern sich und die Zellen der Gefäßwände sterben ab. Es kommt zu Ausbuchtungen, die Gefäße werden brüchig, Blut tritt in das umliegende Gewebe aus …
5 Besonders häufig begegnet der fünfte Typ, die Progression mit einem thematischen Sprung, bei der zwar ein Hyperthema existiert, die Einzelthemen aber nicht immer unmittelbar aneinander anschließen, weil beispielsweise Glieder der thematischen Kette, die aus dem Kontext zu ergänzen sind, ausgelassen werden, z.B.:Die Sinnesorgane funktionieren bei allen Menschen nach demselben Prinzip. Wie die Menschen ihre Wahrnehmungen empfinden, ist allerdings eine Frage des Geschmacks und der persönlichen Vorlieben. Der neue Volvo C 70 gibt jedem die Möglichkeit, ganz individuell den Sinnen zu schmeicheln … (Direct Marketing-Prospekt Volvo)
Dieser Progressionstyp entspricht weitgehend der impliziten Wiederaufnahme, die dadurch charakterisiert ist, dass zwischen dem wiederaufnehmenden Ausdruck und dem wiederaufgenommenen Ausdruck keine Referenzidentität besteht (vgl. Brinker 2005, S. 51).
Das skizzierte Modell der Thema-Rhema-Strukturen lässt nun einerseits Einblicke in grundlegende semantische Textstrukturen zu und verdeutlicht die Bedeutung der Satzstruktur für die kommunikative Dynamik eines Textes, wird an zentralen Punkten jedoch auch kritisiert. Das hängt vor allem damit zusammen, dass die verschiedenen Progressionstypen kaum in konsistenter Form vorkommen und ihre Rekonstruktion mit Zunahme der Textlänge äußerst schwierig wird. Zudem scheint etwa die Definition der Begriffe ‚Thema‘ und ‚Rhema‘ vage (vgl. Brinker 2005, S. 51), denn die thematische Basis einer Aussage muss nicht immer die bekannte Information enthalten. So können gerade am Textanfang Sätze auftreten, die überwiegend neue Informationen enthalten, wodurch die Unterscheidung von rhematischen Elementen blockiert wird.
Makrostrukturen
Ein weiteres Konzept, das sich mit der Themenentwicklung eines Textes befasst, ist das im Rahmen der Erzähltextanalyse von van Dijk (1980) entwickelte Konzept der Makrostruktur, das er später noch um Superstrukturen erweitert. Unter Makrostruktur bzw. semantischer Tiefenstruktur versteht van Dijk die globale Bedeutung des Textes, die aus Verfahren der paraphrasierenden Reduktion gewonnen werden kann.
Die Makrostruktur (macrostructure) eines Textes ist dessen genereller Inhalt, der sich durch Makroregeln aus den Mikrostrukturen, also den satzförmigen Einzelpropositionen, ableiten lässt. (Schubert 2008, S. 81)
Zur Ableitung der sog. Makropositionen aus den Propositionen des konkreten Textes finden Operationen Anwendung, die sich in Form von drei zentralen Makroregeln abbilden lassen, d.h. als Auslassen, Verallgemeinern und Konstruieren. Die durch derartige Verfahren gewonnenen Makrostrukturen sollen die Möglichkeit eröffnen, sich an den Inhalt eines Textes zu erinnern, Texte zusammenzufassen und das Thema eines Textes zu benennen:
1 Beim Auslassen werden alle Propositionen entfernt, die für andere Propositionen bzw. für die Interpretation des weiteren Textes irrelevant sind. Das heißt, es geht – im positiven Sinne – um ein Auswählen der für den weiteren Textverlauf bedeutsamen Informationen. So enthält beispielsweise der Satz A girl in a yellow dress passed by. die drei Aussagen:A girl passed by.She was wearing a dress.The dress was yellow. (vgl. van Dijk 1980, S. 46)Wenn es nun für die Interpretation des weiteren Textes unwichtig ist, was das Mädchen trägt und welche Farbe dies hat, kann Aussage a. als die einzig relevante ausgewählt werden.
2 Generalisieren bezeichnet das Umformen und Zusammenfassen inhaltlicher Details zu allgemeineren Aussagen. So lassen sich die Propositionen (a) Mayla füllt ein Bein einer Strumpfhose mit Watte und Wollresten. (b) Greta schneidet an einem Ende einen Halbkreis aus, so dass zwei Spitzen stehen bleiben. und (c) Tim näht Haare aus dicken Wollfäden an. mit folgender Makroproposition verallgemeinern: Die Kinder basteln Stofftiere. Typischerweise werden beim Generalisieren Hyperonyme, also Wörter mit einem größeren begrifflichen Umfang, verwendet.
3 Unter Konstruieren wird das Herstellen einer Makroproposition aus mehreren Mikropropositionen verstanden. Dieses Vorgehen beruht auf Wissensbeständen, die als Frames und Skripts organisiert sind (s.u.), z.B.:Die Frau an der Orgel war die Pianistin des abrupt beendeten kleinen Hauskonzerts. Der Cellist saß auf einem der Chorstühle in der Nähe. Wahrscheinlich würde er später spielen. Nachdem wir uns niedergelassen und ein Weilchen gelauscht hatten, gab es hinten in der Kirche etwas Unruhe. Ich drehte mich nicht um, denn mir war gerade die Kiste aus dunklem polierten Holz aufgefallen, die quer unter dem Altar stand. Der Sarg. Manche Leute nannten ihn Sarkophag. Er war geschlossen. (Alice Munro „Liebesleben“, Frankfurt am Main: Fischer 2013, S. 153)Die in den Sätzen dieses Beispiels aneinandergereihten Mikropropositionen können zu einer Makroproposition Die Erzählperson befindet sich auf einer Beerdigung. zusammengefügt werden.
Mithilfe der Makroregeln kann der Inhalt von Texten zusammengefasst und verallgemeinert werden, wobei sie jedoch in verschiedener Weise angewendet werden können. Somit ergeben sich bei verschiedenen Rezipienten in variablen Kontexten mitunter erheblich voneinander abweichende Makrostrukturen. Im Unterschied zur Makrostruktur stellt eine Superstruktur ein abstraktes Schema dar, das „die globale Ordnung eines Textes festlegt und das aus einer Reihe von Kategorien besteht, deren Kombinationsmöglichkeiten auf konventionellen Regeln beruhen“ (van Dijk 1980, S. 131). Superstrukturen sind demnach Strukturen, die – unabhängig vom Textinhalt – den Texttyp kennzeichnen. Damit übernimmt dieser Ansatz Vorstellungen zur Textorganisation, die mit dem Konzept sog. ‚story grammars‘ (Rumelhart 1975) vorgezeichnet sind. Die Superstruktur wird als Ordnungsschema aufgefasst, auf das der Text zugeschnitten wird. Deshalb hat sie große Bedeutung für die Produktion von Texten und die Text- und Informationsverarbeitung: So erkennt etwa der Hörer/Leser nicht nur, wovon ein Text handelt, sondern vor allem, dass er eine Erzählung ist (vgl. van Dijk 1980, S. 129). Superstrukturen können im Rahmen einer Textsortentypologie dazu dienen, den Aufbau von Textstrukturen nachzuzeichnen (vgl. Kap. 4.1).
Isotopieebenen
Gegenüber den o.g. lexikalischen Elementen, die an der Textoberfläche verankert sind, wird thematische Zusammengehörigkeit auch durch die textbezogene Aktivierung semantischer Merkmale signalisiert. Mit dem Isotopiekonzept wird deshalb versucht, Textverknüpfung ausschließlich unter semantischen Gesichtspunkten, über die Identität semantischer Merkmale zu beschreiben. Das Isotopiekonzept setzt ‚unterhalb‘ der Wortebene an, indem es auf die Semanalyse zurückgreift, d.h., die textverknüpfende Wirkung der Wiederaufnahme wird nicht an ganzen Wortbedeutungen festgemacht, sondern an einzelnen rekurrenten semantischen Merkmalen (vgl. Linke et al. 2004, S. 260f.). Die Grundannahme besteht darin, dass sich Wortbedeutungen über die Satzgrenze hinweg zu textsemantischen Komplexen (Isotopieebenen) verbinden, wobei ein Text jeweils über mehrere solcher Komplexe bzw. Isotopieebenen verfügen kann. Das folgende Textbeispiel lässt als wichtigste Isotopieebene die Wiederkehr des semantischen Merkmals ‚Sinneswahrnehmung‘ erkennen:
Kann man Frühlingssonne schmecken? Wie fühlt sich Sicherheit an? Wie klingt Kraft? Der neue Volvo C 70 ist unsere Hommage an die Sinne. Eine Kombination wie man sie bisher nicht erlebt hat. Und eine Offenbarung für alle, die frei sind, das Besondere zu empfinden.
(Produktargumenter „Der neue Volvo C 70“ 2005, S. 7)
Wie das Beispiel zeigt, eignet sich das Isotopiekonzept auch für die Beschreibung bzw. Analyse von Texten, bei denen gestörte syntaktische und wortsemantische Bezüge vorliegen.
Frame und Skript
Hinweise auf die thematische Entwicklung von Texten ergeben sich vielfach wissensabhängig durch die Vertrautheit mit bestimmten Handlungsrahmen und Handlungsabläufen. Sie ermöglicht es den Rezipienten, in Verbindung mit dem jeweiligen Kontext einen Teil der Sinnkontinuität von Texten durch kognitive Inferenzprozesse zu konstruieren. Für die Beschreibung dieser mentalen Operationen bei der kognitiven Textverarbeitung spielt es eine wichtige Rolle, in welcher Form Wissen mental repräsentiert ist. So werden die meisten Informationen nicht als isolierte Einzelelemente gespeichert, sondern bilden komplexe Wissensbündel, die sich z.B. auf Handlungen wie das Einkaufen oder Autofahren beziehen können. Generalisierte Formen solcher Wissensrepräsentationen stellen sog. ‚globale Muster‘ wie Frames und Skripts dar, mit deren Hilfe die Weltwahrnehmung und Welterfahrung vorstrukturiert und somit das Erkennen von Handlungen bzw. Handlungsfragmenten erleichtert wird (vgl. Schubert 2008, S. 72), um den Zusammenhang zwischen Weltwissen bzw. Handlungswissen und den in einem Text vermittelten Informationen nachvollziehen zu können. Es geht dabei wiederum um Bezüge zwischen Aussagen und Sätzen, die auch dann hergestellt werden, wenn grammatische oder semantische Verknüpfungen fehlen, die etwa auch die Voraussetzung dafür bilden können, dass noch nicht eingeführte Textelemente mit dem bestimmten Artikel stehen können. Solche Textbezüge kommen jedoch nur zustande, wenn ein gemeinsamer außersprachlicher Sachbezug vorliegt (vgl. Linke et al. 2004, S. 265f.).
Mit Frames lassen sich Wissensbestände beschreiben, die als statische Zusammenhänge zwischen Einheiten des Weltwissens organisiert sind. Zu diesen Frames gibt es typische slots, die mit fillers versehen werden. Wenn ein Rezipient den jeweiligen Frame kennt, kann er beim Textverstehen die Wörter eines Textes als Fillers diesen im Weltwissen gespeicherten Slots zuordnen oder sie durch das Mittel der Inferenz aus seiner Weltkenntnis ergänzen. Das bedeutet auch, dass sobald ein bestimmter Frame wie z.B. ‚Auto‘ identifiziert ist, Begriffe, die Verständnisprobleme bereiten, vor dem Hintergrund eines existierenden Fachwortschatzes rezipiert werden. Im folgenden Textausschnitt gilt das beispielsweise für Wörter wie Leon oder Dynamik-Paket:
Seit der Einführung des ST bietet Seat für den Leon auch den empfehlenswerten Notbremsassistenten „Front Assist“ an (290 €), der Auffahrunfälle vermeiden oder deren Folgen zumindest reduzieren kann. Das neue adaptive Fahrwerk, das für die stark motorisierten FR-Varianten in Kombination mit einer progressiven Lenkung als Dynamik-Paket angeboten wird (760 €), sorgt für einen guten Federungskomfort und ein angenehmes Fahrgefühl.
(ADAC Motorwelt 3/2014, S. 36)
Als Skripts werden Wissensbestände beschrieben, die sich auf den dynamischen Ablauf bestimmter Handlungszusammenhänge beziehen und den beteiligten Elementen deshalb eine chronologische Reihenfolge zuordnen. Skripts beschreiben einen charakteristischen Handlungsablauf einschließlich der zugehörigen Gegenstände bzw. Aktanten und können Wissen über individuell und sozial standardisiertes und erfolgreiches Handeln in einer bestimmten Kultur enthalten.
Für die Rezeption bzw. das Verstehen vieler Texte wird sowohl eine statische als auch eine dynamische Perspektive auf Wissensbestände benötigt. So setzt z.B. der folgende Text den Frame ‚Automobil und Cabriolet‘ voraus, der eng mit dem Skript ‚Autofahren bzw. die Instrumente eines Autos bedienen‘ verbunden ist:
Der Volvo C 70 ist Coupé und Cabrio zugleich. Dazwischen liegen weniger als ein Knopfdruck und 30 Sekunden. Er verbindet Kraft und Agilität mit Leichtigkeit. In seinem geräumigen Innenraum reisen vier Erwachsene auch auf langen Strecken unvergleichlich komfortabel.
(Volvo Direct Marketing-Prospekt 2010)
Präsuppositionen
Das Konzept der Präsuppositionen dient vor allem dazu, den Anteil von außersprachlichen Wissensbeständen bei der Konstitution von Textkohärenz zu erfassen. Präsuppositionen gehören zu den voraussetzenden Bedingungen, die gegeben sein müssen, um angemessene bzw. korrekte Äußerungen produzieren und rezipieren zu können. Sie werden innerhalb der Äußerung jedoch nicht explizit ausgedrückt. Daraus ergeben sich neben der Möglichkeit, erhebliche Teile an textuellem Material einzusparen, auch zahlreiche weitere relevante Aspekte für die stilistische Gestaltung bzw. für die Erklärung von Stilabsicht und Stilwirkung. Hierzu zählen etwa im Hinblick auf Textsorten mit persuasiver Funktion bestimmte Techniken für die Vermittlung von Kenntnissen oder die Veränderung von Einstellungen. In diesem Zusammenhang geht es weniger um pragmatische Präsuppositionen – also nicht sprachlich formulierte, aber durch den Text vorausgesetzte Wissensbestände und Alltagserfahrungen, die sich erst aus dem Gebrauch, den man von einem sprachlichen Ausdruck macht, ergeben (auch gebrauchsgebundene Präsuppositionen, vgl. Linke et al. 2004, S. 261ff.) –, sondern eher um zeichengebundene Präsuppositionen, die direkt an den materiell gegebenen Text, also an bestimmte Konstruktionen oder Wortbedeutungen gebunden sind.
Das sind zum einen sog. ‚Existenzpräsuppositionen‘ bzw. ‚referentielle Präsuppositionen‘, die beispielsweise durch die Verwendung des bestimmten Artikels oder die Setzung von definierenden Attributen ausgelöst werden. So enthalten die Aussagen Das versenkbare Metalldach des neuen Volvo C 70 ist ein Meisterwerk der Ingenieurskunst … und Das tiefer gelegte Fahrwerk des neuen Volvo C 70 verbessert das Fahrergebnis zusätzlich … auf jeden Fall folgende referentiellen Präsuppositionen:
‚Der neue Volvo C 70 hat ein versenkbares Metalldach‘,
‚Der neue Volvo C 70 hat ein tiefer gelegtes Fahrwerk‘ und
‚Es gibt einen neuen Volvo C 70‘.
Zu den zeichengebundenen Präsuppositionen gehören zum anderen die semantischen Präsuppositionen, die an die Bedeutung einzelner Wörter oder Ausdrücke gebunden sind. Dabei geht es um die nicht direkt angesprochene, aber mitgemeinte Bedeutung, die mit bestimmten Äußerungen verknüpft ist. Hierzu zählt etwa die Verwendung implikativer Verben (wie z.B. es fertig bringen, sich herablassen, gelingen; vgl. Grewendorf et al. 1996, S. 432). Zum Beispiel wird mit dem Satz: Volvo hat es geschafft, die Sicherheit einer geschlossenen Limousine mit der Ästhetik eines reinrassigen Cabriolets zu kombinieren. auch ausgesagt, dass sich das Unternehmen ‚Volvo‘ in irgendeiner Weise um dieses Ergebnis („Das beste zweier Welten“) bemüht hat. Denn die Bedeutung von es schaffen, etwas zu tun schließt ein ‚Sich-bemüht-haben‘ mit ein.
Das bedeutet, beide Formen zeichengebundener Präsuppositionen erlauben dem Textproduzenten, mit der Äußerung bestimmter Sätze gewisse Tatbestände und Sachverhalte zu behaupten bzw. als gegeben zu unterstellen, die selbst nicht explizit thematisiert bzw. mit den verwendeten Ausdrücken nicht explizit ausgesagt werden. Sie können dadurch auch eine Art ‚verdeckte Rekurrenz‘ bzw. ‚verdeckte Substitution‘ ermöglichen, die zur Kohärenzbildung beiträgt (vgl. Linke et al. 2004, S. 263f.).