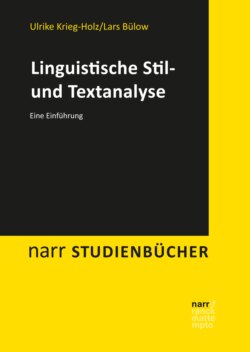Читать книгу Linguistische Stil- und Textanalyse - Lars Bülow - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Wortarten
ОглавлениеWörter lassen sich aufgrund ihrer grammatisch-lexikalischen Eigenschaften Wortarten zuordnen.1 Gängige Wortartklassifikationen gehen in der Regel von morphologischen Kriterien aus, wie der grundlegenden Unterscheidung zwischen flektierbaren und nicht-flektierbaren Wörtern bzw. bei erstgenannten zwischen deklinierbaren und konjugierbaren (vgl. Abb. 8):
Abb. 8:
Wortartendifferenzierung nach morphologischen Kriterien
Substantive, Adjektive, Artikel und Pronomen sind deklinierbar, d.h., sie enthalten Kasus-, Numerus-und Genusinformationen. Diese Kategorien sind im Deutschen folgendermaßen gegliedert:
| Kasus: | Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ |
| Numerus: | Singular, Plural |
| Genus: | Maskulinum, Neutrum, Femininum |
Verben sind konjugierbar. Sie können nach Merkmalen der Kategorien ‚Person‘, ‚Numerus‘, ‚Tempus‘, ‚Modus‘ und ‚Genus verbi‘ bestimmt werden, worin sich folgende Teilkategorien spiegeln:
| Person: | 1., 2., 3. |
| Numerus: | Singular, Plural |
| Tempus: | Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I, Futur II |
| Modus: | Indikativ, Konjunktiv I und II, Imperativ |
| Genus verbi: | Aktiv, Passiv |
Darüber hinaus wird zwischen offenen und geschlossenen Wortklassen unterschieden. Offene Wortklassen können insbesondere durch Wortbildung ständig erweitert werden. Zu ihnen gehören die lexikalischen Inhaltswörter, sog. Autosemantika (Substantive, Verben, Adjektive). Geschlossene Wortklassen umfassen die grammatischen Funktionswörter, sog. Synsemantika, die die Inhaltswörter eines Syntagmas verbinden (z.B. Präpositionen, Konjunktionen). Geschlossene Wortklassen unterliegen diachron betrachtet deutlich geringeren und langsameren Veränderungen als offene.
Im Vergleich zu anderen deklinierbaren Wortarten verfügen Substantive über ein relativ festes Genus. Gelegentlich kommt es auch zu Genusschwankungen, die in den meisten Fällen regional bedingt sind (z.B. die/das Cola; vgl. Kap. 3.2.2). Die Genuszuweisung erfolgt nicht zufällig, sondern ist von semantischen, phonologischen, morphologischen und pragmatischen Kriterien abhängig (vgl. Köpcke/Zubin 2009). In semantischer Hinsicht können Substantive in Abstrakta (z.B. Freiheit, Liebe, Würde), Konkreta wie Appellativa (z.B. Stuhl, Bibliothek) und Stoffsubstantive (‚nicht zählbare Entitäten‘ z.B. Wasser, Mehl) sowie Eigennamen (z.B. Paul, Bello) unterschieden werden.
Die Besonderheit der Wortart Adjektiv besteht in ihrer Fähigkeit zur Bildung von Vergleichsformen (Komparation), die sie neben dem Positiv (z.B. schön) auch Komparativ- und Superlativformen bilden lässt (z.B. schöner – am schönsten). Adjektive lassen sich attributiv (4a), prädikativ (4b) und adverbial (4c) verwenden. In der prädikativen und adverbialen Verwendung werden sie nicht dekliniert.
1 a) die schöne Fraub) Die Frau ist schön.c) Die Frau schreibt schön.
Innerhalb der Wortart Artikel wird zwischen bestimmten und unbestimmten Artikeln unterschieden. Mit dem bestimmten Artikel werden – im Gegensatz zum unbestimmten – Substantive verbunden, die in der Kommunikationssituation von den beteiligten Kommunikationspartnern eindeutig zugeordnet werden können. Von den Artikeln lassen sich die Pronomen mitunter schwer abgrenzen, weshalb sie in einigen Grammatiken zu einer Wortart zusammengefasst werden (vgl. Duden-Grammatik 2006 oder Boettcher 2009a). Auch Pronomen determinieren die Referenz des Substantivs, wobei sie als Begleiter an die Position des Artikels treten oder als Stellvertreter das Substantiv (bzw. die ganze Nominalphrase) ersetzen können. Eine mögliche Unterscheidung von Pronomen ist die folgende:
| Personalpronomen: | z.B. ich, du, er |
| Possessivpronomen: | z.B. mein, dein, sein |
| Demonstrativpronomen: | z.B. dieser, diese |
| Indefinitpronomen: | z.B. alle, einige, manche |
| Reflexivpronomen: | z.B. sich |
| Interrogativpronomen: | z.B. wer, was, welches |
| Relativpronomen: | z.B. der, die |
Verben bilden die konjugierbare Wortart. Sie besteht zum überwiegenden Teil aus Vollverben, die sich durch eine selbstständige lexikalische Bedeutung auszeichnen und durch Wortbildung erweitert werden können. Vollverben lassen sich u.a. folgenden semantischen Gruppen zuordnen:
| Handlungsverben: | z.B. waschen, anrufen |
| Zustandsverben: | z.B. schlafen, sitzen |
| Vorgangsverben: | z.B. blühen, regnen |
Als spezifische Gruppen von Verben können darüber hinaus Hilfsverben, Modalverben und Kopulaverben unterschieden werden.
Als Hilfsverben werden die Verwendungsweisen von haben, sein und werden als Exponenten morphologischer Kategorien, d.h. etwa als analytische Tempus- und Diathesenformen (z.B. Perfekt, Passiv), bezeichnet:
1 Er ist heute früher aus der Schule gekommen.
Zu den Modalverben gehören können, müssen, dürfen, wollen, sollen und mögen. Sie treten zusammen mit infiniten Vollverben (6a) oder Kopulaverben (6b) auf. Semantisch bezeichnen Modalverben eine Notwendigkeit, Erlaubnis, Möglichkeit oder Fähigkeit.
1 a) Ich kann morgen laufen.b) Er durfte in der Kabine der Stars sein.
Kopulaverben (v.a. sein, bleiben, werden) verfügen ebenso wie die Hilfsverben nur über eine sehr abgeschwächte lexikalische Bedeutung. Sie haben die Funktion, die Beziehung zwischen Subjekt und Prädikativ herzustellen, indem sie einen Zustand oder das Eintreten eines Zustandes bezeichnen.
1 a) Er ist Architekt.b) Sie war sehr talentiert.
Die nichtflektierbaren Wortarten bilden eine sehr heterogene Klasse, die in der Forschungsliteratur ganz unterschiedlich subklassifiziert wird.2 Da die Nichtflektierbaren keine morphologische Kennzeichnung i.e.S. enthalten, werden als Unterscheidungskriterien u.a. verschiedene syntaktische Funktionen und Vorkommensorte herangezogen (vgl. Boettcher 2009a, S. 130):
| Adverbien | = Vorfeld besetzend möglich |
| Präpositionen | = Kasus regierend |
| Konjunktionen | = Teilsatz oder Satzteil verbindend |
| Rest als Sammelgruppe der Partikeln |
Gegenüber den anderen Nichtflektierbaren zeichnen sich die Adverbien durch ihre topologischen Eigenschaften aus, denn sie können alleine im Vorfeld von Sätzen stehen (sie sind also vorfeldfähig). Daraus folgt u.a., dass sie satzgliedfähig sind. Hinsichtlich ihrer Struktur ist zwischen einfachen (z.B. oft, gern) und komplexen Adverbien zu unterscheiden, wobei komplexe häufig eine Präposition enthalten (sog. ‚Präpositionaladverbien‘ z.B. davor, hiernach). Adverbien liefern entweder eigene lexikalische Informationen (z.B. montags, immer oder vielleicht) oder nehmen Elemente aus dem vorhergehenden Satz wieder auf (z.B. An der Wand stand ein Stuhl. Darauf setzte sie sich).
Präpositionen sind Wörter wie in, wegen, um … willen, die meistens zusammen mit einem Nomen, aber auch mit einem Adjektiv (z.B. Sie kommt für gewöhnlich um fünf.) oder einem Adverb (z.B. von dort) vorkommen können. Sie betten verschiedene Phrasen wie die Nominalphrase ein. Nomen geben sie einen spezifischen Kasus vor (z.B. durch den Wald (laufen)).
Sätze oder Satzteile werden durch Konjunktionen3 (z.B. und, weil, obwohl) neben- und unterordnend verbunden. Sie bestimmen diese Verbindung semantisch-logisch (z.B. ‚kausal‘: Weil er krank war, kam er nicht).
Partikeln weisen jeweils Besonderheiten im Stellungsverhalten auf und sind wiederum vielfältig subklassifizierbar. Ihre Formative begegnen mitunter auch in anderen syntaktischen Funktionen. Partikeln spezifizieren Aussagen, kommentieren sie, moderieren sie und dienen der Steuerung von Gesprächsverläufen. Nach unterschiedlichen semantischen Funktionen ist folgende Differenzierung möglich (vgl. Boettcher 2009a, S. 155ff.):
| Gradpartikeln, z.B.: sehr, fast, höchst, kaum |
| Fokuspartikeln, z.B.: nur, auch, sogar |
| Kommentarpartikeln, z.B.: sozusagen, gleichsam |
| Negationspartikel, z.B.: nicht |
| Einstellungspartikeln, z.B.: ja, doch, wohl, nur, bloß |
| Gesprächsgebundene Partikeln, z.B.: Begrüßungs-/Verabschiedungspartikeln wie hallo, tschüss, aufmerksamkeitssteuernde Partikeln wie he, ey, Antwortpartikeln wie ja, nein, doch oder Kontaktpartikeln wie ne, oder |