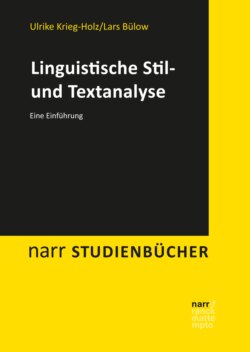Читать книгу Linguistische Stil- und Textanalyse - Lars Bülow - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Textkonstitution durch grammatische und lexikalische Elemente an der Textoberfläche: Kohäsion
ОглавлениеEinen wesentlichen Beitrag zur Textkonstitution können grammatische und lexikalische Elemente an der lesbaren Textoberfläche leisten. Obwohl sie natürlich zu einzelnen Sätzen und Satzteilen gehören, bezieht sich ihre Funktion auf die Ebene des Textes, denn sie erlauben Schlüsse über den Zusammenhang der Einzelsätze.
Beruht der Textzusammenhang auf textuellen Zeichenbeziehungen, die an grammatische Funktionswörter und -zeichen gebunden sind – dazu gehören vor allem diejenigen Wortarten, die mehr oder weniger abgeschlossene Klassen bilden – liegt grammatische Kohäsion vor. Sie bildet die grammatikalische Grundlage für die Verknüpfung von Sätzen zu Texten.
Pro-Formen
Als häufiger und deshalb zentraler Typ der Kohäsionsherstellung gilt im Deutschen eine spezifische Form der Wiederaufnahme, die Verknüpfung durch Pro-Formen. Dafür muss jeweils ein Ausdruck vorhanden sein, der den Satz rückwärts, d.h. zum Vorgängersatz bzw. -teilsatz anschließt (Substituens) und einer, der die Möglichkeit eröffnet, einen Nachfolgesatz bzw. -teilsatz anzuhängen (Substituendum). So zeigt etwa das folgende Beispiel eine durchgehende pronominale Verkettung, die erheblich zur Konstitution des Textes beiträgt:
Es war einmal eine kleine, süße Dirnej, diej hatte jedermannk lieb, derk siej nur ansah, am allerliebsten aber ihrej Großmutterl; diel wusste gar nicht, was siel alles dem Kindej geben sollte. Einmal schenkte siel ihmj ein Käppchen von rotem Sammet, und weil ihmj das so wohl stand und esj nichts anderes mehr tragen wollte, hieß es nur das Rotkäppchenj. („Die besten Märchen der Gebrüder Grimm“ 2001, S. 113 [Indizes zur Identifikation von Referenten nicht im Original])
Pro-Formen sind kurze Stellvertreterwörter, die auf andere Elemente des Textes verweisen, um einen semantischen Zusammenhang zu signalisieren. Typische Vertreter sind Pronomina, die in der Regel mit dem Ausdruck, den sie vertreten, in Genus und Numerus übereinstimmen. Für den entsprechenden Vorgang hat sich der Terminus ‚Pronominalisierung‘ etabliert, er bezeichnet die Vertretung eines sprachlichen Ausdrucks durch ein referenzidentisches Pronomen.1
Den Begriff ‚Referenz‘ haben Halliday/Hasan (1976) für die Funktion der Personal- und Demonstrativpronomina eingeführt. Er bezieht sich darauf, dass zwei- oder mehrmals auf denselben außersprachlichen Gegenstand oder Sachverhalt Bezug genommen wird, wobei zwischen einer Pro-Form und ihrem Bezugselement sog. „Koreferenz“ (also ein eindeutiger referentieller Bezug) besteht.
Hinsichtlich der Verweisrichtung sind prinzipiell außersprachliche von innersprachlichen Verweisen zu unterscheiden. Letztere fungieren textverknüpfend und sind damit phorische Verweise, während die zuerst genannten deiktisch zu interpretieren sind. Deiktisch fungieren in Texten etwa selbständig gebrauchte Pronomina.2 Sagt im Falle eines Autokaufs ein Sprecher zu seinem Gegenüber beispielsweise Ich nehme diesen hier und zeigt bei dieser Äußerung gleichzeitig auf ein bestimmtes Fahrzeug, so wird er auf jeden Fall verstanden. Möglicherweise versteht der Hörer durch die Wahl des Maskulinums ‚Ich nehme diesen Wagen hier‘ oder auch etwas anderes wie ‚Ich nehme diesen BMW hier‘, denn es gibt in einer solchen Situationen kein Substantiv, das eindeutig als das Bezugssubstantiv identifiziert werden kann. Weil mit dem Pronomen eindeutig auf einen bestimmten Gegenstand referiert wird, kann auch die Genuswahl zweitrangig sein: z.B. Ich nehme dieses hier (‚Ich nehme dieses Auto hier‘). Beim selbständigen Gebrauch erhält das Pronomen also seine grammatischen Eigenschaften (insbesondere Genus und Numerus) nicht durch eine formale Korrelation mit einem Bezugsausdruck, sondern aus anderen Quellen wie den Eigenschaften des Bezeichneten (vgl. Eisenberg 2006b, S. 167f.). Im Rahmen der Textanalyse sind solche Ausdrücke, bei denen sich das, was sie bezeichnen, nur unter systematischem Bezug auf die Äußerungssituation interpretieren lässt, also als deiktische, als außersprachliche Verweise einzustufen. Sie haben in der Regel die Neuorientierung des Adressaten auf ein Objekt, einen Sachverhalt usw. zum Ziel. Deiktisch gebrauchte Ausdrücke haben eine zeigende Bedeutung.3 Sie werden organisiert mithilfe des Begriffs ‚Origo‘, der die in Raum und Zeit situierte Äußerungssituation bezeichnet. Die Origo ergibt sich durch den Sprecher (ich), der an einem bestimmten Ort (hier) und zu einer bestimmten Zeit (jetzt) spricht. Diese urdeiktischen Ausdrücke ich, hier und jetzt bilden jeweils die Zentren eines Systems von Deiktika, die Personaldeixis, die Raumdeixis und die Zeitdeixis, die die Person-, Raum- und Zeitstruktur von Äußerungen betreffen.
Zur Textverknüpfung tragen Pronomina mit phorischer Funktion4 bei, weil sie auf Elemente innerhalb eines Textes verweisen. Beim phorischen Gebrauch wird die Form eines Pronomens von der Form eines anderen Elements, i.d.R. eines Substantivs bestimmt: z.B. An der Ecke stand Niklas. Er sah gestresst aus. Hier hat das Pronomen eine kontextgebundene Wortbedeutung. In Bezug auf die Richtung des Verweises bzw. der Verknüpfung können dabei zwei Varianten unterschieden werden: Geht der Bezugsausdruck wie im oben genannten Beispiel dem Pronomen voraus, liegt eine anaphorische Verknüpfung vor. Folgt der Bezugsausdruck dem Pronomen, wird dies als kataphorische Verknüpfung bezeichnet.
Anaphorische Elemente beziehen sich auf vorangehende Teile des Textes, während kataphorische Elemente auf nachfolgende Textteile vorausweisen.
Der anaphorische Gebrauch von Pronomina ist weitaus häufiger als der kataphorische. Das liegt vor allem daran, dass kataphorische Pronomina schwerer zu verarbeiten sind als anaphorische, weil zunächst offen bleibt, worauf sie sich beziehen. In kataphorischer Position begegnen Pronomen etwa bei Herausstellungen: z.B. Der ist nett, dein neuer Freund (vs. Dein neuer Freund, der ist nett)
Grammatische Vor- und Rückverweise beziehen sich auf Elemente des gleichen Texts, die zu ihrer Interpretation notwendig sind. Dabei kann der Umfang des Elements, auf das hingedeutet wird, erheblich variieren. Es kann sich um einzelne Substantive handeln, auch um komplexe Nominalgruppen, ganze Sätze oder sogar Satzfolgen. Die meisten grammatischen Vor- und Rückverweise operieren in der näheren Textumgebung, das bedeutet, sie bewirken eine Verknüpfung innerhalb eines Satzes oder von Satz zu Satz (z.B. Sebastian war nicht gekommen, das ärgerte mich.). Eine wichtige Rolle bei der Textverknüpfung spielen Personalpronomina, wenngleich nur die Personalpronomina der 3. Person anaphorisch oder kataphorisch verknüpfen können. Charakteristisch für die Personalpronomina der 1. und 2. Person ist eine deiktische Verwendung. Sie wechselt mit der Sprecherrolle: z.B. du bist schuld – nein, du. Die Personalpronomina der 1. und 2. Person bezeichnen die sprechende und die angesprochene Person, die jeweils situationsabhängig variieren. Das heißt, worauf man mit ich und du referiert, ist rein kontextuell fixiert. Es sind außersprachliche Verweise.
Pronominalisierung beschränkt sich jedoch nicht auf Personalpronomina, sondern kann z.B. ebenso durch Relativpronomina (z.B. der, welcher), Demonstrativpronomina (z.B. der, dieser, derjenige) und Indefinitpronomina (z.B. alle, einige, etliche, (irgend)jemand) erfolgen. Während sich Relativpronomina auf die Stellvertreterfunktion beschränken und sich dabei als nebensatzeinleitendes Element auf einen im anderen Satz ausgeführten Satzteil beziehen (z.B. Im Zimmer stand meine Mutter, die / welche gerade nach Hause gekommen war.), können die beiden letzten jedoch auch andere Funktionen übernehmen. Deshalb ist in Abhängigkeit zum jeweiligen Äußerungskontext zu prüfen, ob sie als Verknüpfungselement fungieren oder nicht (z.B. Es war einmal ein Mann, der hatte sieben Söhne. (= phorisch) vs. Der war es. (= deiktisch im Sinne von gestisch)).5
Auch die Verwendung von Possessivpronomina trägt zur Textverknüpfung bei, indem sie einen vorher erwähnten Bezugsausdruck entweder vertreten (z.B. das Seine) oder ein Nomen als hinreichend eingeführt markieren. Im zweiten Fall geht es um Formen von mein, dein, sein, die Artikel ersetzen und sich wie diese verhalten. Charakteristisch ist für die 1. und 2. Person wie bei den Personalpronomina eine deiktische Verwendung, denn sie wechseln mit der Sprecherrolle (z.B. Das ist meine Puppe – nein, meine!) und die Kenntnis der Situation entscheidet über den jeweiligen Besitzer. Possessivpronomina der 3. Person werden wiederum nicht deiktisch, sondern nur phorisch gebraucht: z.B. An der Ecke stand Niklas. Sein Mantel war völlig verdreckt.
Die Verwendung von Pronomina als grammatisches Verknüpfungsmittel stellt zugleich immer einen Hinweis auf die thematische Zusammengehörigkeit von Äußerungen dar. Besonders deutlich wird dies z.B. im Falle der Beibehaltung des Themas am Erzählanfang:
Kluftinger keuchte. Im Augenwinkel sah er die beiden Männer, die sich die Böschung hinunter zu dem kleinen Kahn am Ufer kämpften. Er blickte ihnen nach. Das Bild, das er sah, rief Erinnerungen in ihm wach, an die er lieber nicht rühren wollte. Das Wasser, das Boot … er kniff die Augen zusammen als könnte er so die Bilder verjagen. Als er die Augen wieder öffnete, hatten die beiden Männer den Kahn bereits vom Ufer abgestoßen.
(Volker Klüpfel/Michael Kobr „Laienspiel“ 2009, S. 5)
Zu den grammatischen Mitteln der Textverknüpfung zählen auch die wichtigsten Begleiter des Substantivs im Deutschen, die Artikel. Sie geben Hinweise darauf, wo die Informationen zu suchen sind, mit deren Hilfe die konkrete Referenz eines Ausdrucks bestimmt werden kann. Während mit dem unbestimmten Artikel auf einen einzelnen Menschen, Gegenstand oder Sachverhalt referiert wird, ohne ihn zu identifizieren (z.B. Er wünscht sich einen Freund.), wird mit der Verwendung des bestimmten Artikels signalisiert, dass das vom Artikel begleitete Substantiv als eindeutig identifiziert gelten soll. Der bestimmte Artikel verknüpft im Text in der Regel anaphorisch, der unbestimmte in der Regel kataphorisch.
Aufgrund ihrer Begleiterfunktion verknüpfen Artikel nicht durch das Ersetzen eines Bezugselements, sondern dadurch, dass sie auf Elemente im Text, in der Situation oder in Wissenskontexten hinweisen, die zu berücksichtigen sind (vgl. Hausendorf/Kesselheim 2008, S. 76f.).
Interpunktionszeichen
Innerhalb geschriebener Texte stehen die Sätze in der Regel nicht unverbunden nebeneinander, sondern werden durch Interpunktionszeichen strukturiert. Dabei handelt es sich um nichtalphabetische Zeichen, die der optischen Gliederung von Texten dienen, indem sie bestimmte Grenzsignale am Rand oder im Inneren von Sätzen geben. Inhaltlich sind Interpunktionszeichen meist wenig festgelegt und somit offen für vielfältige textuelle Intentionen und Deutungen.
Das neutrale Satzschlusszeichen ist der Punkt. Er steht am Ende eines abgeschlossenen (auch mehrteiligen) Ganzsatzes, wenn dieser nicht besonders gekennzeichnet werden soll, und entspricht der Großschreibung am Satzanfang. Nach freistehenden, vom übrigen Text deutlich abgehobenen Zeilen wie z.B. Überschriften, Buchtiteln oder Grußformeln steht kein Punkt. In diesen Fällen wird der Punkt als Kohäsionszeichen durch Musterhaftigkeit auf der Ebene der texträumlichen Gestaltung ersetzt.
In weniger standardisierten Textsorten wird durch das Setzen eines Punktes mitunter das Fehlen von Satzgliedern kompensiert, etwa dann, wenn der Text gesprochene Sprache abbildet oder sich im Stil an ihr orientiert. Zudem hat sich in zahlreichen Textsorten ein von den Grundregeln abweichendes Interpungieren etabliert, das zum rein ausdrucksseitigen Zerschneiden kompletter Sätze führt und einer besonderen Figurierung dienen soll (vgl. Kap. 3.3.3 und Kap. 4.3), z.B.:
Behalten Sie alles im Griff. Vor allem den Verkehr. (Direct Marketing-Prospekt Mercedes)
Funktional spezialisierte Schlusszeichen sind das Ausrufezeichen und das Fragezeichen. Das Ausrufezeichen markiert neben dem Ausruf auch die Funktion von Befehl, Bitte und Wunsch. Es verfügt über eine starke Ausdruckswirkung, weshalb es gerade bei Imperativ- und Desiderativsätzen manchmal nicht gesetzt wird, z.B.:
Schenken Sie Mädchen Zukunft! Werden auch Sie Pate. 6
Mit dem Ausrufezeichen kann jede beliebige Äußerung zum Ausruf werden und eine emphatische Intonation simulieren, die ein expressives bzw. emotionales Wirkungspotential hat, z.B.:
Es ist ein Mädchen! Das Geburtsband liegt bei!
Mädchen sind in vielen Kulturen nur Menschen zweiter Klasse ohne
Perspektive, deshalb brauchen sie Ihre Unterstützung!
Textuell geht gerade von den so verwendeten Ausrufezeichen ein starkes Verknüpfungssignal aus, das sich textsortenabhängig auch auf mehrere, in texträumlicher Hinsicht entfernte bzw. frei stehende Textabschnitte beziehen kann.
Das Fragezeichen kennzeichnet eine Äußerung als Frage und entfaltet vor allem als rhetorische Frage, d.h. als Fragesatz, der nicht darauf abzielt, vom Rezipienten eines Textes beantwortet zu werden, seine kohäsive Wirkung, z.B.:
Woher ich das weiß? Meine Patentochter schreibt mir.
Dies gilt etwa auch für rhetorische Fragen in Überschriften, die dem Thematisieren von Inhalten dienen, oder für Alternativfragen in Kontexten, in denen eine Alternative allgemein akzeptiert ist und nur in Erinnerung gerufen werden soll, um die Kommunikations- oder Argumentationsbasis zu sichern.
Ähnlich wie die Schlusszeichen fungiert das Komma als ein Anknüpfungszeichen, das zwischen sprachlichen Einheiten steht und deren Gliederung dient. Dabei wird es typischerweise zur Abgrenzung von Einheiten verwendet, die keinen selbstständigen Status haben, wie z.B. untergeordnete Sätze oder koordinierte Teile von Aufzählungen. In seiner Funktion, einzelne Aussagen von Texten zu verbinden, unterliegt das Komma kaum Beschränkungen.
Der Doppelpunkt gibt das Signal, dass etwas folgt, und bewirkt ohne Konnektoren eine enge sinngemäße Verbindung zwischen einzelnen Sätzen und Satzteilen. Der Doppelpunkt kündigt wörtlich wiedergegebene Äußerungen und Textstellen an, ebenso Aufzählungen, Angaben, Erläuterungen oder Titel. Darüber hinaus kann der Doppelpunkt vor Sätzen stehen, die das Gesagte zusammenfassen oder eine Schlussfolgerung daraus ziehen, z.B.:
Das bedeutet langfristig auch: Mädchen werden die Zukunft von
Entwicklungsländern nachhaltig beeinflussen.
Ich bitte Sie daher: Werden Sie Patin für ein Mädchen, denn es warten noch
so viele auf eine bessere Zukunft.
Und: Plan berichtet regelmäßig über meine Patentochter und die Projekte
im Umfeld ihrer Familie.
Der Doppelpunkt eignet sich dabei auch zur Steuerung von Aufmerksamkeit, indem er diese auf die Wörter, Sätze oder Textabschnitte nach ihm lenkt und sie betont.
Der Gedankenstrich ist ein Verknüpfungszeichen, das vorwiegend der Signalisierung von größeren Einschnitten im Satz- und Textverlauf dient. Sie ergeben sich beispielsweise durch Einschübe im Satz, wie lockere Appositionen und Parenthesen. Außerdem ermöglicht der Gedankenstrich, Zusätze und Nachträge deutlich von der übrigen Aussage abzugrenzen und somit auf ähnliche Weise wie der Doppelpunkt zur Aufmerksamkeitssteuerung beizutragen, z.B.:
Das junge Mädchen, dessen Foto meinem Schreiben beiliegt, hat nun eine Chance – dank eines Paten.
Mithilfe von Aufzählungszeichen werden gleichgeordnete Aspekte eines gemeinsamen thematischen Ausgangspunktes aufgezählt und als zusammenhängend gekennzeichnet (z.B. Listen). Häufig sind dabei die Einzelaussagen durch Absatz und Einrückung texträumlich besonders hervorgehoben.
Konnektoren
Ein wichtiges Mittel zur Herstellung von Kohäsion ist die Verknüpfung von Aussagen und Sätzen durch kausale, temporale und zahlreiche andere Relationen, die sog. Konnexion. Diese Form der Verknüpfung von Texteinheiten wird durch Konnektoren realisiert, die die Funktion von textuellen Bindewörtern übernehmen. Zum Paradigma der Konnektoren gehören im Wesentlichen Konjunktionen, Subjunktionen und bestimmte Adverbien, aber auch Abtönungspartikeln und Präpositionen.
Konjunktionen verbinden sprachliche Einheiten auf gleicher Ebene. Als einfache Satzkonjunktionen (z.B. und, oder, denn) stehen sie bei der Anbindung des Satzes normalerweise vor dem Vorfeld (vgl. Kap. 2.2; z.B. Denn er verträgt einfach nicht so viel Süßes.). Es gibt auch paarige Vertreter (z.B. entweder – oder).
Innerhalb komplexer Sätze zeigen Subjunktionen (z.B. weil, da, wenn, falls, nachdem) die Unterordnung von Nebensätzen an. Dabei bedingen sie die Endstellung des finiten Verbs und stehen immer an der ersten Stelle. Auf der Textebene sind vor allem diejenigen von Bedeutung, die vollständige Aussagen zueinander in Beziehung setzen, z.B.:
Das Eis beginnt zu schmelzen, da der Gefrierpunkt der Salzlösung unter dem des reinen Wassers liegt.
Adverbien (z.B. danach, schon, schließlich, daher, deshalb, hierbei) können einerseits dazu dienen, anaphorisch Inhalte vorangegangener Sätze wiederaufzunehmen (z.B. Das sicherlich interessanteste Ergebnis ist die Bewertung der angebotenen Speisen. Hierbei wurde nach dem Schulnotensystem bewertet, also der Skala von Note 1–6.).
Resultiert ihre Textfunktion daraus, dass sie Sätze miteinander verbinden, gehören sie zum Kohäsionstyp der Konnexion, z.B.:
Langsam wird so aus dem gefrorenen Eis eine flüssige Kochsalzlösung, die nicht mehr gefriert. Deshalb können auch die Autos wieder fahren und die Fußgänger sicher über die Straße gehen.
Im Vergleich zu Adverbien nehmen Abtönungspartikeln im Satz keine Satzgliedstelle ein. Als Abtönungspartikeln gelten bestimmte Verwendungsweisen von Wörtern wie ja, denn, doch, aber, nur, halt, schon, nicht oder ruhig.7 Zu den topologischen Merkmalen von Abtönungspartikeln gehört vor allem ihre Vorfeldunfähigkeit, d.h., sie können nicht die erste Stelle im Satz einnehmen, sondern sie sind an das Mittelfeld eines Satzes gebunden. Dort stehen sie in der Regel vor der relevanten neuen Information, dem Rhema, und tragen damit zur kommunikativen Gliederung des Satzes bei. Ihre allgemeine Funktion besteht darin, sehr differenziert Einstellungen, Annahmen, Bewertungen und Erwartungen des Sprechers bezüglich des geäußerten Sachverhalts auszudrücken.
Die Verwendung von Abtönungspartikeln kann jedoch auch dazu dienen, etwas als ‚allgemein Bekanntes‘ oder als ‚Begründung‘ zu kennzeichnen. In diesen Fällen zeigen Abtönungspartikeln die Beziehungsrelevanz zwischen zwei Aussagen an und tragen damit als satzverknüpfende Elemente zur Textkonstitution bei. In textverknüpfender Funktion können Abtönungspartikeln Konjunktionen oder Subjunktionen ersetzen. Beispielsweise begegnet die Abtönungspartikel ja bei bestimmten Formen des Argumentierens (z.B. beim Argumentationstyp Fakt) als alleiniger logischer Operator, z.B.: Der Mensch ist ja kein Uhrwerk. (vs. Denn der Mensch ist kein Uhrwerk.). Auch in der ‚Begründung‘ signalisierenden Funktion werden Bedeutungsähnlichkeiten zwischen ja-Sätzen und solchen mit Konjunktionen oder Subjunktionen deutlich, z.B.: Wir hatten ja gedacht, dass … (vs. Weil wir gedacht hatten, dass …).
Auch Präpositionen können als Bindewörter innerhalb von Texten fungieren, vor allem dann, wenn sie alternativ zu Sätzen, Infinitiv- und Partizipialkonstruktionen stehen, z.B.:
Dank der hohen Verwindungssteifigkeit reagiert das moderne Fahrwerk auf die unterschiedlichsten Straßenbeschaffenheiten. (Direct Marketing-Prospekt Volvo)
Aus textlinguistischer Perspektive ist in diesem Zusammenhang u.a. relevant, welche Verknüpfungsbedeutungen solche Wörter ausdrücken. Bedeutsam für stilistische Aspekte ist hier im Allgemeinen, dass nur Sinnzusammenhänge, die durch die Beziehungen zwischen den Sachverhalten nicht hinreichend motiviert sind, durch spezielle Konnektoren gestützt werden müssen. Offensichtliche Zusammenhänge können hingegen ohne Konnektoren oder durch kopulative Konnektoren verbunden werden. Als charakteristisch für die geschriebene Sprache gilt dabei, dass inhaltliche Beziehungen zwischen den einzelnen Aussagen stärker explizit gemacht werden als im mündlichen Sprachgebrauch.
Mit dem Begriff ‚Konnexion‘ wird die Verknüpfung von Aussagen und Sätzen durch textuelle Bindewörter, sog. Konnektoren, bezeichnet. Im Vergleich zu Pronomina und Artikeln verknüpfen Konnektoren nicht, indem sie eine Suchanweisung innerhalb des Textes geben, sondern sie spezifizieren die logische Beziehung zwischen dem vorausgegangenen und dem folgenden Satz.
Bei der Aussageverknüpfung durch Konnektoren werden immer Hinweise auf die semantische Beziehung zwischen Texteinheiten gegeben. Dabei lassen sich zahlreiche Bedeutungsgruppen unterscheiden, die im Folgenden exemplarisch vorgestellt werden:8
Kopulative Konnektoren bezeichnen das Nebeneinanderstehen von Aussagen. Bei kopulativen Verknüpfungen im Text werden einer Aussage additiv weitere angefügt oder gleichberechtigte Alternativen genannt, die nebeneinander gelten oder sich ausschließen können. Als additive Konnektoren fungieren dabei einfache oder paarige Konjunktionen wie und, sowie, sowohl – als (auch), nicht nur – sondern auch, Adverbien wie außerdem, weiterhin, erstens – zweitens, Präpositionen wie einschließlich oder inklusive usw., während alternative Verknüpfungen durch Konjunktionen wie oder und beziehungsweise hergestellt werden.
Additive Konnexionsmittel können zusätzlich zur reinen Relation der Hinzufügung auch weitere Bedeutungsnuancen enthalten, wodurch das angebundene Glied in seinem Informationswert besonders hervorgehoben wird. Der Hervorhebung dienen vor allem die paarigen Vertreter der additiven Konnektoren sowie eine Vielzahl von Adverbien (z.B. auch, vor allem), die Aussagen an vorangegangene anknüpfen, z.B.:
Nicht, weil es die meisten Airbags hat, sondern weil die verschiedenen Sicherheitssysteme optimal zusammenwirken, um die Insassen zu schützen … Es unterstreicht nicht nur das fließende Coupé-Design, sondern sorgt auch für mehr Sicherheit. Auch mit offenem Dach macht das Fahrzeug es einem Dieb außergewöhnlich schwierig … (Direct Marketing-Prospekt Volvo)
Bei einer konditionalen Verknüpfung wird eine sachliche Voraussetzung mit einer sachlichen Konsequenz fest verbunden. Prototypisch für solche Bedingungsgefüge ist das Verknüpfen durch konditionale Konjunktionen (z.B. wenn, falls).
Ein Konditionalverhältnis kann jedoch auch ohne konditionale Konjunktion o.ä. auskommen und nur durch Verberststellung im bedingenden Satz ausgedrückt werden (z.B. Wird ein Unfall mit einem neueren Volvo innerhalb von 100 km um Göteborg gemeldet, werden unsere Forscher sofort vom Rettungsteam benachrichtigt …). Zudem gibt es eine Vielzahl von Umschreibungen des Bedingungsverhältnisses, die Konditionalität textuell explizit machen (z.B. Vorausgesetzt, dass (…) – Daraus folgt, dass (…)).
Auf der Interpretation einer konditionalen Beziehung basiert auch die Verwendung kausaler, konsekutiver, modal-instrumentaler und finaler Konnektoren, während adversative und konzessive Verknüpfungshinweise die umgekehrte Perspektive kennzeichnen als Gegensätze oder Einwände.
Als im engeren Sinne kausal werden Relationen bezeichnet, in denen sich eine potentielle Bedingung eines konditionalen Verhältnisses auf einen tatsächlichen Sachverhalt bezieht. Es handelt sich also um wirkliche Gründe, nicht nur mögliche oder gedachte, die zum Verständnis des Rezipienten angeführt werden. Eine kausale Bedeutung haben Subjunktionen wie weil oder da, die Konjunktion denn, Adverbien wie deswegen, daher, demgemäß, Präpositionen wie wegen, aufgrund u.v.m.
Wird ein Sachverhalt demgegenüber nicht als Ursache sondern als Folge markiert, liegt eine konsekutive Verknüpfung vor. Als konsekutive Relationshinweise kommen beispielsweise demzufolge, somit, infolgedessen oder so dass in Frage.
Modal-instrumentale Konnektoren wie die Subjunktionen indem, dadurch dass, ohne zu, die Präpositionen mittels, mithilfe von, ohne oder die Adverbien damit, dafür, dazu kennzeichnen eine Mittel-Zweck-Beziehung. Auf einer Mittel-Zweck-Relation basiert auch das finale Bedeutungsverhältnis, das die Aussage im Hinblick auf das verfolgte Ziel, das Motiv oder die angestrebte Wirkung einer Handlung anschließt (z.B. zwecks, damit, um zu, dazu).
Adversative Textverknüpfung entsteht durch das Thematisieren eines Kontrasts, also der Gegensätzlichkeit von zwei Sachverhalten. Das Vorliegen dieses Verknüpfungstyps kann durch Formen wie entgegen, indes, wohingegen, allein, vielmehr, hingegen oder aber angezeigt werden.
Konzessive Kohäsion entsteht durch die Korrektur einer Erwartungshaltung, die durch ein konditionales Verhältnis vorgegeben ist, und kann insofern als ein Sonderfall der Begründung angesehen werden, als sie einen Grund angibt, der nicht handlungsbestimmend geworden ist. Zu den Formen, die eine konzessive Relation kennzeichnen können, zählen: obwohl, trotz allem, dennoch oder abgesehen von.
Bei einer temporalen Verknüpfung werden Aussagen zueinander in eine zeitliche Beziehung gesetzt. Diese kann vorzeitig (z.B. nach, nachdem, worauf, anschließend), nachzeitig (z.B. vor, bevor, vorher, früher) oder gleichzeitig (z.B. während, wenn, seit, wann, solange) sein.
Durch spezifizierende Konnektoren können erläuternde Informationen an Aussagen angeschlossen werden, entweder explikativ, indem der vorangehende Sachverhalt durch weitere Einzelheiten näher erläutert wird (z.B. insofern (als), das heißt, nämlich, also), oder restriktiv durch die Einschränkung der Gültigkeit einer Äußerung (z.B. außer, außer dass, außer wenn, abgesehen von, es sei denn, allerdings).
Kohäsion kann schließlich hergestellt werden durch vergleichende Relationshinweise. Hierzu gehören einerseits komparative Konnektoren, die Ähnlichkeitsbeziehungen zwischen zwei Sachverhalten herstellen (z.B. genauso, ebenso, ähnlich, entsprechend), andererseits proportionale Konnektoren, die zwei Sachverhalte graduierend aufeinander beziehen (z.B. in dem Maße, wie, je – desto).
Aus textlinguistischer Perspektive sind Konnektoren also als relationsherstellende Einheiten zu verstehen, die einen metakommunikativen Status gegenüber der Vorgänger- und Nachfolgeinformation haben und somit der Steuerung des Textverständnisses dienen. In stilistischer Hinsicht ist relevant, dass für manche Konnektoren Sonderstellungen charakteristisch sind, vor allem Versetzungen von sonst syntaktisch gebundenen Ausdrücken an die Satzspitze. Dadurch können Informationen besonders auffällig hervorgehoben und die Aufmerksamkeit des Rezipienten gesteuert werden. Häufig treten derart steuernde Konnektoren deshalb in Verbindung mit bestimmten Textsorten, Textfunktionen und Textmustern auf. Ein Beispiel dafür sind Leitartikel, die durch die kommunikative Funktion ‚Meinungsbildung‘ und die ausgeprägte Verwendung argumentativer Muster gekennzeichnet sind (vgl. Kap. 3.3.2. und Kap. 4.3).
Die folgende Abbildung zeigt einen Überblick über die verschiedenen Bedeutungsgruppen der Konnektoren (vgl. Abb. 7):
Abb. 7:
Bedeutungsgruppen von Konnektoren
Tempus-, Modus- und Diathesenkonstanz
Textkohäsion entsteht auch durch Tempus, Verbmodus und Diathese, deren Zeichen an jedem finiten Verb kodiert sind. Es geht um Informationen über den zeitlichen Zusammenhang von Aussagen im Text, die subjektive Stellungnahme des Produzenten/Senders zu dem durch die Aussage bezeichneten Sachverhalt bzw. zur Wirklichkeit des Gesagten und zur Quelle der Aussage, außerdem um Alternativen in der Darstellungsweise des Geschehens, die Möglichkeit zur Umkehrung der Handlungsrollen und zur Verschweigung der handelnden Person.
In Bezug auf das Tempus gilt es als charakteristisch für eine textorientierte Perspektive, die Wahl der Tempusform nicht allein auf die zeitlichen Verhältnisse der im Text stehenden Aussagen zu beziehen, sondern auch das sog. Tempusregister zu berücksichtigen. Der Begriff des Tempusregisters geht auf Weinrich9 zurück, der zwischen den beiden Tempusregistern ‚Besprechen‘ und ‚Erzählen‘ unterscheidet: Besprechende Tempora (Präsens, Perfekt und Futur) legen dem Leser eine „gespannte“ Rezeptionshaltung nahe, während Erzählende Tempora (Präteritum und Plusquamperfekt) dem Leser zu verstehen geben, dass die Rezeptionssituation insofern „entspannt“ ist, als signalisiert wird, dass die Erzählung erst als Ganzes eine abgeschlossene Einheit bildet und Reaktionen des Lesers aufgeschoben sind. Wird über längere Textabschnitte ein Tempusregister beibehalten, bewirkt dies eine deutliche kohäsive Verknüpfung. Wird das Tempusregister gewechselt, entstehen textuelle Einschnitte, die Übergänge zwischen unterschiedlichen Textteilen – zwischen ereignisbezogener Erzählung und situationsbezogenem Diskurs – anzeigen, z.B.:
Als der Wassermann eines Tages nach Hause kam, sagte die Wassermannfrau zu ihm: „Heute musst du ganz leise sein. Wir haben nämlich einen kleinen Jungen bekommen.“
„Was du nicht sagst!“, rief der Wassermann voller Freude. „Einen richtigen kleinen Jungen?“
„Ja, einen richtigen kleinen Wassermann“, sagte die Frau.
„Aber bitte, zieh dir die Stiefel aus und sei leise, wenn du hineingehst. Ich glaube, er schläft noch.“
Da zog sich der Wassermann seine gelben Stiefel aus und ging auf den Zehenspitzen in das Haus. Das Haus war aus Schilfhalmen gebaut, es stand tief unten auf dem Grunde des Mühlenweihers. Statt mit Mörtel war es mit Schlamm verputzt; denn es war ja ein Wassermannshaus. Aber sonst war es genauso wie andere Häuser auch, nur viel kleiner. Es hatte eine Küche und eine Speisekammer, eine Wohnstube, eine Schlafstube und einen Flur. Die Fußböden waren sauber mit weißem Sand bestreut, vor den Fenstern hingen lustige grüne Vorhänge, die waren aus Algen und Schlingpflanzen gewebt. Und natürlich waren alle Stuben, der Flur und die Küche und auch die Speisekammer voll Wasser. (Otfried Preussler „Der kleine Wassermann“ 1956, S. 3f.)
Zur Textkohäsion können also sowohl die Konstanz der Tempusform als auch die des Tempusregisters beitragen, folglich werden auch die textuellen Einschnitte dann am deutlichsten markiert, wenn sowohl das Tempusregister als auch die Tempusperspektive wechseln.
Der Verbmodus stellt die zentrale Kategorie im System der Modalität dar und trägt zur Textkonstitution weniger durch seine konstante Beibehaltung, sondern eher durch seinen konsequenten Diskursbezug bei. Moduskonstanz kommt als Element zur Textverknüpfung zwar prinzipiell in Frage, ist in der Regel jedoch auf wenige Textsorten und Textfunktionen beschränkt:
Kontakte speichern
1 Geben Sie die Nummer im Startbildschirm ein, und drücken Sie Optionen > Ins Telefonbuch.
2 Geben Sie die Kontaktdetails ein, und drücken Sie auf Ja, um sie zu speichern. Tipp: Drücken Sie ■ > ■ Telefonbuch > Optionen > Telefonbucheinstellungen >Bevorzugter Speicher, um festzulegen, wo Ihre Kontakte gespeichert werden sollen (SIM oder Telefon).
(Betriebsanleitung „MOTOROLA GLEAM+ ger“ [Originalsymbole wurden durch Platzhalter ersetzt.])
Der Modus kodiert mit seinen 4 Subkategorien die Handlungsbedeutung von Aussagen. Dabei kommt der Imperativ als Befehlsform in schriftlichen Texten – abgesehen von denen mit starker Handlungsorientierung (s.o.) – immer weniger vor. Während der Indikativ in der Regel die Wirklichkeit des Gesagten festlegt, modifiziert der Konjunktiv den Wirklichkeitsbezug als potential bzw. irreal und ermöglicht deren kleinräumige Einbindung in den Text. Die Formen des Konjunktiv I ermöglichen darüber hinaus die Integration von Aussagen Dritter ohne Haftung für ihre Richtigkeit/Wahrheit.
Als Mittel der Textverknüpfung kann auch das wiederholte Auftreten von gleichen Formen der Diathese interpretiert werden. Sichtbar ist dies vor allem am gehäuften Auftreten von Passivformen, z.B. bei Nachrichtentexten:
Vor einer Schule im französischen Grenoble sind zwei Männer erschossen worden. Ein weiterer Mann wurde schwer verletzt, so Le Dauphiné Libéré am Montag unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft. (Der Standard 26. April 2016, S. 8)
Folgenreich für den Textverlauf ist vordergründig, dass Passivformen sog. „täterabgewandte“ Formen darstellen, weil sie es ermöglichen, das Agens zu verschweigen.
Beruht der Textzusammenhang auf textuellen Zeichenbeziehungen zwischen Lexemen der offenen Wortklassen (v.a. Nomina, Verben und Adjektive), liegt lexikalische Kohäsion vor. Am deutlichsten ist lexikalische Kohäsion als Mittel der Textverknüpfung, dabei an der einfachen Wiederholung von Wörtern (oder auch Wortgruppen) zu erkennen:
Über mein Studium gibt es nicht mehr zu sagen, als dass ich hinging. Von den vierzehn Semestern fielen zehn Leo zum Opfer. […] Einzig in den wenigen guten Momenten (also wenn Leo Anzeichen von ernster Zuneigung zeigte), wurde das Studium zu mehr als bloßem melancholischen Schweifen im Zitatenfundus meiner Jugend. Dann habe ich Sätze wie Dieses Horn, das man Ohrmuschel (papillon) nennt, ist für die malischen Dogon und Bambaras ein männliches Glied – und der Gehörgang eine Vagina. Das gesprochene Wort ist das zur Befruchtung unerlässliche Sperma mit dem Textmarker zum Leuchten gebracht, so wie mich der Satz zum Leuchten brachte, denn es waren so gut wie Leos Worte. Aber wenn Leo mich nach einem gemeinsamen Wochenende an der zugefrorenen Ostsee spätabends vor meinem Kerker der Einsamkeit mit einem stummen Kuss ablieferte, dann wurde mir das Denken zur Marter, das Atmen zur Qual und die Tage und Nächte ununterscheidbar finster.
(Anousch Mueller „Brandstatt“, München: Beck 2013, S. 73f. [Fettdruck zur Hervorhebung, nicht im Original])
Für die Wiederholung identischer lexikalischer Elemente begegnen in der Literatur die Begriffe ‚Repetition‘ (vgl. Halliday/Hasan 1976) und ‚Rekurrenz‘ (vgl. de Beaugrande/Dressler 1981). Wie im oben genannten Beispiel zu sehen ist, trägt die Wiederholung nominaler Referenzen zur Textverknüpfung bei,10 indem sie einen Themabeibehaltungshinweis abgibt. Im Vergleich zur Pronominalisierung ist die Repetition /Rekurrenz als Signal für die Themabeibehaltung deutlich stärker. Wenn sie allerdings in zu hoher Frequenz vorkommt, kann sie die Akzeptabilität eines Textes verringern, weil die lexikalische Wiederholung Redundanz erzeugt, was in Bezug auf die Stilwirkung im Extremfall zur Monotonie führen kann. Hinsichtlich ihrer Funktion der Wiederaufnahme steht die Repetition/Rekurrenz den Pro-Formen nahe. Sie ist denen gegenüber jedoch expliziter und stellt keine Suchanweisung dar.
Gegenüber der vollständigen Rekurrenz, bei der dasselbe Wort (dieselbe Wortgruppe) wiederholt wird, trägt die sog. „partielle Rekurrenz“ zur Textverknüpfung bei, indem ein Wortstamm mit veränderter Wortart wiederaufgenommen wird. Im folgenden Text kommt beispielsweise das Basismorphem spiegel in zweifacher Form mehrmals vor:
Spiegeln (pacen, matchen) bezeichnet den Vorgang, bei dem sich eine Person an Teile des beobachteten Verhaltens einer anderen Person angleicht. Beispielsweise indem sie bewusst – und zwar behutsam, ohne die Person nachzuäffen – die gleiche Körperhaltung einnimmt oder einen anderen Aspekt der Körpersprache aufgreift (nonverbales Spiegeln). Ebenso kann die inhaltliche Aussage oder die Sprechweise der anderen Person gespiegelt werden (= verbales Spiegeln). Auch das äußere Erscheinungsbild einer anderen Person kann gespiegelt werden. Bei Fußballspielen pacen sich die Schlachtenbummler auf vielen Ebenen. So sind die Fans eines bestimmten Vereins an gleichen Schals, Mützen, T-Shirts, Jacken und Fahnen erkennbar. Schließlich werden Merkmale der Persönlichkeit – wie der Lebensstil, Vorlieben, Überzeugungen und Werte – gespiegelt, indem zum Beispiel die gleiche politische Grundüberzeugung kundgetan wird. (Armin Reins „Corporate Language“, Mainz: Hermann Schmidt 2006, S. 120; [Fettdruck zur Hervorhebung, nicht im Original])
Wird ein Referenzausdruck bei Beibehaltung des Referenzbezugs („Ko-Referenz“) durch einen anderen ersetzt, spricht man von Substitution. Dabei erfolgt durch die Ausdrucksvariation immer auch eine Weiterentwicklung des Themas (vgl. Hausendorf/Kesselheim 2008, S. 120f.), weil die eingeführte Referenz differenziert und ausgebaut wird. Grundlegend für Substitutionen sind semantische Beziehungen im Lexikon, zu denen vor allem die Synonymie, die Antonymie und die Hyponymie zählen.
Die lexikalischen Inhaltswörter bilden ein zusammenhängendes Begriffsystem, das auf Beziehungen zwischen Lexemen und kulturellen Abstraktionen zu diesen beruht. So befindet sich fast jedes Wort im Spannungsfeld einer Klasse von Wörtern, die eine gleiche oder eine ähnliche Bedeutung ausdrücken. Wenn zwei oder mehrere Wörter die gleiche Bedeutung haben und in derselben syntaktischen Umgebung vorkommen können, liegt Synonymie vor. Als Beispiele dafür werden häufig Wörter wie Apfelsine – Orange, Fahrstuhl – Lift – Aufzug oder anfangen – beginnen genannt. Eine echte Synonymie (auch: ‚totale Synonymie‘), für die eine uneingeschränkte Austauschbarkeit der betreffenden Ausdrücke in allen denkbaren Kontexten Voraussetzung ist, tritt jedoch äußerst selten auf. Das hängt vor allem mit dem Prinzip der Sprachökonomie zusammen, das das Bestehen zweier absolut bedeutungsgleicher Ausdrücke im Lexikon hemmt.
Sehr oft unterscheiden sich Synonyme durch konnotative Merkmale, d.h. zusätzliche – meist emotional – bewertende Informationen (z.B. Hund vs. Köter, vgl. Kap. 3.2.3), sowie durch weitere stilistische Merkmale wie die Markierung von Stilebenen (z.B. sterben – abkratzen; vgl. Kap. 3.1 „Zentrale Begriffe der Stilanalyse“), regionale Markierungen (z.B. Sonnabend – Samstag) u.v.m. In solchen Fällen handelt es sich um die sog. „partielle Synonymie“, die auch dann vorliegt, wenn Lexeme nur in einigen Kontexten austauschbar sind, jedoch nicht in allen: einen Brief bekommen/erhalten vs. einen Schnupfen bekommen/*erhalten.11 Im Rahmen von Substitutionsprozessen sind kontextabhängig natürlich auch derartige partielle Synonyme dazu geeignet, zu Textverknüpfung und Themavariation bzw. Themaentwicklung beizutragen.
Durch Substitution können auch lexikalische Elemente verknüpfen, wenn diese Bestandteile von sog. „Wortfeldern“ (vgl. Kap. 3.2.3) sind. Wortfelder12 werden von Wörtern gebildet, die auf paradigmatischer Ebene bedeutungsverwandt sind. Solche Wortfelder umfassen alle Wörter, die einen bestimmten begrifflichen oder sachlichen Bereich abdecken. Sie teilen zentrale Bedeutungselemente miteinander, heben sich aber auch durch spezielle Seme13 (evtl. Oppositionsseme) und/oder stilistische Merkmale voneinander ab, z.B.: Insel, Schäre, Eiland, Hallig, Fischerinsel, Urlaubsinsel, Atoll usw.
Rentnermorde sorgen für Angst
Mallorca eine Mafiainsel?
Palma de Mallorca. Nach dem zweiten tödlichen Raubüberfall auf ausländische Rentner binnen weniger Monate wächst auf der Ferieninsel Mallorca die Angst unter den europäischen Residenten. Zum Jahresbeginn war ein 77-jähriger Schweizer Pensionär an den Folgen seiner schweren Verletzungen gestorben, die er bei einem brutalen Überfall erlitten hatte. Vieles deutet darauf hin, dass dieselben skrupellosen Täter dahinterstehen, die vier Monate zuvor im Inselosten einen deutschen Rentner überfielen und töteten.
Mallorca werde zunehmend „ein Paradies für die Mafia“ warnte die Zeitung „Diaro de Mallorca“. Die Insel habe sich in ein „Rückzugsgebiet für das internationale Verbrechen verwandelt“. Die Tourismusbranche sorgt sich, dass derartige Gewaltverbrechen das Image der berühmten Insel beschädigen könnten. Im vergangenen Jahr verbrachten rund neun Millionen ausländische Touristen ihre Ferien auf der spanischen Urlaubsinsel. Zudem leben mehr als 100000 Ausländer fest auf dem Eiland, davon allein 30000 Deutsche […]. (Ostthüringer Zeitung 22.01.2014 [Fettdruck zur Hervorhebung, nicht im Original])
Satzübergreifende lexikalische Beziehungen können auch durch Wortschatzelemente hergestellt werden, die in antonymischer Relation zueinander stehen. Antonyme sind Wörter, die durch die semantische Relation des Bedeutungsgegensatzes verbunden sind. Dabei können zwei Formen voneinander unterschieden werden: Die kontradiktorische oder komplementäre Antonymie, die etwa bei zwei Zuständen vorliegt, die sich gegenseitig ausschließen (z.B. lebend – tot). Um konträre Antonyme handelt es sich demgegenüber bei den Extrempunkten einer Skala, zwischen denen Übergangszustände denkbar sind (z.B. heiß – kalt).
Als Spezialform antonymischer Relation werden mitunter auch Wörter gefasst (vgl. z.B. Schubert 2008, S. 48f.), die unterschiedliche Perspektiven auf ein Ereignis bezeichnen (sog. „konverse Antonymie“ z.B. kaufen – verkaufen) oder räumliche Bewegungen in verschiedene Richtungen verbalisieren (sog. „direktionale Antonymie“ z.B. vorwärts – rückwärts).
Durch Substitution verknüpfen vor allem auch Ausdrücke, bei denen eine Relation der Unter- oder Überordnung vorliegt. Dieses semantische Verhältnis zwischen einem Oberbegriff mit weiter Bedeutung (Hyperonym, z.B. Obst) und einem Unterbegriff (Hyponym, z.B. Apfel) wird als Hyponymie bezeichnet. Verschiedene Unterbegriffe, die gemeinsam zu einem Oberbegriff gehören werden Kohyponyme genannt (z.B. Apfel, Birne, Kirsche, Pflaume). Dabei unterscheidet sich jedes Hyponym durch mindestens ein spezifizierendes Merkmal von seinem Hyperonym.
Mit solchen Formen inhaltlicher Spezifizierung geht neben der Ausdrucksvariation natürlich immer die Weiterentwicklung des Themas einher, etwa durch ein Fortschreiten vom Speziellen zum Allgemeinen. Als besonders allgemeine Hyperonyme gelten in diesem Zusammenhang Lexeme wie Person, Mensch, Ding, Zeug, die innerhalb von Texten kohäsive Verbindungen mit unzähligen anderen Personen- und Sachbezeichnungen eingehen können.
Auf Teil-Ganzes-Beziehungen bezieht sich der Begriff der Meronymie, wobei das Lexem, das das Ganze benennt, als ‚Holonym‘ (z.B. Baum), das Wort für den entsprechenden Teil als ‚Meronym‘ (z.B. Ast, Stamm) bezeichnet wird. Meronymische Relationen bestehen typischerweise zwischen Wörtern mit gegenständlicher Bedeutung (sog. ‚Konkreta‘). Sie begegnen in Texten häufig bei Raumbeschreibungen und in Verbindung mit bestimmten Formen der thematischen Progression (s.u. „Progression mit abgeleitetem Thema“).