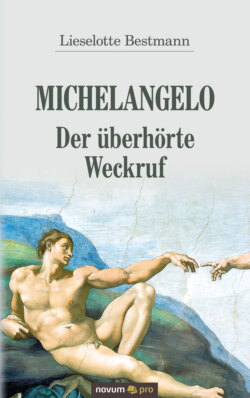Читать книгу Michelangelo – Der überhörte Weckruf - Lieselotte Bestmann - Страница 10
ОглавлениеRückkehr nach Florenz – Michelangelos David
Die Pietà begründete zwar den Ruhm Michelangelos, doch er blieb nicht in Rom, sondern folgte dem Ruf von Freunden nach Florenz. Dort lag seit langem ein als „verhauen“ geltender großer Marmorblock im Hof der Dombauhütte, der vergeben werden sollte. Michelangelo überzeugte mit seiner Zusage, aus diesem eine Statue aus einem Stück zu fertigen und erhielt den Block. Als Werkstatt und zugleich Schlafplatz diente ihm ein abgetrennter Raum in der Dombauhütte. Er schuf aus diesem „verhauenen Block“ seinen David.10 Sowohl Donatello11 als auch Verrocchio12 hatten ihren Bronze-David dargestellt als zartgliedrigen Jüngling, nach vollbrachter Tat, das Schwert in der Hand und das abgeschlagene Haupt des Riesen zu Füßen. Michelangelos David dagegen ähnelt mit seinen breiten Schultern und der athletischen Figur eher einem Herkules und dargestellt ist der Moment vor der Tat. Die Schleuder bereit zum Einsatz blickt er mit in Falten gezogener Stirn konzentriert und furchtlos auf den sich nahenden Gegner.
Im Winter 1503/1504 war sein David vollendet und wurde durch Beschluss einer aus den vornehmsten Künstlern von Florenz bestehenden Kommission nicht in der Nähe des Doms, sondern vor dem Palazzo della Signoria (heute Palazzo Vecchio) aufgestellt. Dieser Standortwechsel beinhaltet sowohl einen Bedeutungswechsel der Statue von der biblischen hin zur politischen Inanspruchnahme als auch der Demonstration von ständiger Bereitschaft und unter göttlichem Schutz stehender Kraft.
Nach Vollendung seines David folgte auf Bitten seines Freundes Soderini ein heute verlorener Bronze-David, der dem David Donatellos nachempfunden sein sollte, und als Geschenk nach Frankreich ging. Im gleichen Zeitraum entstand im Auftrag der flandrischen Kaufmannsfamilie Moscheroni der Bronzeguss einer Madonna mit Kind, der nach Fertigstellung nach Flandern geschickt wurde, sowie im Auftrag von Angelo Doni, eines angesehenen florentiner Bürgers, das sogenannte Doni-Tondo, das Michelangelo malte, um – wie Condivi erwähnt – die Malerei nicht ganz aufzugeben.13
Nach Condivi folgte dann eine Zeit, in der Michelangelo „fast nichts in seiner Kunst hervorbrachte, in der er sich damit beschäftigte, die heimatlichen Dichter und Redner zu lesen und Sonette zu seinem Vergnügen zu machen, …“14
Vor dem Hintergrund der weiteren Entwicklung Michelangelos gewinnt diese Bemerkung Condivis besondere Bedeutung, lässt sie doch erkennen, dass Michelangelo bereits zu diesem frühen Zeitpunkt sich intensiv und aus eigenem Antrieb mit dem Verfassen von Gedichten beschäftigte. Michelangelo schuf in seinem langen Leben eine Vielzahl von Gedichten, in die seine Gedanken einflossen und die uns heute behilflich sein können, uns dem Verständnis seiner Bildwerke zu nähern. Zu Lebzeiten Michelangelos und auch in den folgenden Jahrhunderten fanden seine Verse nur wenig Anklang. Sie entsprachen nicht dem Zeitgeschmack. Und doch hatte – wie bereits eingangs erwähnt – schon der bedeutende zeitgenössische Dichter Francesco Berni von Michelangelos Dichtungen gesagt: „Ihr sagt nur Worte, aber er sagt Dinge.“15
Michelangelo fühlte sich seit seiner frühesten Jugendzeit magisch angezogen von den in Florenz so reichlich anzutreffenden Bildwerken seiner Vorgänger. Er kannte sie alle, liebte vor allem die östliche Bronzetür des Baptisteriums, heute allgemein als „Paradiestür“ bezeichnet, weil Michelangelo nach Überlieferung Vasaris gesagt haben soll, sie sei so schön, dass sie an den Pforten des Paradieses stehen könnte.16 Er kannte seit seinem Aufenthalt in Bologna die Reliefs des Eingangsportals von San Petronio und vor allem – er kannte seine Bibel – sie war für ihn das Buch der Bücher, die Grundlage aller ihn so begeisternden Bildwerke der Vergangenheit und fast aller der von ihm selbst während seines langen Lebens geschaffenen Werke.
10 Herbert Alexander Stützer, Die Italienische Renaissance, Abb. S. 207.
11 Herbert Alexander Stützer, Die Italienische Renaissance, Abb. S. 79.
12 Herbert Alexander Stützer, Die Italienische Renaissance, Abb. S. 93.
13 Ascanio Condivi XXII., Dt. Übersetzung R.Diehl, S. 32.
14 Ebda., S. 33.
15 Zitiert nach Michael Engelhard, Michelangelo, Gedichte, Insel Verlag, Ausg. 1999, S. 376.
16 Stützer, Die Italienische Renaissance, S. 72.