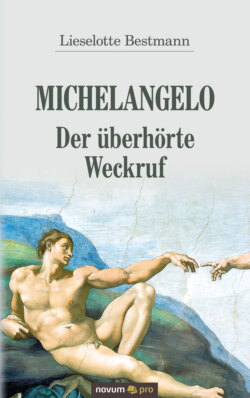Читать книгу Michelangelo – Der überhörte Weckruf - Lieselotte Bestmann - Страница 13
ОглавлениеDie Bronzestatue Julius II. in Bologna, San Petronio
Dieser Auftrag ließ nicht lange auf sich warten und lautete über eine große Bronzestatue von ihm in seiner Funktion als Papst, die ihre Aufstellung über dem Portal von San Petronio finden sollte. Michelangelo fertigte ein Tonmodell an, das den Papst thronend darstellte mit zum Segen erhobener rechter Hand. Auf Michelangelos Vorschlag, in die linke ein Buch zu legen, soll der Papst geantwortet haben „Was Buch! – Ein Schwert! Ich bin doch kein Gelehrter.“28 Dass Michelangelo die Bibel gemeint haben könnte, die Bibel, die für ihn persönlich das Buch der Bücher bedeutete, auf diese Idee schien der Nachfolger Jesu auf dem Stuhl Petri nicht gekommen zu sein. Er wählte spontan das Schwert. Auf die scherzende Frage des Papstes „Diese deine Statue, erteilt sie Segen oder Fluch?“ antwortete Michelangelo lächelnd: „Heiliger Vater, sie bedroht dieses Volk, wenn es nicht ruhig ist.“29
Diese überlieferten Wortwechsel zeigen zunächst, wie demütig Michelangelo sich beim Papst für sein vom Zorn bestimmtes Verhalten entschuldigte und wie berührt der Papst ihn anhörte. Doch dann wies dieser Papst, ebenfalls von Zorn überwältigt, den um Verteidigung Michelangelos bemühten Bischof auf äußerst schroffe Weise in seine Schranken zurück. Von der Geschichtsschreibung wird sowohl Michelangelo als auch Julius II. eine ausgesprochene und durchaus vergleichbare terribilità zugeschrieben.
Bemerkenswert ist die Antwort Michelangelos auf die Frage des Papstes, ob die rechte Hand der geplanten Statue zum Segen oder Fluch erhoben sei. Äußerst geschickt weicht Michelangelo einer direkten Entscheidung hierüber aus mit seiner Formulierung „Heiliger Vater, sie bedroht dieses Volk, wenn es nicht ruhig ist.“ Die rechte Hand drohend erhoben und in der linken auf Wunsch des Papstes statt der Bibel das Schwert würde diese Statue eindeutig die Kampfbereitschaft des Papstes signalisieren.
Italien war zu dieser Zeit nicht nur von ständigen Kämpfen der Stadtstaaten untereinander, sondern ebenso von den mit Waffengewalt durchgesetzten Machtansprüchen des Papsttums erschüttert. Hinzu kamen die Bedrohungen von außen, nicht zuletzt durch die immer weiter vordringenden Türken und damit des Islam. Michelangelo hat seine Gedanken zur Haltung des Papsttums der damaligen Zeit in seinem Gedicht Qua si fa elmi di calici e spade unmissverständlich zum Ausdruck gebracht:
Aus Kelchen läßt man Helm und Schwert hier schweißen;
Und Christi Blut ist’s, das die Kassen füllt,
Aus Kreuz und Dornen werden Speer und Schild,
Selbst Christus würde die Geduld hier reißen.
Doch herzukommen sollt‘ Er sich verbeißen,
Weil hier Sein Blut mehr als die Sterne gilt
Und Haut und Haar nicht Romas Habgier stillt -
Hier trifft Er nicht das Heil, das Er verheißen.
Käm je mich Lust an, Schätze zu verlieren,
Weil Werk und Wirkung mählich von mir weichen,
Tät der im Mantel, was Medusa tat.
Doch kann nur Armut in den Himmel führen,
Was wird aus uns, wenn dieses andere Zeichen
Das andere Leben schon zu Boden trat?
Übersetzung M. Engelhard30
Michelangelo unterzeichnete dieses Gedicht mit den Worten „Finis, Euer Michelagniolo in der Türkei.“ Während seines Aufenthaltes in Florenz vor der durch den Papst erzwungenen Abreise nach Bologna soll Michelangelo aus der Türkei der Bau einer Brücke von Konstantinopel nach Pera angeboten worden sein. Sein Freund Piero Soderini, Gonfaloniere der Republik Florenz, hatte Michelangelo von diesem Vorhaben entschieden abgeraten und zur Reise nach Bologna und damit zum Papst bewegt.31 Eine Zuordnung des Gedichtes in diesen Zeitraum liegt daher nahe.
Die beiden ersten Strophen dieses Gedichtes lassen die tiefe Erschütterung Michelangelos über die Entartung des Papsttums erkennen. In Strophe drei kommt seine Überzeugung zum Ausdruck, dass – sollte ihn je der Wunsch ankommen, auf Schätze zu verzichten, weil sein Werk und seine Wirkung von ihm gewichen seien – der Papst32 ihn sicherlich „mit Medusenblick zu Stein werden lassen würde“. In Strophe vier folgt dann sein persönliches Armutsbekenntnis, dem er bis an sein Lebensende treu blieb.
Michelangelo benötigte für die Vollendung und Aufstellung der Bronzestatue des Papstes sechzehn Monate und begab sich, nach kurzem Aufenthalt in Florenz, wieder dem Rufe des Papstes folgend, nach Rom.
Das Standbild Julius II., das von über dreifacher Lebensgröße gewesen sein soll, wurde drei Jahre später, nach der Rückkehr der Bentivoglio nach Bologna „von der Volkswut herabgeworfen und zerstört.“33
28 Condivi XXXII., S. 41.
29 Ebda.
30 Michael Engelhard, Michelangelo, Gedichte, 10, S. 17 f.
31 Condivi XXX., S. 39.
32 Engelhard, Anm. 10, S. 403. Schon Engelhard vermutet in „Der im Mantel“ Papst Julius II. Der von ihm angenommenen späten Datierung auf 1512 kann hier nicht gefolgt werden.
33 Condivi XXXII., S. 41.