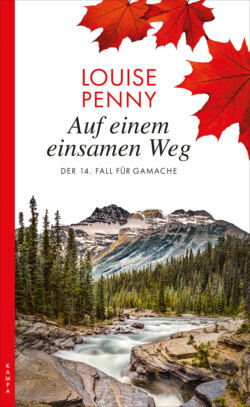Читать книгу Auf einem einsamen Weg - Louise Penny - Страница 10
8
Оглавление»Armand, bist du wach?«
»Hmmmmm.«
Er drehte sich zu Reine-Marie. Die Luft war kühl, aber unter der Daunendecke war es warm. Er tastete nach ihrer Hand.
Sie hatten ihre Matratzen in die Küche heruntergeschleppt und ihr Lager neben dem Holzofen aufgeschlagen. Damit sie nachts aufstehen und Holz nachlegen konnten.
»Ich hatte den Eindruck, du freust dich, als Myrna gesagt hat, dass der Schneesturm in ganz Québec tobt.«
»Ich war erleichtert«, gab er zu.
»Warum?«
Das war schon schwieriger zu erklären, dachte er.
Henri und Gracie, die zusammengerollt neben ihnen auf dem Boden lagen, hoben kurz den Kopf und schliefen unter dem beruhigenden Tätscheln von Armand und Reine-Marie gleich wieder ein.
»Ich hätte gestern Nachmittag zu einer Besprechung in die Akademie gemusst«, flüsterte Armand. »Sie sollten nichts unternehmen, bevor ich da bin. Dann setzte der Sturm ein, und die Telefonverbindung war unterbrochen, und ich hatte Angst, dass sie ohne mich weitermachen. Aber solange der Schneesturm tobte, konnte nichts passieren. Sie waren genauso eingeschneit.«
Und er konnte sich entspannen. Weil er wusste, dass die Welt in den nächsten Stunden auf Eis gelegt war. Stillstand.
Bei dem hektischen Tempo des täglichen Lebens hatte es etwas zutiefst Friedliches, nichts tun zu können. Kein Internet, kein Telefon, kein Fernsehen. Kein Licht.
Das Leben war auf das Wesentliche reduziert: Wärme. Wasser. Essen. Gemeinschaft.
Armand kroch aus dem Bett und begann sofort zu frösteln, als die Daunendecke von ihm glitt und ihn die kalte Luft traf.
Er stieg über die zweite Matratze auf dem Küchenboden und legte ein paar Scheite nach.
Dann stand er eine Weile am Fenster und blickte hinaus in die Dunkelheit, bevor er sich nach unten beugte und die Daunendecke um Reine-Marie feststopfte.
In diesem Moment drang aus der Dunkelheit eine Stimme an sein Ohr, scharf und unerwartet.
Am Abend zuvor hatten die nicht Eingeschneiten die Eingeschneiten ausgegraben und Pfade von den Häusern zur Straße freigeschaufelt.
Gabri und Olivier hatten die Einladung der Gamaches, danach zu ihnen zu kommen, ausgeschlagen.
»Das Bistro soll geöffnet bleiben«, erklärte Olivier.
»Außerdem haben wir unerwartet Gäste in der Pension«, rief Gabri in den heulenden Wind. »Sie sitzen wegen des Schnees fest.«
»Sie finden ihre Autos nicht.« Olivier zeigte mit seiner Schaufel auf die weißen Hünengräber rings um den Dorfanger.
»Meinst du, wir könnten ein paar Kinder dazu bringen? Ihnen weismachen, dass es ein Spiel ist?«, brüllte Gabri in Oliviers Strickmütze. »Wer als Erster ein Auto ausgräbt, kriegt einen Preis?«
»Zum Beispiel ein Hirn?«, erwiderte Olivier.
Sie hatten einen Pfad zu Ruths Haus freigeschaufelt, und Reine-Marie hatte geklopft, aber die alte Frau hatte sich geweigert aufzumachen.
»Komm zum Essen rüber zu uns«, rief Reine-Marie durch die geschlossene Tür. »Bring Rosa mit. Wir haben genug zu essen da.«
»Und zu trinken?«
»Auch.«
»Nein, ich will nicht raus.«
»Ruth, bitte. Du solltest nicht allein sein. Komm rüber. Wir haben Scotch.«
»Ich weiß nicht. Die letzte Flasche hat komisch geschmeckt.«
Reine-Marie hörte in ihrer Stimme Angst mitschwingen. Eine alte Frau, die ihr Haus verließ, um sich in einen Schneesturm zu wagen. Dagegen musste sich jeder Selbsterhaltungstrieb sträuben. Und auch wenn Ruth Zardos Selbsterhaltungstrieb nicht besonders stark ausgeprägt war, hatte sie es doch geschafft, sich bis in ihre Achtziger ans Leben zu klammern.
Und zwar nicht, indem sie bei Schneestürmen draußen herumwanderte.
Im Lauf des Abends waren sie einer nach dem anderen zu Ruths Haus gegangen und hatten den frisch gefallenen Schnee weggeschippt. Und einer nach dem anderen waren sie abgeblitzt.
»Gut, jetzt reicht es«, sagte Armand und stand auf.
Auf dem Weg zur Tür griff er nach einer Hudson’s-Bay-Company-Decke.
»Was hast du vor?«, fragte Reine-Marie.
»Ich schaffe Ruth hierher, und wenn ich dazu ihre Tür eintreten muss.«
»Willst du sie kidnappen?«, fragte Myrna.
»Verstößt das nicht gegen das Gesetz?«, fragte Reine-Marie.
»Ja«, sagte Mercier, der keinen Sinn für Sarkasmus hatte. »Wer ist diese Ruth? Warum ist sie so wichtig?«
»Sie ist ein Mensch«, sagte Armand, der inzwischen Anorak und Stiefel angezogen hatte.
»Meint er das ernst?«, flüsterte Myrna Reine-Marie zu.
»Du weißt schon, dass niemand Lösegeld zahlt, wenn du sie kidnappst«, sagte Reine-Marie. »Und dann haben wir sie am Hals.«
»Ruth ist gar nicht so übel«, sagte Myrna. »Was mir Sorgen macht, ist die Ente.«
»Ente?«, fragte Mercier.
»Ich komme mit, Sir«, sagte Benedict.
»Glauben Sie, ich werde allein nicht mit ihr fertig?«, fragte Armand mit einer gewissen Belustigung.
»Mit ihr schon«, erwiderte Benedict. »Aber mit der Ente?«
Armand sah ihn an, dann lachte er. Anders als Mercier hatte Benedict es mühelos geschafft, sich in die Unterhaltung einzuklinken. Er begriff, was Geplänkel war und was nicht.
Benedict zog Stiefel, Anorak, Mütze und Handschuhe an, und Gamache öffnete die Tür. Um gleich darauf überrascht einen Schritt zurückzuweichen.
Vor der Tür stand die halb eingeschneite Ruth. Ihr dicker Wintermantel hatte eine Beule und bewegte sich.
»Ich hab gehört, hier gibt’s Scotch«, sagte sie und ging an ihnen vorbei, als wäre sie die Hausherrin und die anderen die Gäste.
Im Gehen ließ sie Mütze, Handschuhe und Mantel auf den Boden fallen. Und hinterließ mit ihren riesigen Stiefeln kleine Pfützen.
»Wer ist das denn?« Ruth deutete mit Rosa auf Mercier und Benedict.
Reine-Marie stellte sie vor. »Sie trinken keinen Scotch«, erklärte sie in der zutreffenden Annahme, dass es das Einzige war, was Ruth wirklich interessierte.
Auf dem Esstisch im Wohnzimmer war ein Büfett mit Brot, Käse, kaltem Huhn, Roastbeef und Pasteten aufgebaut, dazwischen standen Sturmlaternen und Kerzen.
»Sagt dir der Name Bertha Baumgartner etwas?«, fragte Armand, als er Ruth einen Teller mit Essen brachte, den er für sie zusammengestellt hatte, und sich neben sie auf das Sofa setzte.
»Nein«, sagte Ruth.
Myrna trat kurz vom Büfett weg, um Armand ins Ohr zu flüstern: »Sofern es sich nicht um Johnnie Walker oder Glenfiddich handelt, interessiert es sie nicht. Pass gut auf.«
Sie ging zurück zum Büfett, legte eine Hähnchenkeule, ein Stück Camembert und ein Stück Baguette auf ihren Teller und sagte: »Bertha Baumgartner? Olivier hat gerade eine Kiste reinbekommen. Fünfundzwanzig Jahre alt. Im Eichenfass gereift. Unglaublich weich.«
»Bertha Baumgartner ist was zu trinken?«, beteiligte Ruth sich wieder an der Unterhaltung.
»Nein, du alte Schnapsdrossel«, sagte Myrna. »Wir wollten deine geschätzte Aufmerksamkeit, sei es auch nur für ein paar Sekunden.«
»Du bist eine grausame Frau«, sagte Ruth.
»Wir sind ihre Testamentsvollstrecker«, sagte Armand. »Allerdings kennen wir sie nicht. Sie hat hier in der Gegend gewohnt.«
»In einem alten Farmhaus in Richtung Mansonville«, sagte Myrna.
»Bertha Baumgartner? Sagt mir nichts«, erklärte Ruth. »Sind Sie der Notar?«
»Ich?«, fragte Benedict zurück, den Mund voll Brot. Schon wieder.
»Nein, nicht Sie.« Ruth beäugte ihn. Und seine Frisur. »Wie ich sehe, hat Gabri als Dorfdepp Konkurrenz bekommen. Ich hab den da gemeint.«
»Mich?«, fragte Mercier.
»Ja, Sie. Ich kannte mal einen Laurence Mercier. Er kam zu mir, um mein Testament zu besprechen. Ihr Vater?«
»Ja.«
»Die Ähnlichkeit ist unverkennbar«, sagte sie. Es klang nicht wie ein Kompliment.
»Du hast ein Testament gemacht?«, fragte Reine-Marie und ging mit ihrem Teller zurück zu ihrem Platz neben dem Kamin.
»Nein«, sagte Ruth. »Ich habe mich dagegen entschieden. Hab nichts zu hinterlassen. Aber ich habe ein paar Anweisungen für meine Beerdigung notiert. Blumen. Musik. Die Parade. Huldigungen von Würdenträgern. Die Gestaltung der Briefmarke. Das Übliche halt.«
»Datum?«, fragte Myrna.
»Nur zur Information, vielleicht sterbe ich gar nicht«, sagte Ruth.
»Es sei denn, wir besorgen uns einen Holzpfahl oder eine silberne Gewehrkugel.«
»Nichts als Gerüchte.« Ruth wandte sich Armand zu. »Diese Bertha hat euch also zu ihren Testamentsvollstreckern ernannt, und ihr habt sie nicht mal gekannt. Muss ganz schön plemplem gewesen sein. Schade, dass ich sie nicht kennengelernt habe.«
»Sie wäre nicht die Erste, die seltsame Dinge in ihr Testament geschrieben hat«, sagte Reine-Marie. »Gab’s da nicht was in dem von Shakespeare?«
»Ja«, sagte Mercier, endlich auf vertrautem Terrain. »Es war ziemlich normal bis auf den Schluss, wo er schrieb: ›Meiner Frau vermache ich mein zweitbestes Bett.‹«
Das löste Gelächter aus, gefolgt von Schweigen, als sie zu enträtseln versuchten, was das bedeutete, wie gelehrte Köpfe es schon seit Jahrhunderten taten.
»Was ist mit Howard Hughes?«, sagte Myrna. »Ist der nicht ohne Testament gestorben?«
»Ja, aber der war wirklich irre«, sagte Ruth.
»Mein Lieblingszitat von Hughes ist: ›Ich bin kein paranoider, gestörter Millionär, verdammt noch mal, ich bin Milliardär!‹«, sagte Reine-Marie.
»So kennt man ihn«, sagte Ruth.
»Sein Nachlass wurde schließlich irgendwann geregelt«, sagte Mercier.
»Ja«, sagte Ruth. »Ungefähr dreißig Jahre später.«
»Heilige Scheiße«, sagte Benedict und drehte sich zu Armand. »Hoffentlich dauert es bei uns nicht auch so lange.«
»Na ja, bei mir wahrscheinlich nicht«, erwiderte Armand, rasch nachrechnend.
Als es im Zimmer kälter wurde, rückten sie näher ans Feuer und hörten zu, wie Lucien Mercier von einem Mann erzählte, der jedem Kind, das zu seiner Beerdigung kam, einen Penny vermacht hatte, und von Ehemännern, die ihre Frauen und Kinder noch aus dem Grab heraus bestraften.
»›Deine Eltern machen dich kaputt. / Sie tun’s, obwohl sie’s nicht so meinen‹«, zitierte Ruth.
»Das Gedicht kenne ich«, sagte Benedict und alle Augen richteten sich auf ihn. »Aber es geht anders.«
»Ach wirklich?«, sagte Ruth. »Sind Sie Lyrikexperte?«
»Nein, gar nicht. Aber das kenne ich«, sagte er. Vielleicht nahm er den Sarkasmus nicht wahr, zumindest war er unempfindlich dagegen. Eine nützliche Eigenschaft, dachte Armand.
»Wie heißt es denn Ihrer Meinung nach?«, fragte Reine-Marie.
»Deine Eltern bringen dich ins Bett«, sagte der junge Mann auf, ohne nachdenken zu müssen. »Und lesen dir Geschichten vor.«
Rings um den Kamin gingen Augenbrauen in die Höhe.
»›Sie füllen in dich ihren Schrott‹«, sagte Ruth und fixierte Benedict wie ein Duellant, »›Und geben dir noch extra einen.‹«
»Immer sind sie lieb und nett«, erwiderte er, »Und schützen dich vor der Gefahr.«
Ruth bedachte ihn mit einem finsteren Blick. Während alle anderen die beiden verblüfft anstarrten.
»Weiter«, sagte Reine-Marie.
Ruth folgte der Aufforderung.
»›Der Mensch vererbt sein Elend weiter.
Es schreitet ungebremst voran.
Denk dran, beizeiten auszusteigen,
Und schaff dir keine Kinder an.‹«
Die Augen richteten sich wieder auf Benedict.
»Der Mensch vererbt sein Glück gern weiter.
Es schreitet ungebremst voran.
Drum ehre deine Eltern und sei heiter
Und schaff dir liebe Kinder an.«
»Will der uns verscheißern?«, fragte Ruth, bevor sie sich wieder ihrem Scotch zuwandte.
Im Kamin knisterte das Feuer, draußen heulte der Wind, und der Schneesturm nahm wieder an Stärke zu, sperrte alle in den Häusern ein.
Und Armand dachte, dass das wirklich eine gute Frage war.
Wollte Benedict das?
Sie hatten beschlossen, dass Mercier, Myrna und Benedict bei ihnen übernachten würden, außerdem auch Ruth. Sie und Rosa wurden auf die Matratze verfrachtet, die dem Holzofen am nächsten lag.
In den frühen Morgenstunden, nachdem Armand das Feuer geschürt hatte, beugte er sich nach unten und stopfte die Daunendecke um Reine-Marie fest.
Der Mensch vererbt sein Glück gern weiter.
Es schreitet ungebremst voran.
Seltsamerweise rief ihm Benedicts Version des Gedichts wieder die ursprüngliche Fassung ins Gedächtnis.
Dann hörte er, wie sich auf der zweiten Matratze etwas regte. Und aus der Dunkelheit drang eine Stimme an sein Ohr.
»Ich glaube, ich weiß, wer Bertha Baumgartner war«, sagte Ruth.