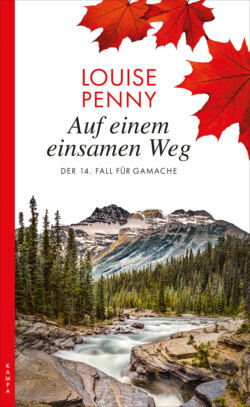Читать книгу Auf einem einsamen Weg - Louise Penny - Страница 13
11
Оглавление»Also, was ist das Problem?«
»Wie kommen Sie darauf, dass es ein Problem gibt?«, fragte Armand.
»Sie essen Ihr … Éclair nicht.«
Jedes ihrer Worte war sorgfältig artikuliert, wenngleich sie noch etwas gedämpft klangen, als wären sie in zu viel Sorgfalt und Watte gehüllt.
Die Bewegung, mit der ihre Hand das Gebäckstück an ihren Mund führte, war ebenso bedacht. Vorsichtig. Konzentriert. Langsam.
Gamache besuchte Isabelle Lacoste mindestens einmal wöchentlich in ihrer Wohnung in Montréal. Bei gutem Wetter machten sie einen kurzen Spaziergang, aber meistens saßen sie so wie heute in der Küche und unterhielten sich. Er hatte sich angewöhnt, die aktuellen Ereignisse mit ihr zu besprechen. Sich ihre Einschätzung anzuhören. Ihre Meinung und ihren Rat.
Sie war eine seiner erfahrensten Mitarbeiterinnen.
Auch heute, wie bei jedem Besuch, suchte er nach einem Hinweis auf Fortschritte. Echte Fortschritte waren am besten, aber er wäre auch schon mit eingebildeten zufrieden. Vielleicht waren die Hände ruhiger, dachte er. Die Worte klarer. Der Wortschatz umfangreicher.
Ja. Zweifellos. Vielleicht.
»Geht’s um die interne Ermittlung?«, fragte sie und biss von dem Mille-feuille ab, das Armand ihr aus Sarahs Bäckerei mitgebracht hatte, weil er wusste, dass es ihr Lieblingsgebäck war.
»Nein. Die ist fast abgeschlossen.«
»Trotzdem, die lassen sich ganz schön Zeit. Warum eigentlich?«
»Wir beide wissen, warum«, sagte er.
»Ja. Die Drogen. Nichts weiter?«
Sie betrachtete ihn. Suchte nach einem Hinweis auf Fortschritte. Einen Grund zur Hoffnung, dass das alles bald vorbei wäre.
Der Chef sah entspannt aus. Zuversichtlich. Aber das war fast immer so. Was ihr Sorgen machte, war das, was er verbarg.
Isabelle runzelte nachdenklich die Stirn.
»Ich strenge Sie zu sehr an«, sagte er und machte Anstalten aufzustehen. »Tut mir leid.«
»Nein, nein, bitte.« Mit einer Geste forderte sie ihn auf, sitzen zu bleiben. »Mir fehlt … Anregung. Wegen des Sturms haben die Kinder keine Schule, und sie haben beschlossen, dass ich lernen muss, bis … hundert zu zählen. Den ganzen Vormittag haben wir das gemacht, bis ich sie raus ins Freie geschickt habe. Ich habe ihnen erklärt, dass ich zählen kann. Schon seit … Monaten, aber sie haben trotzdem darauf bestanden.« Sie sah Armand in die Augen. »Hilfe.«
Sie sagte es in einem übertrieben jämmerlichen Ton, scherzhaft gemeint. Dennoch zerriss es ihm das Herz.
»Das war nur Spaß, patron«, sagte sie, seine Besorgnis mehr ahnend als sehend. »Noch Kaffee?«
»Bitte.«
Er folgte ihr zur Küchentheke. Ihr Gang war langsam. Zögernd. Bedächtig. Und so viel besser, als irgendjemand, einschließlich der Ärzte, zu hoffen gewagt hatte.
Isabelles Sohn und Tochter waren draußen und bauten eine Schneeburg mit den Nachbarskindern. Armand und Isabelle konnten sie durchs Fenster kreischen hören, als eine »Armee« die Verteidiger der Burg angriff.
Sie spielten dieselben Spiele, die Armand als Kind gespielt hatte. Dieselben Spiele, die fünfundzwanzig Jahre später Isabelle gespielt hatte. Spiele, in denen es um Herrschaft und Krieg ging.
»Hoffen wir, dass sie nie erleben … wie … es wirklich ist«, sagte Isabelle, als sie neben ihrem Chef und Mentor am Fenster stand.
Er nickte.
Die Explosionen. Das Chaos. Der beißende Gestank von Pulverdampf. Der blind machende Staub, als Putz und Mörtel und Ziegel zerstoben. Einem die Luft nahmen.
Die Schreie. Die einem die Luft nahmen.
Der Schmerz.
Er umklammerte die Küchentheke, als es über ihm zusammenschlug. Ihn mitriss. Hochschleuderte und herumwirbelte. Ertrinken ließ.
»Zittert Ihre Hand noch?«, fragte sie leise.
Er riss sich zusammen und nickte.
»Manchmal. Wenn ich müde bin oder besonders angestrengt. Aber nicht mehr so schlimm wie früher.«
»Und das Humpeln?«
»Meistens auch nur, wenn ich müde bin. Ich merke es kaum noch. Es ist Jahre her.« Im Gegensatz zu Isabelles Verletzungen, die erst ein paar Monate alt waren. Er wunderte sich darüber. Es schien gleichzeitig eine Ewigkeit her und gestern gewesen zu sein.
»Denken Sie noch daran?«, fragte sie.
»Was passiert ist, als Sie verletzt wurden?«
Er drehte den Kopf und sah sie an. Dieses Gesicht, ein vertrauter Anblick über so viele Leichen hinweg. So viele Schreibtische, Konferenztische. So viele hastig in Kellern, Scheunen und Blockhütten quer durch Québec eingerichtete Einsatzzentralen. Wenn sie in Mordfällen ermittelt hatten. Isabelle. Jean-Guy. Er.
Isabelle Lacoste war als junge Polizistin zu ihm gekommen, gerade mal fünfundzwanzig. In ihrer eigenen Abteilung wollte man sie nicht, weil sie nicht brutal genug war, nicht zynisch und nachgiebig genug, um das Richtige zu erkennen und das Falsche zu tun.
Er war damals der Leiter der Mordkommission gewesen und hatte sie in seine Abteilung geholt, die prestigeträchtigste innerhalb der Sûreté du Québec. Zum Erstaunen ihrer ehemaligen Kollegen.
Und Isabelle hatte sich durch die Ränge hochgearbeitet und schließlich Gamaches Nachfolge übernommen, als er zuerst die Leitung der Akademie übernommen hatte und schließlich Chef der gesamten Sûreté geworden war. Was er immer noch war.
Mehr oder weniger.
Natürlich war sie älter geworden. Schneller als notwendig, schneller, als es der Fall gewesen wäre, hätte er sie nicht an Bord geholt. Hätte er sie nicht zum Chief Inspector gemacht. Und hätte dieser letzte Einsatz gegen die Drogenkartelle nicht stattgefunden. Vor ein paar wenigen Monaten.
»Ja«, sagte er. »Ich denke noch daran.«
Isabelle, die von einer Kugel in den Kopf getroffen zu Boden stürzte. Was sie in diesem Moment für ihre letzte Handlung gehalten hatten, hatte ihnen eine Chance verschafft. Genauer gesagt war es ihrer aller Rettung gewesen. Und zugleich ein blutiger Albtraum.
Er erinnerte sich daran, an diesen letzten Einsatz. Aber ebenso lebhaft erinnerte er sich an all die Razzien, die Zugriffe, die Verhaftungen. Die Ermittlungen, Jahr um Jahr. Die Opfer.
All die blinden, ins Leere starrenden Augen. Von Männern, Frauen, Kindern, den Opfern in Mordfällen, in denen er ermittelt hatte. Jahr um Jahr. Deren Mörder er zur Strecke gebracht hatte.
All die Beamten, die er in den Pulverdampf geschickt und dabei oftmals angeführt hatte.
Und er erinnerte sich an seine erhobene Faust, wie der Sensenmann im Begriff, an die geschlossene Tür zu klopfen. Um selbst einen Mord zu begehen. Nicht physisch, aber Armand Gamache war Realist genug, um zu wissen, dass er trotzdem Leben raubte. Er trug die Gesichter von Vätern, Müttern, Ehefrauen und Ehemännern stets mit sich herum. Fragend, neugierig. Höflich öffneten sie die Tür und blickten den Fremden an.
Wenn er dann die schicksalhaften Worte aussprach, veränderte sich ihr Gesicht. Und er sah mit an, wie ihre Welt zusammenbrach. Sie unter Trümmern begrub. Sie in einen so tiefen Kummer stürzte, dass die meisten sich nie wieder davon befreien konnten. Und diejenigen, die es schafften, kehrten benommen in eine Welt zurück, die sich für immer verändert hatte.
Die Menschen, die sie gewesen waren, bevor er in ihr Leben trat, waren tot. Verschwunden.
Bei jedem Mord starb mehr als ein Mensch.
Ja. Er erinnerte sich.
»Aber ich versuche, nicht zu lange darüber nachzudenken«, sagte er zu Isabelle.
Oder sich gar darin zu verlieren. Sich in den Tragödien, dem Schmerz einzurichten. Dem Leid. Sich in der Hölle niederzulassen.
Aber es war schwer loszulassen. Vor allem die Beamten, Männer und Frauen, die ihr Leben verloren hatten, weil sie seinen Anweisungen gefolgt waren. Ihm gefolgt waren. Lange Zeit hatte er das Gefühl gehabt, es ihnen schuldig zu sein, an diesem Ort der Trauer auszuharren. Ihnen dort Gesellschaft zu leisten.
Seine Freunde und Therapeuten hatten ihm geholfen zu begreifen, dass er ihnen damit nicht gerecht wurde. Ihr Leben durfte nicht über ihren Tod definiert werden. Zu ihnen gehörte nicht der andauernde Schmerz, sondern die Schönheit ihres kurzen Lebens.
Würde er nicht nach vorn sehen, wären sie bis in alle Ewigkeit in diesen grauenhaften letzten Momenten gefangen.
Armand sah Isabelle zu, wie sie ihren Becher vorsichtig auf dem Küchentisch abstellte. Als er nur noch zwei Zentimeter von der Tischplatte entfernt war, lockerte sich ihr Griff und der Kaffee schwappte über. Nicht viel, aber er bemerkte ihren Ärger. Die Frustration. Die Scham.
Er bot ihr sein Taschentuch zum Aufwischen an.
»Merci.« Sie nahm es und wischte damit über den Tisch. Er streckte die Hand aus, um es ihr wieder abzunehmen, aber sie behielt es. »Ich w-w-w … wasche es und gebe es Ihnen dann zurück«, sagte sie schroff.
»Isabelle.« Seine Stimme klang sanft, aber entschieden. »Sehen Sie mich an.«
Sie hob den Blick von dem durchgeweichten Taschentuch und sah ihm ins Gesicht.
»Ich habe ihn auch gehasst.«
»Wen?«
»Meinen Körper. Ich habe ihn gehasst, weil er mich im Stich gelassen hat. Weil er das zugelassen hat.« Er strich mit dem Finger über die Narbe an seiner Schläfe. »Weil er sich nicht schnell genug bewegt hat. Weil er es nicht hat kommen sehen. Weil er am Boden lag und nicht aufstehen konnte, um meine Leute zu beschützen. Ich habe ihn gehasst, weil er nicht schnell genug heilte. Ich habe ihn gehasst, wenn ich stolperte. Wenn Reine-Marie meine Hand nehmen musste, um mich zu stützen. Ich konnte die mitleidigen Blicke sehen, wenn ich humpelte oder nach einem Wort suchte.«
Isabelle nickte.
»Ich wollte meinen alten Körper wiederhaben«, sagte Armand. »Den starken und gesunden.«
»Den von vorher.«
»Den von vorher.« Er nickte.
In der Stille, die sie umgab, war nur das entfernte Lachen der Kinder zu hören.
»So geht es mir auch«, sagte sie. »Ich hasse meinen … Körper. Ich hasse es, dass ich meine Kinder nicht hochheben oder mit ihnen spielen kann oder dass sie mich hochziehen müssen, wenn ich mich zu ihnen auf den Boden gesetzt habe. Ich hasse ihn. Ich hasse es, dass ich ihnen … vor dem Einschlafen nicht vorlesen kann und dass ich so schnell müde werde und vergesse, was ich tun oder sagen wollte. Ich hasse es, dass ich an manchen Tagen nicht addieren kann und an anderen nicht … subtrahieren. Und an manchen Tagen –«
Isabelle hielt inne und sammelte sich. Sie sah ihm in die Augen.
»Ich vergesse ihre Namen, patron«, flüsterte sie. »Die Namen meiner eigenen Kinder.«
Es hatte keinen Sinn, ihr zu sagen, dass er verstand oder dass es in Ordnung war. Ihr stand das Recht zu, nicht mit banalen Antworten abgespeist zu werden.
»Und was lieben Sie, Isabelle?«
»Pardon?«
Gamache schloss die Augen und hob das Gesicht zur Decke. »›Weiße Teller und Tassen, blitzblank schimmernd, / Mit blauen Rändern; und Feenstaub, federfein; / Nasse Dächer im Laternenschein; die kräftige Kruste von freundlichem Brot.‹«
Er öffnete die Augen, sah Isabelle an und lächelte, wobei sich tiefe Falten um seine Augen bildeten und über sein müdes Gesicht zogen.
»Es geht noch weiter, aber ich lasse es damit gut sein. Das ist ein Gedicht von Rupert Brooke. Er war Soldat im Ersten Weltkrieg. In der Hölle der Schützengräben hat ihm der Gedanke an Dinge geholfen, die er liebt. Mir hat es auch geholfen. Ich habe im Geist Listen aufgestellt und an die Dinge gedacht, die ich liebe, die Menschen, die ich liebe, um meinen Verstand heilen zu lassen. Ich tue es immer noch.«
Er konnte sehen, dass sie nachdachte.
Was er da vorschlug, war kein Wundermittel gegen eine Kugel im Kopf. Vor ihr lagen noch eine Menge Arbeit und Schmerz, physisch wie emotional. Aber man konnte alles genauso gut im Sonnenschein tun.
»Heute bin ich stärker und gesünder als damals, bevor das alles geschah«, sagte Gamache. »Physisch. Emotional. Weil ich es sein musste. Und bei Ihnen wird es auch so sein.«
»Dinge sind an der Stelle am stärksten, an der sie zerbrochen sind«, sagte Lacoste. »Agent Morin hat das mal gesagt.«
Dinge sind an der Stelle am stärksten, an der sie zerbrochen sind.
Armand hörte wieder die unglaublich und ewig junge Stimme von Paul Morin. Als würde er hier neben ihnen in Isabelles sonnendurchfluteter Küche stehen.
Agent Morin hatte recht gehabt. Doch wie weh tat es zu heilen.
»In gewisser Weise habe ich Glück«, sagte Isabelle nach einer Weile. »Ich habe überhaupt keine Erinnerung an den Tag. Da ist absolut nichts. Ich glaube, das hilft.«
»Das glaube ich auch.«
»Meine Kinder wollen mir unbedingt … Pinocchio vorlesen. Es soll irgendwas mit dem zu tun haben, was passiert ist, keine Ahnung. Verstehen Sie das, patron?«
»Manchmal ist eine Kugel im Kopf ein Segen.«
Sie lachte. »Wie ist das bei Ihnen?«
»Mit dem Erinnern?«
»Mit dem Vergessen.«
Er holte tief Luft, blickte auf seine Füße, dann hob er den Kopf und sah ihr in die Augen.
»Ich hatte einmal einen Mentor –«, setzte er an.
»Du lieber Himmel, nicht der, der Ihnen die Lyrik nahegebracht hat«, sagte sie in gespieltem Entsetzen. Er hatte diesen lyrischen Ausdruck im Gesicht.
»Nein, aber wo wir gerade dabei sind.« Er räusperte sich. »›Der Schiffbruch des Hesperus!‹«, verkündete er und öffnete den Mund, als wollte er das Gedicht folgen lassen. Doch stattdessen lächelte er und sah Isabelle von einem Ohr zum andern grinsen.
»Was ich eigentlich sagen wollte, mein Mentor hatte diese Theorie, dass unser Leben wie ein Langhaus der Ureinwohner ist. Ein einziger großer Raum.« Er machte eine weit ausholende Armbewegung. »Er sagte, dass wir uns etwas vormachen, wenn wir meinen, wir könnten alles in Schubladen einordnen. Jeder Mensch, den wir treffen, jedes Wort, das wir sagen, jede Handlung, die wir tun oder lassen, dauert in unserem Langhaus fort. Mit uns zusammen. Immer. Und kann niemals rausgeworfen oder weggesperrt werden.«
»Eine ziemlich gruselige Vorstellung«, sagte Isabelle.
»Absolument. Mein Mentor, mein erster Chief Inspector, hat zu mir gesagt: ›Armand, wenn du nicht willst, dass es in deinem Langhaus nach merde riecht, musst du zwei Dinge tun –‹«
»Ruth Zardo nicht reinlassen?«
Armand lachte. »Dafür ist es zu spät. Auch für Sie.«
Für einen kurzen Moment war er wieder dort. Rannte auf den Rettungswagen zu. Isabelle auf der Trage, bewusstlos. Die knochigen Hände der alten Dichterin um die von Isabelle geschlossen. Mit fester Stimme flüsterte sie Isabelle immer wieder das Einzige zu, was zählte.
Dass sie nicht allein war.
Isabelle würde sich niemals daran erinnern, und Armand würde es niemals vergessen.
»Nein. Er sagte: ›Sei sehr, sehr vorsichtig, wen du in dein Leben lässt. Und lerne, mit allem, was passiert, deinen Frieden zu machen. Du kannst die Vergangenheit nicht auslöschen. Sie ist mit dir da drin eingeschlossen. Aber du kannst deinen Frieden mit ihr machen. Wenn du das nicht tust, befindest du dich in einem fortwährenden Krieg.‹«
Bei der Erinnerung lächelte Armand.
»Ich glaube, er wusste, mit was für einem Dummkopf er es zu tun hatte. Dass ich im Begriff war, ihm meine eigene Theorie über das Leben zu präsentieren. Mit dreiundzwanzig. Er hat mich vor die Tür gesetzt. Aber bevor ich ging, sagte er noch: ›Der Feind, gegen den du kämpfst, bist du selbst.‹«
Gamache hatte seit Jahren nicht mehr an diese Begegnung gedacht. Aber von da an hatte er sein Leben als Langhaus betrachtet.
Und als er sich jetzt in seinem Langhaus umblickte, sah er all die jungen Polizisten, all die Männer und Frauen, Jungen und Mädchen, deren Leben er mitgeprägt hatte.
Und er konnte auch die Menschen sehen, die ihn verletzt hatten. Schwer verletzt. Ihn beinahe umgebracht hatten.
Sie alle lebten dort.
Und wenngleich er mit vielen dieser Erinnerungen, dieser Geister niemals Freundschaft schließen würde, hatte er sein Bestes getan, Frieden mit ihnen zu schließen. Mit dem, was er getan hatte und was ihm angetan worden war.
»Sind die Opioide auch dort, patron? In Ihrem Langhaus?«
Ihre Frage holte ihn unvermittelt in die Gegenwart zurück, in ihre behagliche Küche.
»Haben Sie sie gefunden?«
»Nicht alles, nein. Ein Rest ist verschwunden, hier in Montréal«, gab er zu.
»Wie viel?«
»Genug für Hunderttausende von Spritzen.«
Sie schwieg. Sprach nicht aus, was er besser wusste als irgendjemand sonst.
Jede davon konnte töten.
»Merde«, flüsterte sie, um sich gleich darauf zu entschuldigen. »Désolée.«
Sie fluchte nur selten und praktisch nie in Gegenwart des Chefs. Aber die Vorstellung war so fürchterlich, dass es ihr einfach herausgerutscht war.
»Das ist noch nicht alles«, sagte sie und musterte den Mann, den sie inzwischen so gut kannte. Besser als ihren eigenen Vater. »Sie bedrückt noch etwas anderes.«
Lastete zentnerschwer auf ihm, das traf es besser, aber ihr fielen die Worte nicht ein.
»Ja. Es hat mit der Akademie zu tun.«
»Der Akademie der Sûreté?«
»Ja. Es gibt ein Problem. Sie wollen eine der Kadettinnen rauswerfen.«
»Das kommt vor«, sagte Isabelle. »Das ist nicht schön, patron, aber warum machen Sie sich deswegen Gedanken?«
»Die Kadettin, um die es geht, ist Amelia Choquet. Der Commander hat mich deswegen eigens angerufen.«
Isabelle lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück und sah ihn prüfend an. »Und? Warum ruft er Sie an? Sie sind nicht mehr der Leiter der Akademie.«
»Stimmt.«
Ihr wurde klar, dass es nicht nur zentnerschwer auf ihm lastete. Es zermalmte ihn beinahe.
»Was ist los, patron?«
»Sie haben Opioide bei ihr gefunden.«
»Merde.« Dieses Mal entschuldigte sie sich nicht. »Wie viel?«
»Offenbar zu viel für den Eigengebrauch.«
»Sie dealt? An der Akademie?«
»Scheint so.«
Isabelle schwieg. Verdaute das Gehörte. Dachte nach.
Armand ließ ihr Zeit.
»Stammt es aus Ihrer Lieferung?«, fragte sie. Es war nicht ihre Absicht gewesen, ihn dafür verantwortlich zu machen, aber es klang so. Und sie wussten beide, dass er verantwortlich dafür war, vielleicht nicht für die Drogen, aber doch für die Situation.
»Sie haben das Zeug noch nicht ins Labor geschickt, aber es könnte sein, ja.« Er blickte auf seine verschränkten Hände. »Ich muss eine Entscheidung treffen.«
»Wegen Kadettin Choquet.«
»Ja. Offen gestanden weiß ich nicht, was ich machen soll.«
Sie wünschte aus tiefstem Herzen, sie könnte ihm helfen.
»Tut mir leid, Chief, aber das ist doch bestimmt die Sache des Commanders. Nicht Ihre.«
Lacoste beobachtete Chief Superintendent Gamache und war sich nicht sicher, was in ihm vorging. Er schien sie um Hilfe zu bitten und ihr trotzdem Informationen vorzuenthalten.
»Sie verschweigen mir etwas.«
»Isabelle«, sagte er, ohne auf ihre Bemerkung einzugehen. »Was würden Sie an meiner Stelle tun?«
»Wenn man Drogen im Besitz einer Kadettin finden würde? Ich würde das dem Leiter der Akademie überlassen. Es ist nicht Ihre Angelegenheit, patron.«
»Oh doch, Isabelle. Wenn es, wie Sie es formuliert haben, meine Opioide sind, die sich in ihrem Besitz befinden.«
»Woher hat sie die Drogen denn?«, fragte Isabelle. »Hat sie das gesagt?«
»Der Commander hat sie noch nicht befragt. Vermutlich weiß Kadettin Choquet noch gar nicht, dass man sie entdeckt hat. Ich fahre nachher hin. Wenn er sie rauswirft, stirbt sie. Das weiß ich.«
Lacoste nickte. Das war ihr ebenfalls klar. Kaum jemand wusste, warum Gamache Amelia überhaupt in die Akademie aufgenommen hatte. Warum diese verkorkste junge Frau, Exjunkie und Exprostituierte, einen der begehrten Ausbildungsplätze an der Akademie erhalten hatte.
Aber Isabelle wusste es. Oder dachte es zumindest.
Aus demselben Grund, aus dem er sie vom beruflichen Abstellgleis geholt und ihr eine Stelle angeboten hatte.
Die Hand ausgestreckt und Jean-Guy zu sich geholt hatte, als der kurz davorgestanden hatte, gefeuert zu werden.
Aus demselben Grund, aus dem Chief Superintendent Gamache jetzt in Erwägung zog, den derzeitigen Leiter der Akademie zu überreden, Kadettin Choquet zu behalten.
Dieser Mann glaubte aus tiefster Überzeugung an eine zweite Chance.
Aber es wäre nicht Amelia Choquets zweite Chance. Es wäre ihre dritte.
Und das war in Lacostes Augen eine zu viel.
Eine zweite Chance hatte etwas mit Großmut zu tun, eine dritte mit Dummheit. Oder mit etwas noch Schlimmerem.
Es war gefährlich, vielleicht sehr gefährlich, zu glauben, dass jemand gerettet werden konnte, obwohl er bewiesen hatte, dass das nicht der Fall war.
Man hatte Amelia Choquet nicht dabei erwischt, wie sie in einer Prüfung schummelte oder einer Kommilitonin irgendeinen Modeschmuck klaute. Sie war mit einer Droge erwischt worden, die so stark war, so gefährlich, dass sie nahezu jeden umbrachte, der sie konsumierte. Amelia Choquet wusste das. Sie wusste, dass sie mit dem Tod handelte.
Chief Inspector Lacoste betrachtete diesen standhaften Mann, der daran glaubte, dass jeder gerettet werden konnte. Dass er jeden retten konnte. Es war zugleich eine Tugend und ein blinder Fleck. Kaum jemand wusste besser als Isabelle Lacoste, was das bedeutete. Manchmal schoss man übers Ziel hinaus. Manchmal irrte man sich. Aber ein blinder Fleck raubte einem einfach das Urteilsvermögen.
Isabelle stellte fest, dass Gamaches rechte Hand nicht zitterte. Sie war zur Faust geballt.