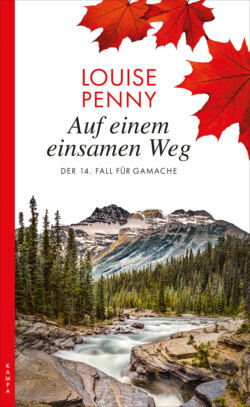Читать книгу Auf einem einsamen Weg - Louise Penny - Страница 8
6
Оглавление»Sind wir da?«, fragte der Notar. Zum x-ten Mal.
»Ja.«
»Wirklich?«
Die Antwort kam so unerwartet, dass er verstummte. Er wischte mit seinem Ärmel das Kondenswasser von der Scheibe und blickte hinaus. Und sah … nichts.
Doch dann wurden die dicht fallenden Schneeflocken kurz in die andere Richtung gewirbelt, und für den Bruchteil einer Sekunde konnte er durch eine Lücke im Schneetreiben ein Haus sehen. Ein Zuhause.
Ein Haus aus Feldstein, durch dessen Flügelfenster gedämpftes Licht fiel.
Im nächsten Moment war es wieder verschwunden, vom Schneegestöber verschluckt. Es war nur so kurz zu sehen gewesen, dass Mercier sich fragte, ob Verzweiflung und Phantasie ihm ein Trugbild vorgegaukelt hatten.
»Sind sie sicher?«, fragte er.
»Ziemlich sicher.«
Nicht einmal eine Stunde später hatten Armand und seine Gäste heiß geduscht und steckten wieder in sauberen, trockenen Sachen. Alle außer Mercier, der das Angebot ausgeschlagen hatte.
Sie saßen an dem langen Kieferntisch in der Küche, während der Holzofen am anderen Ende des Raums seine Hitze verströmte. Vor den Fenstern zu beiden Seiten des Kamins hatte sich Schnee angehäuft und versperrte die Sicht nach draußen.
Benedict trug ein geborgtes T-Shirt, Pullover und Hose und hatte sich mittlerweile wieder abgeregt. Die heiße Dusche und die Aussicht auf eine Mahlzeit hatten ihn besänftigt.
Er sah sich um.
Trotz des Unwetters, das draußen tobte, wackelte das Haus nicht, und auch die Fenster klapperten nicht. Es war für die Ewigkeit gebaut, und so lange stand es auch schon. Benedict schätzte, dass es mehr als hundert, vielleicht sogar zweihundert Jahre alt war.
Selbst wenn er sich anstrengen, sich wirklich richtig Mühe geben würde, würde er wohl kaum ein so stabiles Haus bauen können.
Er blickte quer durch den Raum zu Madame Gamache, die Suppe verteilte, und zu Armand, der Brot schnitt. Hin und wieder berieten sie sich kurz. Sie berührten sich auf eine gleichzeitig beiläufige und vertraute Art.
Benedict fragte sich, ob er eine so stabile Beziehung aufbauen könnte, wenn er sich anstrengen, sich wirklich richtig Mühe geben würde.
Er kratzte sich an der Brust.
Als Armand vorhin unter dem heißen Wasserstrahl der Dusche gestanden hatte, hatte er Reine-Marie gefragt: »Sagt dir der Name Bertha Baumgartner etwas?«
»War das nicht eine Comicfigur?«, sagte Reine-Marie. »Nein, das war Dagwood. War sie eine der Bösen in Doonesbury?«
Er drehte das Wasser ab, trat aus der Kabine und nahm das Handtuch, das sie ihm hinhielt.
»Merci.« Während er seine Haare trockenrubbelte, warf er ihr einen belustigten Blick zu, doch dann sah er, dass sie es ernst meinte. »Nein, sie war eine Nachbarin, gewissermaßen.«
Er zog Cordhosen, ein frisches Hemd und einen Pullover an und erzählte ihr, warum er in das entlegene Farmhaus bestellt worden war.
»Testamentsvollstrecker? Aber dann musst du sie gekannt haben, Armand. Warum hätte sie dich sonst einsetzen sollen?«
»Ich habe keine Ahnung.«
»Und Myrna kennt sie auch nicht?«
»Genauso wenig wie der junge Mann. Benedict.«
»Wie erklärst du dir das?«
»Kann ich nicht.«
»Hm«, sagte Reine-Marie.
Als alle mit Suppe, Sandwiches und Bier versorgt waren, überließ Reine-Marie sie am Küchentisch sich selbst und ging mit ihrem Essen ins Wohnzimmer.
Sie setzte sich mit Gracie, ihrem kleinen Findling, an den Kamin, sah in die Flammen und wiederholte den Namen:
Bertha Baumgartner. Bertha Baumgartner.
Noch immer sagte ihr der Name nichts.
»Also«, sagte Mercier und rückte seine Brille zurecht, »Sie alle haben sich bereit erklärt, das Amt des Testamentsvollstreckers für den Nachlass von Bertha Baumgartner zu übernehmen. Ist das richtig?«
Was wohl ein »Ja« sein sollte, kam von Benedict, aber weil er gerade einen Riesenbissen Roastbeef-Sandwich im Mund hatte, klang es eher wie ein dumpfes »Waa«.
Henri, der neben Armands Füßen lag, stellte die Ohren auf, und sein Schwanz wischte über den Boden.
»Das ist richtig«, antwortete Myrna im gleichen Ton wie der Notar, der es allerdings nicht zu bemerken schien.
Ihr Stuhl knarzte, als sie sich zurücklehnte, eine Schale mit warmer Erbsensuppe in den Händen. Sie hatte Lust auf einen Schluck Bier, aber die Wärme war so wohltuend, dass sie die Schale nicht abstellen wollte.
Weil sich vor ihrem Buchladen der Schnee türmte, hatte Armand sie vor der Tür zum Bistro abgesetzt, damit sie duschen und sich umziehen konnte, bevor sie sich wieder zu ihnen gesellte.
»Gott sei Dank«, sagte Clara, als sie ihre Freundin umarmte. »Wir haben uns solche Sorgen gemacht.«
»Ich nicht«, sagte Gabri, drückte sie aber trotzdem fest an sich. »Alles in Ordnung?«, erkundigte er sich. »Du siehst beschissen aus.«
»Könnte schlimmer sein.«
»Wo warst du eigentlich?«, fragte Olivier.
Myrna sah keinen Grund, es ihnen nicht zu sagen.
»Bertha Baumgartner?«, sagte Gabri. »Bertha Baumgartner? Echt? In dieser Gegend gab es mal eine Bertha Baumgartner, und ich habe sie nicht gekannt? Wer war sie?«
»Du kennst sie also nicht?«, fragte Myrna. Gabri und Olivier kannten jeden.
»Du etwa auch nicht?«, fragte Clara und folgte ihr zu der Verbindungstür zwischen Bistro und Buchladen.
»Nein. Ich habe keine Ahnung.« Myrna blieb stehen und blickte in erstaunte Gesichter.
»Armand ist auch Testamentsvollstrecker, sagst du?«, fragte Olivier. »Dann muss er sie kennen.«
»Nein. Keiner von uns. Nicht einmal der Notar.«
»Und sie hat hier die Straße runter gewohnt?«, fragte Clara.
»Na ja, ungefähr zwanzig Minuten von hier. Seid ihr sicher, dass euch der Name nichts sagt?«
»Bertha Baumgartner«, wiederholte Gabri, offensichtlich gefiel ihm der Klang.
»Ich warne dich«, sagte Olivier. Er drehte sich zu Clara und Myrna. »Er sucht nach einem Pseudonym, mit dem er die Karnevalseinladung an Premierminister Trudeau unterschreiben kann. Wir haben den Verdacht, dass Gabri Dubeau auf der Sofort-schreddern-Liste steht.«
»Ich habe ihm ein paar Briefe geschickt«, gab Gabri zu. »Und zwei, drei Fotos.«
»Und?«, sagte Olivier.
»Eine Haarlocke. Aber zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass sie von Olivier war.«
»Wie bitte? Du spinnst wohl!« Olivier fasste sich an den Kopf. Jede Strähne seiner dünner werdenden blonden Haare war kostbar.
Als Myrna zwanzig Minuten später in warmen, trockenen Sachen aus ihrem Loft herunterkam, stellte sie fest, dass Gabri und Olivier draußen waren und Wege freischaufelten.
»Sie graben doch nicht etwa Ruth aus?«, sagte sie zu Clara.
Das war, als würde man ein Schreckgespenst freilassen. Nichts, was man leichthin tat. Nicht zuletzt deshalb, weil sie sich nur sehr schwer wieder einfangen ließ.
»Ich fürchte, doch. Und zu essen geben sie ihr auch. Sie haben ihr Suppe in einer Scotchflasche gebracht, in der Hoffnung, dass sie den Unterschied nicht merkt.«
»Ruth vielleicht nicht, aber Rosa schon.«
Die Ente war heikel.
»Wohin gehst du?«, fragte Clara und folgte Myrna zur Tür.
»Zu Armand. Das Testament soll verlesen werden.«
»Kann ich mitkommen?«
»Willst du das wirklich?«
»Klar. Ich laufe lieber durch einen Schneesturm, als mit einem Buch und einem Glas Scotch am Kamin zu sitzen.«
»Dachte ich mir«, sagte Myrna und riss die Tür auf. Sie stemmte sich gegen den Wind und stapfte durch das dichte Schneetreiben.
Sie kannte Bertha nicht, aber sie konnte sie immer weniger leiden.
Armand stand in seinem Arbeitszimmer, das Telefon am Ohr.
Hin und wieder gab eine Lücke zwischen den herumwirbelnden Schneeflocken den Blick auf Myrna frei, die den Dorfanger umrundete und auf sein Haus zukam.
Reine-Marie hatte ihm gesagt, dass die Telefonleitung tot war, aber er wollte sich vergewissern, ob das Telefon inzwischen nicht vielleicht doch wieder funktionierte.
Tat es nicht.
Er sah auf seine Uhr. Erst halb zwei nachmittags, aber es kam ihm vor wie Mitternacht.
Dreieinhalb Stunden, seit er vor Bertha Baumgartners Haus in seinem Auto gesessen und den Anruf erhalten hatte. Dreieinhalb Stunden seit dem scharfen Wortwechsel.
Der Gedanke daran beschwor den Geruch feuchter Wolle herauf, das Geräusch von Schnee, der auf sein Auto fiel.
Er hatte gesagt, er würde sich wieder bei ihnen melden. Ihnen das Versprechen abgenommen, nichts zu unternehmen, bevor sie nicht von ihm hörten. Und jetzt das.
Reine-Marie begrüßte Myrna, und nachdem Armand den stummen Hörer aufgelegt hatte, ging er zu den anderen in die warme Küche, zu Suppe, Sandwiches, Bier und der Verlesung des Testaments.
»Im Radio haben sie gemeldet, dass der Schneesturm den gesamten Süden von Québec erfasst hat«, sagte Myrna und zupfte an ihren von der Mütze zusammengedrückten Haaren herum. »Aber im Lauf der Nacht soll er nachlassen.«
»So weiträumig?«, sagte Armand.
Reine-Marie musterte sein Gesicht. Er wirkte erleichtert statt besorgt.
In der Wohnung von Annie und Jean-Guy in Le Plateau in Montréal flackerte das Licht.
Sie verstummten und blickten zur Deckenlampe.
Sie flackerte. Flackerte.
Dann brannte sie ruhig weiter.
Annie und Jean-Guy wechselten einen Blick und hoben die Augenbrauen, dann nahmen sie ihr Gespräch wieder auf. Jean-Guy berichtete ihr von seinem morgendlichen Treffen mit den internen Ermittlern.
»Solltest du irgendwas unterschreiben?«, fragte Annie.
»Woher weißt du das?«
»Also war es so?«
Er nickte.
»Hast du?«
»Nein.«
»Gut.«
Erneut sah er die Papiere vor sich, die sie ihm über den Tisch zuschoben, und ihre erwartungsvollen Gesichter.
»Du hattest recht. Sie haben etwas vor. Auf deinen Vater könnte mehr zukommen als eine Suspendierung oder sogar eine Entlassung.«
»Zum Beispiel?«
»Kann ich nicht sagen. Sie haben keine Anschuldigungen erhoben, aber sie sind immer wieder auf die Drogen zurückgekommen. Die, die er durchgelassen hat.«
»Das wussten sie doch schon«, sagte Annie. »Er hat es ihnen gleich danach gesagt. In ganz Kanada und bis in die Vereinigten Staaten wurde die Polizei in Alarmbereitschaft versetzt. Die DEA hat das Zeug, das über die Grenze ging, abgefangen, stimmt’s?«
»Mithilfe deines Vaters, ja.«
»Und mit deiner.«
»Ja. Aber es fehlt immer noch eine große Menge. Mehrere Kilo. Hier. Irgendwo in Montréal. Monatelang haben wir danach gesucht. Sämtliche Informanten eingespannt. Nichts. Wenn das Zeug in Umlauf kommt …«
Er hielt inne, unsicher, wie er den Satz beenden sollte.
»Das Zeug ist furchtbar, Annie.«
»Ich weiß.«
Er schüttelte den Kopf. »Nein, das glaubst du nur. Stell dir das Schlimmste vor. Das Allerschlimmste.«
Sie tat es.
»Das wäre das Beste, was passieren könnte«, sagte er.
Annie lächelte, weil sie dachte, er würde sie auf den Arm nehmen. Übertreiben. Doch dann verschwand ihr Lächeln.
So schlimm.
»Sie wissen, dass es einen Shitstorm gibt, sobald es in Umlauf kommt. Sie brauchen also einen Sündenbock.«
»Sie?«
»Die.« Er hob die Hände. »Was weiß ich. Mit diesem politischen Scheiß kenne ich mich nicht aus. Dafür war immer dein Vater zuständig.«
»Ist es denn etwas Politisches?«
»Ich glaube schon. Um die armen Schweine, die das Zeug nehmen, scheint sich jedenfalls keiner groß Sorgen zu machen. Jeder will nur den eigenen Arsch retten.«
»Weiß Dad das?«
»Ich glaube, er vermutet es. Aber er versucht immer noch, das Zeug zurückzubekommen. Was anderes interessiert ihn nicht. Als ich heute Morgen da reinmarschiert bin, dachte ich wirklich, sie würden mir mitteilen, dass sie die Ermittlungen einstellen und deinem Vater seinen Posten zurückgeben.«
»Und jetzt?«, fragte Annie.
»Keine Ahnung«, sagte er und ließ sich schwer zurücksinken. »Ich hab das alles satt, Annie. Ich hab die Schnauze voll.«
»Ich weiß. Es ist zum Kotzen. Ich bin froh, dass du zu Dad hältst.«
Jean-Guy nickte stumm.
Wieder hörte er Marie Janviers beruhigende Stimme. All das geht vorüber, Chief Inspector. Sobald Sie unterschrieben haben. Dann kehrt wieder Normalität ein.