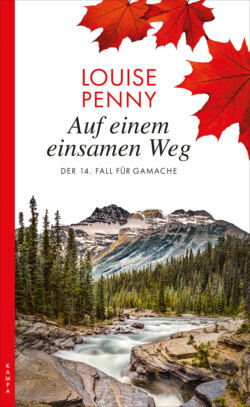Читать книгу Auf einem einsamen Weg - Louise Penny - Страница 6
4
Оглавление»Wer sind Sie?«, fragte Gamache, beugte sich vor und sah den Mann am Kopfende des Tisches eindringlich an.
»Das wissen wir schon, Sir«, sagte Benedict.
Er sprach langsam. Geduldig. Myrna musste den Kopf senken, um ihr entzücktes, amüsiertes Lächeln zu verbergen.
»Er. Ist. Ein. Notar.« Beinahe hätte der junge Mann Armands Hand getätschelt.
»Oui, merci«, sagte Armand. »Das habe ich schon begriffen. Aber Laurence Mercier ist vor sechs Monaten gestorben. Also, wer sind Sie?«
»Hier steht es doch«, sagte Mercier und deutete auf die unleserliche Unterschrift. »Lucien Mercier. Laurence war mein Vater.«
»Und Sie sind auch Notar?«
»Ja. Ich habe die Kanzlei meines Vaters übernommen.«
Gamache wusste, dass Notare in Québec ähnliche Tätigkeitsbereiche wie Rechtsanwälte hatten und alles von Grundstücksverkäufen bis zu Eheverträgen erledigten.
»Warum benutzen Sie sein Briefpapier?«, sagte Myrna. »Das erweckt einen falschen Eindruck.«
»Aus Sparsamkeit und Umweltschutzgründen. Ich mag keine Verschwendung. Wenn ich die Geschäfte meines Vaters erledige, benutze ich seinen Briefkopf. Das ist für die Klienten auch weniger verwirrend.«
»Dem würde ich widersprechen«, murmelte Myrna.
Mercier zog vier Mappen aus seinem Aktenkoffer und teilte sie aus. »Sie sind hier, weil Sie in Bertha Baumgartners Letztem Willen genannt sind.«
Eine Weile schwiegen alle und verdauten die Nachricht, dann sagte Benedict: »Echt?«, während Armand und Myrna gleichzeitig »Wer?« fragten.
»Bertha Baumgartner«, wiederholte der Notar. Und dann nannte er den Namen ein drittes Mal, weil die beiden älteren invités ihn nach wie vor verständnislos ansahen.
»Nie von ihr gehört«, sagte Myrna. »Du?«
Armand dachte kurz nach. Er lernte jede Menge Leute kennen und war sich ziemlich sicher, dass er sich erinnern würde. Aber es fiel ihm niemand ein. Der Name sagte ihm nichts.
Armand und Myrna drehten sich zu Benedict, dessen hübsches Gesicht Neugier ausdrückte, mehr aber auch nicht.
»Sie?«, fragte Myrna, und er schüttelte den Kopf.
»Hat sie uns Geld hinterlassen?«, fragte Benedict.
Das klang nicht gierig, dachte Gamache. Eher verwundert. Und ja, vielleicht ein bisschen hoffnungsvoll.
»Nein«, erwiderte Mercier mit freudiger Miene, die sich sofort ins Gegenteil verkehrte, als der junge Mann kein bisschen enttäuscht wirkte.
»Warum sind wir also hier?«, fragte Myrna.
»Sie sind die Testamentsvollstrecker.«
»Was?«, sagte Myrna. »Sie machen Witze.«
»Vollstrecker? Was soll das heißen?«, fragte Benedict.
»Sie sind mit der Abwicklung des Testaments betraut«, erklärte Mercier.
Als Benedict nach wie vor verwirrt dreinschaute, sagte Armand: »Es bedeutet, dass Bertha Baumgartner uns die Aufgabe übertragen hat, dafür zu sorgen, dass ihrem Letzten Willen nachgekommen wird. Damit ihre Wünsche auch tatsächlich erfüllt werden.«
»Dann ist sie tot?«, fragte Benedict.
Armand wollte schon antworten, dass das ja wohl offenkundig sei. Aber gerade eben war »tot« kein bisschen offenkundig gewesen, also war Madame Baumgartner vielleicht …
In Erwartung einer Bestätigung drehte sich Gamache zu dem Notar.
»Ja. Sie ist vor gut einem Monat gestorben.«
»Und bis dahin hat sie hier gewohnt?«, fragte Myrna, sah zu der durchhängenden Decke hoch und überlegte, wie lange sie zur Tür brauchte, wenn die Decke nicht mehr nur durchhing, sondern durchbrach. Vielleicht könnte sie auch einfach aus dem Fenster springen.
Mit Sicherheit würde sie weich landen, was nicht nur am Schnee läge, sondern auch daran, dass sie fast ausschließlich aus Gummibärchen bestand.
»Nein, sie hat in einem Seniorenheim gelebt«, sagte Mercier.
»Ist das hier also so was wie ein Geschworenendienst?«, fragte Benedict.
»Pardon?«, sagte der Notar.
»Na ja, wenn man zum Geschworenen berufen wird. Unsere Staatsbürgerpflicht, so in der Art. Wenn man zum Dings wird … wie haben Sie es noch mal genannt?«
»Testamentsvollstrecker«, sagte Mercier. »Nein, damit ist es nicht zu vergleichen. Sie hat Sie eigens dazu bestimmt.«
»Aber warum uns?«, fragte Armand. »Wir kannten sie nicht mal.«
»Ich habe keine Ahnung, und traurigerweise können wir sie nicht mehr fragen«, sagte Mercier, der dabei kein bisschen traurig aussah.
»Ihr Vater hat nichts dazu gesagt?«, fragte Myrna.
»Er hat nie über seine Klienten gesprochen.«
Gamache sah auf den Stapel Papier, der vor ihm lag, und bemerkte den roten Stempel in der oberen linken Ecke. Er wusste, wie Testamente aussahen. Man wurde nicht Ende fünfzig, ohne das eine oder andere gelesen zu haben. Und Gamache hatte einige gelesen, unter anderem sein eigenes.
Das hier war tatsächlich ein echtes, beglaubigtes Testament.
Er überflog das oberste Blatt und stellte fest, dass es vor zwei Jahren verfasst worden war.
»Sehen Sie sich bitte die zweite Seite an«, sagte der Notar. »Unter Ziffer 4 stehen Ihre Namen.«
»Einen Moment noch«, sagte Myrna. »Wer war Bertha Baumgartner? Irgendetwas müssen Sie doch über sie wissen.«
»Ich weiß nur, dass sie tot ist und mein Vater sich um ihren Nachlass gekümmert hat. Nach seinem Tod habe ich das übernommen. Und jetzt Sie. Bitte blättern Sie zu Seite zwei.«
Und tatsächlich, da standen ihre Namen. Myrna Landers aus Three Pines, Québec. Armand Gamache aus Three Pines, Québec. Benedict Pouliot, Rue Taillon 267, Montréal, Québec.
»Sind Sie das?« Mercier sah sie nacheinander an, und jeder von ihnen nickte. Er räusperte sich und hob an, das Testament zu verlesen.
»Einen Moment«, sagte Myrna. »Das ist verrückt. Irgendeine Fremde wählt uns willkürlich aus und macht uns zu ihren Testamentsvollstreckern? Geht das überhaupt?«
»Ja, natürlich«, sagte der Notar. »Wenn man Lust hat, kann man auch den Papst dazu ernennen.«
»Echt? Cool«, sagte Benedict, dessen Gedanken sich vor lauter Möglichkeiten überschlugen.
Gamache war nicht ganz derselben Meinung wie Myrna. Er bezweifelte, dass es willkürlich war. Er blickte auf die Namen in Bertha Baumgartners Testament. Ihre Namen. Da standen sie ganz eindeutig. Er vermutete, dass es dafür einen Grund gab. Auch wenn dieser Grund alles andere als eindeutig war.
Ein Polizist, eine Buchhändlerin, ein Bauhandwerker. Zwei Männer, eine Frau. Verschiedenen Alters. Zwei lebten auf dem Land, einer in der Stadt.
Es gab kein Muster. Sie hatten nichts miteinander gemein, außer dass ihre Namen in diesem Dokument erschienen.
Und dass keiner von ihnen Bertha Baumgartner gekannt hatte.
»Und muss man es machen, wenn man dazu ernannt ist?«, fragte Myrna. »Müssen wir es machen?«
»Natürlich nicht«, sagte Mercier. »Können Sie sich vorstellen, dass der Heilige Vater einen solchen Nachlass abwickelt?«
Sie versuchten es. Nach dem Lächeln auf seinem Gesicht zu urteilen, schien nur Benedict es zu schaffen.
»Dann können wir uns also weigern?«, fragte Myrna.
»Ja. Wollen Sie das denn?«
»Ja, also, ich weiß nicht. So schnell kann ich das nicht entscheiden. Ich hatte keine Ahnung, warum Sie mich haben kommen lassen.«
»Was haben Sie denn geglaubt?«, fragte Mercier.
Myrna ließ sich auf ihrem Stuhl zurücksinken und erinnerte sich.
An dem Morgen, an dem der Brief eintraf, war sie im Buchladen gewesen.
Sie hatte sich einen Becher starken Tee eingeschenkt und sich in den bequemen Sessel mit der tiefen Delle gesetzt, der sich ihrem Körper ganz und gar angepasst hatte.
Im Holzofen prasselte ein Feuer, und draußen vor dem Fenster lag ein strahlender Wintertag. Der Himmel war von einem vollkommenen tiefen Blau, und die Sonne glitzerte auf den schneebedeckten Wiesen, der Straße, dem Eislaufplatz und den Schneemännern auf dem Dorfanger. Das ganze Dorf glitzerte.
Es war einer jener Tage, an denen es einen nach draußen trieb. Auch wenn man es eigentlich besser wusste. Denn kaum war man im Freien, packte einen die Kälte, brannte in der Lunge, zog einem bei jedem Atemzug die Nasenlöcher zusammen. Sie ließ die Augen tränen. Die Wimpern vereisen, sodass die Lider zusammenklebten.
Und doch stand man atemlos da. Nur noch ein paar Minuten. Um den Tag noch ein wenig zu genießen. Bevor man sich ins Haus zurückzog, zum Ofen und zu heißer Schokolade, Tee oder starkem Café au lait.
Und der Post.
Sie hatte den Brief wieder und wieder gelesen und dann unter der aufgeführten Nummer angerufen, um sich zu erkundigen, warum der Notar sie sehen wollte.
Da niemand abhob, nahm sie den Brief mit ins Bistro, wo sie mit Clara Morrow und Gabri Dubeau, ihren Freunden und Nachbarn, zum Lunch verabredet war.
Während Clara und Gabri über das Thema Schneeskulpturen, den Hockey- und Mützenwettbewerb und die Erfrischungen für den bevorstehenden Winterkarneval redeten, schweifte Myrna in Gedanken immer wieder ab.
»Hallo«, sagte Gabri. »Jemand zu Hause?«
»Hm?«
»Wir brauchen deine Hilfe«, sagte Clara. »Das Schneeschuhrennen um den Dorfanger. Findest du eine oder zwei Runden besser?«
»Eine für die Altersklasse eins bis sieben«, sagte Myrna. »Anderthalb für die Altersklasse acht bis zwölf und zwei für alle anderen.«
»Nun, das war klar und deutlich«, sagte Gabri. »Und jetzt die Mannschaften für die Schneeballschlachten …«
Myrnas Gedanken schweiften wieder ab. Wie von ferne bekam sie mit, dass Gabri aufstand und weitere Holzscheite in das Feuer des offenen Kamins am anderen Ende des Bistros warf. Er blieb einen Moment stehen, um mit Gästen zu plaudern, die gerade aus der Kälte hereingekommen waren, mit den Füßen stampften und ihre kalten Hände aneinanderrieben.
Wärme empfing sie und der Geruch nach brennenden Ahornscheiten, ofenwarmen Tourtières und frisch gebrühtem Kaffee, der die Balken und Holzdielen imprägniert hatte.
»Ich muss dir etwas zeigen«, flüsterte Myrna Clara zu, während Gabri beschäftigt war.
»Warum flüsterst du?«, auch Clara senkte die Stimme. »Ist es was Schweinisches?«
»Natürlich nicht.«
»Natürlich?«, sagte Clara und hob die Augenbrauen. »Dafür kenn ich dich zu gut.«
Myrna lachte. Clara kannte sie tatsächlich gut. Aber auch sie kannte Clara gut.
Ihrer Freundin standen die braunen Haare vom Kopf ab, als hätte sie einen Stromschlag abbekommen. Sie sah ein bisschen wie ein mittelalter Sputnik aus. Was auch ihre Kunst erklären würde.
Clara Morrows Bilder waren wie aus einer anderen Welt. Und doch waren sie auf geradezu schmerzhafte Weise durch und durch menschlich.
Sie malte Porträts, wenigstens waren es auf den ersten Blick Porträts. Die wunderbar gemalte Haut spannte sich über Male des Leids und der Freude, bei manchen hing sie auch schlaff herunter. Sie malte Verlustängste und Glücksgefühle. Sie malte Gelassenheit und Verzweiflung. Alles in einem Porträt.
Clara fing mit Pinsel, Leinwand und Ölfarbe ihre Sujets ein, um sie zu befreien.
Während dieses Prozesses schaffte sie es, sich selbst über und über mit Farbe zu bekleckern. Wangen, Haare, Fingernägel. Sie war selbst ein Work in progress.
»Ich zeig’s dir nachher«, sagte Myrna, als Gabri zu ihrem Tisch zurückkehrte.
»Wenn du’s so spannend machst, sollte es besser richtig schweinisch sein«, sagte Clara.
»Schweinisch?«, fragte Gabri. »Erzähl.«
»Myrna meint, die Erwachsenen sollten beim Schneeschuhrennen nackt sein.«
»Nackt?«, fragte Gabri und warf Myrna einen Blick zu. »Ich bin ja nicht prüde, aber die Kinder …«
»Himmel!«, rief Myrna. »Das habe ich doch gar nicht gesagt. Clara lügt.«
»Wobei, wenn es spätabends stattfindet, sobald die Kinder im Bett sind …«, sagte Gabri. »Könnte klappen, wenn wir Fackeln um den Dorfanger herum aufstellen. Dann würden wir garantiert auch ein paar Geschwindigkeitsrekorde aufstellen.«
Myrna funkelte Clara an. Gabri, Präsident des Carnaval d’Hiver, verzog keine Miene.
»Gut, vielleicht nicht ganz nackt, sondern –« Gabri sah sich unter den Gästen des Bistros um und stellte sie sich nackt vor. »Vielleicht sollten sie Badesachen tragen.«
Clara zog die Augenbrauen zusammen, nicht missbilligend, sondern überrascht. Das war gar keine schlechte Idee. Vor allem wenn man bedachte, dass während des langen, langen, dunklen, dunklen Québecer Winters die meisten Gespräche im Bistro sich um die Flucht in wärmere Gefilde drehten. Darum, sich in Bikini und Badehose an irgendeinem Strand zu fläzen.
»Wir könnten es Flucht in die Karibik nennen«, sagte sie.
Myrna verdrehte seufzend die Augen.
Eine alte Frau am anderen Ende des Bistros bemerkte das und dachte, das Augenverdrehen hätte ihr gegolten.
Ruth Zardo starrte zurück.
Myrna fing den Blick auf und überlegte, wie ungerecht es doch von der Natur war, die alte Dichterin weißer werden zu lassen, aber nicht weiser.
Wobei hinter den dichten Scotch-Schwaden durchaus Weisheit zu finden war.
Ruth widmete sich wieder ihrem Mittagessen aus Scotch und Chips. Das Notizbuch auf dem Tisch enthielt zwischen den verknitterten Seiten weder Reime noch kluge Gedanken, sondern den Kloß im Hals.
Sie sah aus dem Fenster, dann schrieb sie:
Scharf wie Eissplitter
durchstoßen die Schreie der Kinder den Himmel
Neben Ruth auf dem Sofa schimpfte Rosa: »Fuck, fuck, fuck.« Vielleicht war es auch: »Quak, quak, quak.« Aber wer Rosa kannte, wusste, dass »Fuck« wahrscheinlicher war.
Graziös streckte Rosa ihren langen Hals vor und pickte behutsam einen Chip aus der Schüssel, während Ruth durch das Fenster zusah, wie die Kinder auf ihren Schlitten von der kleinen Kirche zum Dorfanger sausten. Sie notierte:
Oder in der schneekappigen Dorfkirche
sich schließlich hinknien und
beten um das, was wir nicht haben konnten.
Das Essen wurde serviert. Clara und Myrna hatten beide Heilbutt mit Senfsamen, Curryblättern und gegrillter Tomate bestellt. Für seinen Lebensgefährten Gabri hatte Olivier Moorhuhn mit gegrillten Feigen und Blumenkohlpüree zubereitet.
»Ich werde den Premierminister einladen«, sagte Gabri. »Er könnte den Karneval eröffnen.«
Jedes Jahr lud er Justin Trudeau ein. Und nie bekam er eine Antwort.
»Vielleicht könnte er auch am Rennen teilnehmen?«, fragte Clara.
Gabri sah sie groß an.
Justin Trudeau. Der um den Dorfanger lief. In einer Speedo-Badehose.
Das Gespräch verlor merklich an Niveau.
Myrna war nicht mit dem Herzen dabei und auch nicht mit dem Kopf, selbst wenn sie sich einen Moment lang Trudeau vorstellte, bevor sie wieder an den zusammengefalteten Brief in ihrer Tasche dachte.
Was würde passieren, wenn sie nicht hinfuhr?
Die Sonne färbte den Schnee draußen rosa und blau. Kreischende Kinder, die auf ihren Schlitten den Hügel hinunterrasten, waren zu hören, schwindlig von dieser unwiderstehlichen Mischung aus Vergnügen und Angst. Alles wirkte so idyllisch.
Aber.
Aber wenn der Zufall oder das Schicksal es so wollte und man weit weg von zu Hause von sich zusammenballenden Wolken überrascht wurde, der Schneefall zum Schneesturm wurde, dann sah es schlecht aus.
Ein Québecer Winter, so heiter und friedlich, konnte sich gegen die Menschen wenden. Konnte töten. Und das tat er jedes Jahr. Männer, Frauen, Kinder, die im Herbst noch lebten, sahen den Schneesturm nicht kommen und erlebten den Frühling nicht mehr.
Der Winter auf dem Land war ein prachtvoller, herrlicher, glänzender Mörder.
Québecer mit grauen Haaren und faltigen Gesichtern erreichten dieses Alter nur, weil sie klug, vernünftig und vorsichtig genug waren, nach Hause zu gehen. Und den Schneesturm von einem munter brennenden Kamin aus zu betrachten, in der Hand eine heiße Schokolade oder ein Glas Wein und ein gutes Buch.
Es gab nur wenig, was beängstigender war, als bei einem Schneesturm im Freien zu sein, aber es gab auch nur wenig, was heimeliger war, als währenddessen drinnen zu sein.
Wie bei so vielem im Leben lag zwischen Wohl und Wehe nur eine Handbreit, das wusste Myrna.
Während Gabri und Clara über die Vorzüge von All-inclusive-Resorts gegenüber normalen Hotels und Kreuzfahrten redeten, dachte Myrna über den Brief nach und beschloss, die Entscheidung dem Schicksal zu überlassen.
Wenn es schneite, würde sie zu Hause bleiben. Wenn nicht, würde sie fahren.
Und jetzt saß Myrna zusammen mit dem seltsamen Notar und dem verrückten jungen Handwerker in der seltsamen Küche an dem seltsamen Tisch, sah in den immer heftiger fallenden Schnee hinaus und dachte:
Scheißschicksal. Wieder mal reingelegt.
»Myrna hat recht«, sagte Armand und legte eine große Hand auf das Testament. »Wir müssen erst entscheiden, ob wir das überhaupt machen wollen.« Er sah die anderen beiden an. »Was meint ihr?«
»Können wir das Ding erst mal lesen?«, fragte Benedict und deutete auf das Testament. »Und uns dann entscheiden?«
»Nein«, sagte der Notar.
Myrna stand auf. »Wir sollten darüber reden. Unter uns.«
Armand ging um den Tisch, beugte sich zu Benedict, der immer noch dasaß, und sagte leise: »Sie können sich gerne zu uns gesellen.«
»Ja, klasse. Gute Idee.«