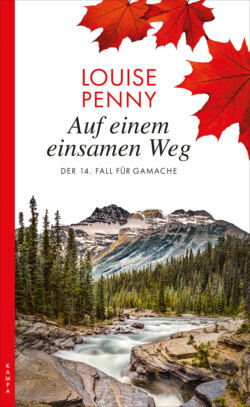Читать книгу Auf einem einsamen Weg - Louise Penny - Страница 11
9
ОглавлениеReine-Marie, die Augen zwischen Schlafen und Wachen halb geöffnet, tastete unter der Decke nach Armand, fuhr mit der Hand über die Matratze.
Aber die andere Seite war kalt. Nicht nur leicht abgekühlt. Kalt.
Sie öffnete die Augen ganz und sah sanftes Morgenlicht durch die Fenster fallen.
Im Holzofen züngelten Flammen. Das Feuer war vor Kurzem geschürt worden.
Sie richtete sich auf einem Ellbogen auf. Die Küche war leer. Nicht einmal Ruth und Rosa waren zu sehen. Genauso wenig wie Henri und Gracie.
Sie zog Morgenmantel und Hausschuhe an und probierte den Lichtschalter aus. Immer noch kein Strom. Dann bemerkte sie einen Zettel auf dem Küchentisch.
Ma chére,
Ruth, Rosa, Henri, Gracie und ich sind im Bistro, um mit Olivier und Gabri zu reden. Komm doch nach.
Armand
(6.50 Uhr)
Reine-Marie sah auf ihre Uhr. Es war 7.12 Uhr.
Sie trat ans Fenster. Der Schnee reichte inzwischen bis auf halbe Höhe der Scheiben, verschluckte den Großteil des Lichts und nahm ihr die gesamte Sicht. Allerdings konnte Reine-Marie erkennen, dass sich der Schneesturm gelegt hatte und, wie es nach heftigen Stürmen oft der Fall war, einem strahlenden Tag gewichen war.
Auch wenn das, wie jeder echte Québecer wusste, eine Illusion war. Die Sonne bleckte nur die Zähne.
»Mein Gott«, stieß Reine-Marie hervor, als die Wärme des Bistros sie umfing. »Warum leben wir eigentlich hier?«
Ihre Wangen waren gerötet, und ihre tränenden Augen brauchten etwas Zeit, um sich an das Dämmerlicht zu gewöhnen. Der kurze Weg zum Bistro durch den grellen Sonnenschein hatte sie beinahe schneeblind werden lassen. Es reichte offenbar nicht, dass der bitterkalte Winter sie umbringen wollte, vorher musste er ihr noch das Augenlicht rauben.
»Minus fünfunddreißig«, verkündete Olivier stolz, als wäre das sein Werk.
»Aber es ist eine trockene Kälte«, sagte Gabri. »Und kein Wind.«
Das war der übliche Spruch, mit dem sie sich zu trösten versuchten, wenn sie in einen zugleich einladenden und erbarmungslosen Tag hinausblickten.
»Ich rieche etwas«, sagte Reine-Marie, nachdem sie Jacke, Mütze und Handschuhe ausgezogen hatte.
»Ich bin’s nicht«, sagte Ruth. Rosa blickte allerdings ein wenig verlegen drein. Wobei Enten das oft taten.
»Ich habe mich gefragt, warum ihr beide euch trotz der Kälte hierhergewagt habt«, sagte Reine-Marie, ihrer Nase zu dem Tisch mit den leeren, mit Ahornsirup verschmierten Tellern folgend.
Armand zuckte übertrieben lässig mit den Schultern. »Manche Dinge sind es eben wert, Leib und Leben dafür zu riskieren.«
Olivier kam aus der Küche, in der einen Hand einen Teller mit warmen Heidelbeer-Pfannkuchen, Würstchen und Ahornsirup, in der anderen einen Café au lait.
»Wir haben dir was aufgehoben«, sagte Gabri.
»Armand hat uns dazu gezwungen«, sagte Ruth.
»Himmlisch«, sagte Reine-Marie, setzte sich und legte die Hände um den Becher. »Merci.« Dann fiel ihr etwas ein. »Habt ihr schon wieder Strom?«
»Nein. Aber einen Generator.«
»An den die Espressomaschine angeschlossen ist?«
»Und der Herd und der Kühlschrank«, sagte Gabri.
»Aber nicht die Lampen?«
»Man muss Prioritäten setzen«, sagte Olivier. »Willst du dich etwa beschweren?«
»Mon Dieu, nein.«
Sie blickte zu Armand. Bei allem Geplänkel wusste sie, dass ihr Mann eine alte Frau nicht ohne Grund hinaus in die grimmige Kälte schleppen würde.
»Du bist nicht nur wegen der Crêpes mit Ruth hierhergekommen.«
»Nein«, sagte er. »Ruth weiß, wer Bertha Baumgartner war.«
»Warum hast du uns das nicht schon gestern Abend gesagt?«
»Weil es mir erst heute Morgen eingefallen ist. Und selbst da war ich mir nicht ganz sicher.«
Reine-Marie hob die Augenbrauen. Es sah Ruth gar nicht ähnlich, sich ihrer selbst nicht völlig sicher zu sein. Zweifel hatte sie immer nur bei anderen.
»Ich wollte mit Gabri und Olivier reden, um zu hören, was sie meinen«, sagte Ruth.
»Und?«
»Hast du schon mal was von der Baronin gehört?«, fragte Gabri und setzte sich neben Reine-Marie.
Sie meinte sich schwach zu erinnern. Wie die Erinnerung an eine Erinnerung. Aber so fern, dass sie niemals darauf kommen würde.
Sie schüttelte den Kopf.
»Wir wurden ihr vorgestellt, als wir hierhergezogen sind«, sagte Olivier. »Vor vielen Jahren. Von Timmer Hadley.«
»Der Besitzerin des alten Hadley-Hauses«, sagte Reine-Marie.
Sie deutete in Richtung des stattlichen Hauses, das auf dem Hügel über dem kleinen Dorf thronte. Das Haus, in dem einst die »reichen Leute« gewohnt und auf das gemeine Fußvolk im Tal heruntergeblickt hatten.
»Ich habe die Baronin bei Timmer kennengelernt«, sagte Ruth.
»Und zu uns ist sie auch gekommen«, sagte Gabri. »Als wir die Pension aufgemacht haben.«
»Als Gast? Als Freundin?«, fragte Reine-Marie.
»Als Putzfrau.«
»Beeilen Sie sich«, rief Myrna und zog an Benedicts Arm.
Mercier war schon ein paar Schritte weitergegangen, aber Benedict war stehen geblieben, und Myrna hatte umkehren müssen, um ihn zu holen.
Es war, als würde sie zurück in ein in Flammen stehendes Gebäude laufen.
Ihr Gesicht war so kalt, dass die Haut brannte. Die Kälte war sogar durch ihre dicken Handschuhe gedrungen und biss sie in die Finger. Das grelle Sonnenlicht tat in den Augen weh.
Doch statt sich wie jeder vernünftige Québecer schnell ins Bistro zu flüchten, war Benedict stehen geblieben. Der Zipfel seiner rot-weißen Mütze hing bis auf den Boden, während er mit dem Rücken zu den Geschäften dastand und wie gebannt auf die drei riesigen schneebeladenen Kiefern und die Häuser rings um den Dorfanger blickte.
»Das ist wunderschön.«
Seine Worte kamen in einem Wölkchen aus seinem Mund, wie eine Sprechblase in einem Comic.
»Ja, ja, wunderschön«, sagte Myrna und zerrte an seinem Arm. »Jetzt kommen Sie endlich, oder muss ich Ihnen erst einen Tritt geben?«
Da sie gestern mitten im Schneesturm angekommen waren, sah Benedict Three Pines jetzt praktisch zum ersten Mal. Die alten Häuser. Den aus den Schornsteinen aufsteigenden Rauch. Die Hügel und Wälder.
Er stand da und bestaunte ein Panorama, das sich seit Hunderten von Jahren nicht verändert hatte.
Und dann wurde er weggezerrt.
Ein paar Minuten später war im Bistro ein weiterer Tisch vor das Kaminfeuer geschoben, und vor Myrna und Benedict stand ein Frühstück.
Inzwischen hatte sich auch Clara eingefunden.
»Wenn es beim Karneval auch so kalt ist, ziehe ich mich nicht aus«, sagte sie und rieb sich die Arme.
»Wie bitte?«, sagte Armand.
»Egal«, sagte Gabri. »Nicht wichtig.«
»Worüber habt ihr gerade geredet?«, fragte Clara und nahm einen Becher heißen Kaffee entgegen. »Ihr habt alle so betroffen ausgesehen.«
»Ruth ist dahintergekommen, wer Bertha Baumgartner war«, sagte Armand.
»Und?«
»Erinnerst du dich an die Baronin?«, fragte Gabri.
»Ja, klar. Wer könnte die vergessen?«
Clara ließ ihre Gabel sinken, und ihr Blick kreuzte sich mit dem von Ruth.
Dann ließ sie ihn weiter zu den Fenstern wandern. Aber sie sah nicht die Sonne, die auf die Eisblumen an den Scheiben schien. Sie sah nicht das unter tiefem Schnee begrabene Dorf und den unglaublich klaren blauen Himmel.
Sie sah eine rundliche ältere Frau mit kleinen Augen, einem breiten Lächeln und einem Mopp, den sie schwenkte wie ein Polarforscher, der im Begriff ist, seine Flagge zu setzen.
»Sie hieß Bertha Baumgartner?«, fragte sie.
»Du hast ja wohl nicht ernsthaft angenommen, dass sie ›Baronin‹ hieß, oder?«, gab Ruth zurück.
Clara runzelte die Stirn. Im Grunde genommen hatte sie nie darüber nachgedacht.
»Weißt du, warum sie Baronin genannt wurde?«, fragte Armand.
Sie sahen Ruth an.
»Woher zum Teufel soll ich das wissen? Sie hat nie für mich gearbeitet.« Sie blickte zu Myrna. »Außer dir hatte ich nie eine Putzfrau.«
»Ich bin keine –«, setzte Myrna an, dann sagte sie: »Ach, egal.«
»Warum glaubst du dann, dass diese Bertha die Baronin ist?«, fragte Armand.
»Du hast doch gesagt, dass sie an der Straße nach Mansonville gewohnt hat?«, fragte Ruth, und er nickte. »Ein altes Farmhaus in der Nähe des Glen?«
»Ja.«
»Ich habe die Baronin mal da abgesetzt, als ihr Auto kaputt war, ist schon Jahre her«, sagte Ruth. »Scheint mir dieselbe Adresse zu sein.«
»Wie sah es aus? Kannst du dich erinnern?«
Natürlich konnte Ruth sich an alles erinnern.
Jedes Essen, jeden Drink, jeden Blick, jede Kränkung, echt, eingebildet und erfunden. Jedes Kompliment. Jedes gesprochene und unausgesprochene Wort.
All das formte sie um und verwandelte die Erinnerungen in Gefühle und die Gefühle in Gedichte.
Ich betete darum, gut und stark und klug zu sein,
um mein täglich Brot, und Vergebung
der Sünden, die von Geburt an mein sein sollen,
und der Schuld eines uralten Erbes.
Armand musste nicht lange darüber nachdenken, warum ihm gerade dieses Gedicht von Ruth, eins von ihren unbekannteren, in den Sinn kam.
»Das Haus war klein, ein bisschen verwinkelt, aber gemütlich«, sagte Ruth. »Kästen mit Stiefmütterchen vor den Fenstern und Blumenkübel links und rechts von der Treppe. Eine Katze, die sich gesonnt hat. Im Hof standen alle möglichen Fahrzeuge und landwirtschaftlichen Geräte rum, aber das ist auf alten Bauernhöfen ja immer so.«
Nachdem Armand das krumme Haus vom Schnee befreit und es geradegerückt hatte, konnte er es beinahe vor sich sehen. So wie es einmal gewesen war. An einem warmen Sommertag. Mit einer jüngeren Ruth und der Baronin.
»In letzter Zeit habt ihr sie nicht gesehen?«, fragte er.
»Seit Jahren nicht mehr«, sagte Gabri. »Sie hat aufgehört zu arbeiten, und wir haben den Kontakt verloren. Ich habe nicht mal mitbekommen, dass sie gestorben ist. Du?«
Clara schüttelte den Kopf und senkte den Blick.
»Meine Mutter war Putzfrau«, sagte Reine-Marie, die das, was in Clara vorging, richtig interpretierte. »Sie entwickelte eine enge Beziehung zu den Familien, für die sie arbeitete, solange sie für sie arbeitete. Aber danach verlor sie sie aus den Augen. Ich bin sicher, dass viele der Leute gestorben sind, ohne dass sie es wusste.«
Clara nickte, dankbar für den unausgesprochenen Hinweis darauf, dass so etwas von beiden Seiten ausging.
»Meinst du, wenn die Baronin Justin schreiben würde –«, setzte Gabri an.
»Nein.«
»Wie war sie?«, fragte Armand.
»Eine starke Persönlichkeit«, antwortete Olivier. »Sie hörte sich gern selbst reden. Sprach immer viel von ihren Kindern.«
»Zwei Jungen und ein Mädchen«, sagte Gabri. »Die tollsten Kinder der Welt. Wohlgeraten. Hübsch. Klug und freundlich. Wie ihre Mutter, sagte sie immer und lachte.«
»Und sie erwartete, dass wir sagten: ›Lachen Sie nicht, das stimmt.‹«, sagte Olivier.
»Und, habt ihr?«, fragte Reine-Marie.
»Wenn wir ein sauberes Haus wollten, ja«, sagte Gabri.
Clara sah die Baronin bei dieser Beschreibung vor sich. Meistens mit einem Lächeln. Manchmal herzlich und freundlich. Hin und wieder auch irgendwie listig. Aber niemals böswillig.
Es gab wohl kaum eine Frau, die weniger Ähnlichkeit mit einer Baronin hatte.
Clara erinnerte sich aber auch daran, wie energisch die Baronin Schrubber und Besen geschwungen hatte. Wie stolz.
Es hatte etwas Aristokratisches.
Clara fragte sich, warum es ihr nie in den Sinn gekommen war, die Baronin zu malen. Ihre kleinen funkelnden Augen, freundlich und fordernd zugleich. Listig, aber auch nachdenklich. Ihre abgearbeiteten Hände und das müde Gesicht.
Ein bemerkenswertes Gesicht, es spiegelte Großzügigkeit und Zorn wider. Herzlichkeit und Voreingenommenheit.
»Warum fragst du?«, erkundigte sich Gabri. »Spielt das eine Rolle?«
»Eigentlich nicht«, sagte Armand. »Es ist nur so, dass ihre testamentarischen Verfügungen ein bisschen seltsam sind.«
»Oooh, seltsam«, sagte Gabri. »Das gefällt mir.«
»Du meinst skurril«, sagte Ruth. »Seltsam kannst du nicht ausstehen.«
»Stimmt«, gab er zu. »Also, was ist an dem Testament seltsam?«
»Das mit dem Geld«, sagte Benedict.
»Geld?«, wiederholte Olivier und beugte sich vor.
Mercier berichtete ihnen, was die Baronin verfügt hatte.
Oliviers Gesichtsausdruck wechselte von Verblüffung zu Belustigung und wieder zurück zu Verblüffung.
»Fünfzehn Millionen? Dollar?« Er blickte zu Gabri, der ebenfalls mit offenem Mund dasaß. »Wir hätten in Kontakt bleiben sollen.«
»Ja«, sagte Mercier, erfreut über die Reaktion. »Und ein Haus in der Schweiz.«
»Und eins in Wien«, sagte Myrna.
»Ein bisschen schräg war sie ja immer«, sagte Gabri, »aber irgendwann muss sie völlig durchgedreht sein.«
»Nein. Mein Vater hätte niemals zugelassen, dass sie dieses Testament unterschreibt, wenn er sie für unzurechnungsfähig gehalten hätte.«
»Ach kommen Sie«, sagte Ruth. »Selbst mir ist klar, dass das irre ist. Nicht nur das mit dem Geld, sondern auch drei völlig unbekannte Leute als Testamentsvollstrecker einzusetzen. Warum niemanden von uns?«
Armand sah der Reihe nach Gabri, Olivier, Ruth und Clara an.
Sie hatten sie gekannt. Und auch wieder nicht.
Sie kannten die Baronin. Nicht Bertha Baumgartner.
War das der Grund?
Myrna und er waren unvoreingenommen. Sie sahen sie einfach als Frau, nicht als Putzfrau, und ganz sicher nicht als Baronin.
Aber warum sollte das eine Rolle spielen?
Vielleicht lag es an ihren Berufen. Er war Polizist, Ermittler. Myrna war Psychologin. Sie konnte in Menschen hineinschauen. Sie konnten es beide. Aber auch hier stellte sich die Frage, welche Rolle das für Madame Baumgartner bei der Erfüllung ihres Testaments gespielt haben sollte?
Und woher wusste sie überhaupt von ihnen, wenn sie sie nicht kannten?
Und was war mit …? Armand drehte sich zu Benedict. Wie passte er als Testamentsvollstrecker in die Runde?
»Wer waren die Zeugen?«, fragte er an den Notar gerichtet.
»Nachbarn«, sagte Mercier. »Allerdings dürften sie vom Inhalt des Testaments keine Ahnung gehabt haben.«
Armand sah auf seine Uhr. Kurz vor halb neun. Sie waren noch immer ohne Strom, aber ihr winziges Dorf gehörte oft zu den Letzten, an die sich Hydro-Québec erinnerte.
»Musst du los?«, fragte Reine-Marie, der die Unterhaltung vom Abend zuvor wieder einfiel.
»Ich fürchte, ja.«
»Was ist mit uns?«, fragte Mercier.
»Ich fahre Sie zum Farmhaus. Wir können Ihre Autos gemeinsam freischaufeln.«
»Die Erben müssen benachrichtigt werden«, sagte Mercier. »Ich werde versuchen, ein Treffen für heute Nachmittag zu vereinbaren. Es hat keinen Sinn zu warten.«
»Klingt gut«, sagte Benedict.
Armand nickte. »Geben Sie mir einfach Bescheid, wann und wo.«
Die Schuld eines uralten Erbes, dachte er, als er zu seinem Auto ging und bei jedem Schritt seine Stiefel auf dem hartgefrorenen Schnee knirschten.
War es das, was sich in dem baufälligen Farmhaus verbarg? Schuld und Sünden, die von Geburt an da gewesen waren?