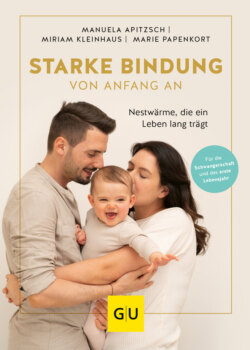Читать книгу Starke Bindung von Anfang an - Manuela Apitzsch - Страница 12
AUCH URVERTRAUEN MUSS WACHSEN
ОглавлениеGerade in den ersten sechs Lebensmonaten braucht ein Säugling viel Geborgenheit. Man kann sich das tatsächlich so vorstellen, als ob ein Ei noch bebrütet werden muss. Das Baby benötigt Nestwärme. Während dieser ersten Entwicklungsphase stehen die körperlichen Bedürfnisse im Vordergrund: Hunger, Durst, Schlaf, das Bedürfnis nach Sicherheit, Wärme und Zuwendung. In der Regel ist jetzt die Mama die Hauptbindungsperson. Während der Stillzeit ist sie diejenige, die sich vor allem um ihr Baby kümmert. Das Neugeborene, so nehmen wir an, fühlt sich in der allerersten Zeit eins mit der Mutter. Es kann noch gar nicht richtig unterscheiden, wo es selbst anfängt und wo die Mama aufhört. Es ist mit seiner Mama verschmolzen – so wie in der Schwangerschaft.
Auch in der darauffolgenden Zeit ist das Baby emotional aufs Engste mit seinen Bezugspersonen verbunden. Sobald es sich mit circa sieben Monaten selbst fortbewegen kann, hat es zugleich auch die Möglichkeit, sich von den Eltern wegzubewegen und die Welt zu erkunden. Zum Bindungsverhalten kommt der Erkundungswille hinzu, das sogenannte Explorationsverhalten. Das Baby zeigt Initiative: Es greift nach Dingen und steckt sie sich in den Mund. Es robbt oder krabbelt von der Küche in den Flur oder zieht an Mamas Halskette oder Papas Brille. Das Baby erfährt sich, nehmen wir an, auf einer unbewussten Gefühlsebene erstmalig als steuerndes Selbst. Man könnte auch sagen, dass das Kind als Person erst jetzt wirklich aus dem Ei herausgeschlüpft ist, weshalb die Kinderärztin und Psychoanalytikerin Margaret Mahler (1897–1985) diese Phase tatsächlich »Schlüpfphase« (Differenzierungsphase) genannt hat. Eingepackt in Windeln, erkundet das kleine Kind unermüdlich seine Umgebung.
Sind die Bezugspersonen in der Lage, sowohl die Bindungs- als auch Erkundungsbedürfnisse ihres Kindes einigermaßen gut zu erfüllen, entwickelt sich Urvertrauen. Das Kind lernt, dass die Welt – im Großen und Ganzen – ein vertrauenswürdiger Ort ist und dass sich die Dinge schon zum Guten entwickeln werden. Damit Eltern diese Bedürfnisse überhaupt erfüllen können, müssen sie lernen, ihr Baby zu »lesen«. Und sie sollten sehr aufmerksam sein, um die feinsten Körperveränderungen wie zum Beispiel Veränderungen in der Muskelspannung mitzubekommen.
Der Säugling kommuniziert nonverbal, also ohne sprechen zu können, allein durch Lächeln, Brabbeln, Weinen, erwartungsfrohes Zappeln, Saugen und Anschmiegen. Die versorgenden Erwachsenen versuchen, sich in das Baby einzufühlen, die Signale richtig zu deuten – und bekommen Feedback. Hört es auf zu schreien, wenn ich ihm die Brust gebe? Schläft es ein, wenn ich es herumtrage? Liegen Eltern (meistens) richtig, entsteht so eine befriedigende Eltern-Kind-Interaktion, welche in besonderem Maße unsere spätere Bindungsfähigkeit prägt. Schließlich wird uns schon ganz früh – tatsächlich mit der Bildung der Muttermilch – vermittelt: »Deine Bedürfnisse sind wichtig. Du wirst gehört. Du bist geschützt. Du wirst geliebt.«
Aus diesem Grund ist es auch keine Option, das Baby einfach schreien zu lassen. Entgegen veralteter Annahmen kann man kleine Babys nicht verwöhnen. In der Generation unserer Groß- und Urgroßeltern war es noch ganz normal, Kinder nach einem festen Zeitplan zu versorgen und sie zwischendrin schreien zu lassen. Alle vier Stunden gab es ein Fläschchen und eine frische Windel. Kinder darf man nicht zu sehr verzärteln, hieß es. Dabei besteht gar keine »Gefahr«, den Säugling zu verwöhnen. Die kleinen Wesen schreien nicht grundlos und schon gar nicht, um uns zu ärgern. Kein Baby weint, weil es ihm Spaß macht oder es seine Eltern auf die Palme bringen will. Weinen ist am Anfang einfach eine Möglichkeit, die dem Säugling zur Verfügung steht, um sich mitzuteilen. Er sichert so sein Überleben. Er sagt zu Mama und Papa: »Lasst mich nicht liegen. Verlasst mich nicht. Denkt daran, dass ich Hunger habe.«