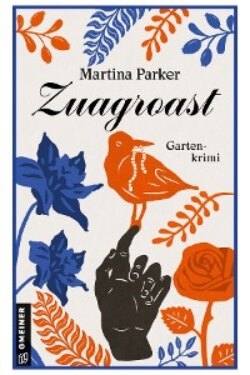Читать книгу Zuagroast - Martina Parker - Страница 11
Kapitel 4
Johannas Kräuterstammtisch
ОглавлениеIn Asien gibt es Mönche und Nonnen, deren Philosophie es ist, niemandem wehzutun, auch nicht den kleinsten Wesen auf diesem Planeten, weder in Gedanken, Worten noch Taten. Die Anhänger des Jainismus tragen stets einen Mundschutz, damit sie nicht versehentlich Insekten verschlucken, und fahren mit Staubwedeln über den Boden, bevor sie diesen betreten, um keine Insekten zu zerquetschen.
Echtes Blau ist im Gartenreich schwer zu finden. Eine Tatsache, mit der sich auch Johanna plagte. In der Mitte ihres »blauen Beetes« thronte eine Bauernhortensie, die zwar hellblau aufblühte, aber dann immer wieder beharrlich in ein schmutziggraues Lila umschwenkte.
Johanna hatte schon mit allerlei Listen versucht, die Pflanze umzustimmen. Sie hatte rund um den Wurzelstock Alaun und rostige Nägel vergraben, Essig ins Gießwasser gegeben und die Staude mit Rhododendronerde angehäufelt. Mal hatte sie dabei mehr, mal weniger Erfolg. Aber erst wenn der Herbst kam und die Blüten zusehends grüner wurden, war das Ringen um die richtige Farbe vorbei, und Johanna war wieder versöhnt – bis zum nächsten Jahr.
Unberechenbar waren auch die Akeleien, die sich im blauen Beet selbst aussäten. Denn immer wieder schlich sich unter den blauen Akeleien eine rosafarbene ein, die, sobald sie Farbe bekannte, von Johanna an eine andere Stelle des Gartens verpflanzt wurde. Sie einfach auszurupfen und auf den Komposthaufen zu werfen, hätte sie nie übers Herz gebracht. Johanna liebte diese Feenblumen seit ihrer frühesten Kindheit.
Als Zehnjährige hatte sie sich immer in den Nachbarsgarten geschlichen. Ihre Eltern bezeichneten dieses Stück Land als verwildert, Johanna als verwunschen.
Der verwunschene Garten gehörte zu einem Wochenendhaus, das reichen Wienern gehörte, die nur zwei- bis dreimal im Jahr herunter in den Süden kamen und deshalb die Blumenschönheiten, die hier neben Giersch und Ackerwinden gediehen, nur selten zu Gesicht bekamen. Johanna genoss deren Anblick dafür umso mehr. Die Akeleien sahen genauso aus wie die Blumen in den Illustrationen in Johannas Märchenbüchern – glockenförmige Blüten, auf denen Feen und Waldgeister schaukelten. Johanna liebte die Akeleien der Nachbarn, und manchmal bildete sie sich sogar ein, eine Fee zu sehen. In ihren Träumen war sie die Herrin dieses Zaubergartens. Jetzt, 40 Jahre später, hatte sie ihr eigenes magisches Gartenreich geschaffen und genoss es. Jedenfalls solange sie an der richtigen Stelle Blau sah.
Eigentlich war Johanna nur an einer einzigen Pflanze gescheitert, und das war ausgerechnet die, wegen der sie das blaue Beet ursprünglich geplant und angelegt hatte: dem Rittersporn.
Die blaue Staude war fixer Bestandteil jedes englischen Cottagegartens. Aber der südburgenländische Lehmboden war anscheinend nicht das richtige Substrat für den Rittersporn.
Johanna war keine, die schnell aufgab, aber irgendwann musste auch sie erkennen, beim Gärtnern galt die Regel: Standort ist alles. »20 Jahre bin ich beim Versuch, Rittersporn im Südburgenland anzupflanzen, gescheitert«, erzählte sie gerne ihren Gartenbesuchern. Denn egal ob gekaufte Pflanzen, geschenkte Ableger oder Pflänzchen, die sie selbst aus Samenkörnern zog, bei Johanna mochte der Rittersporn einfach nicht sein. Nicht einmal die wunderschöne zierliche Wildform, die sie jahrelang von einer Freundin überreicht bekommen hatte, hatte im burgenländischen Lehmboden überlebt. »Jojo, des Südburgenland, dei Stroßn san aus Luam, owa dahuam is dahuam.«9 Die Strophe aus dem Mundartgedicht hätte passender nicht sein können.
Irgendwann hatte auch Johanna eingesehen, dass die Natur am längeren Ast saß, und ersetzte den Rittersporn durch den robusten, aber giftigen Eisenhut. »Der passt sowieso besser zu mir«, scherzte sie dann. Sie spielte auf ihren kräftigen Körperbau und ihre resolute Art an. Letztere legte sie aber nur an den Tag, wenn ihr jemand wirklich »blöd daherkam«.
Im Grunde ihres Herzens war Johanna ein gutmütiger und großherziger Mensch.
Wenn sie nicht in ihrem Garten anzutreffen war, war sie in ihrem Geschäft gleich nebenan. Das Geschäft war eine Mischung aus Bauernladen und Gemischtwarenhandlung. Johanna nahm sich den Luxus heraus, neben Brot, Fleisch, Milch, Eiern und Gemüse auch das zu verkaufen, was ihr selbst gefiel. Mit Pflanzenfarbe gefärbte Schafwolle und originelle Keksausstecher, handgebundene Rosshaarbesen, lokales buntes Keramikgeschirr, Tischtücher aus Bauernleinen und dazu jede Menge Kramuri.
Wäre Johannas Hofladen in der Stadt gewesen, wäre sie damit wahrscheinlich reich geworden, aber hier in dem 300-Seelen-Dorf waren die meisten Kunden Pensionisten, die kein Auto hatten, um in den nächstgelegenen Supermarkt zu fahren. Und der Bedarf der Alten an Geschirr, Besen und Keksausstechern war längst gedeckt. Sie kamen für einen Laib Brot oder einen Liter Milch oder einfach nur zum Tratschen. Johanna störte das nicht. Sie hatte sogar einen kleinen Tisch und ein paar grün lackierte Sessel neben die Budel gestellt, damit sich die Besucher zum Tratschen hinsetzen konnten. Denn zum Tratschen kamen sie alle.
Weil man im Südburgenland jeden Besucher bewirtet, stellte sie ihren Stammkunden auch immer eine Kanne mit Kaffee oder einen Tee aus selbstgepflückten Kräutern und eine Mehlspeise hin. Dafür verrechnete sie natürlich nichts. Eine Tatsache, die der Finanzbeamte aus Oberwart bei einer Kontrolle fassungslos zur Kenntnis genommen hatte. Erst hatte er ihr nicht geglaubt und wollte eine Gastgewerbekonzession sehen, dann hatte er geglaubt, sie wolle ihn bestechen, weil Johannas warmer gedeckter Mürbteigapfelkuchen gar so gut war. Aber die hatte ihn nur ausgelacht.
Die Umsätze in Johannas Hofladen hielten sich in bescheidenen Grenzen, aber sie fühlte sich trotzdem reich, auch wenn andere das nicht verstanden. »Man ist glücklich, wenn man ein bisschen mehr hat, als man braucht, und wenn man nicht so viel hat, muss man halt ein bisschen weniger brauchen«, war ihr Motto.
Obwohl sie nur wenig Geld zur Verfügung hatte, wusste sie mit Geschick und Beziehungen das Beste daraus zu machen. Die Möbel in ihrem Geschäft waren vom Flohmarkt, das Gewächshaus war aus alten Fenstern selbst gebaut, und auch die Wege durch ihren Garten hatte sie mit alten verwitterten Steinen selbst verlegt, dazwischen wuchsen Teppichthymian und Rasenkamille, die sie selbst ausgesät hatte. Und Gemüse pflanzte sie statt in teuren Hochbeeten in ausgedienten Badewannen. Samen und Ableger verschenkte sie genauso freigiebig, wie sie ihr Gartenwissen mit anderen teilte.
Soll ich meine Rosen im Frühling oder im Herbst schneiden? Was mache ich gegen die Blattläuse? Warum haben meine Birnen innen drinnen braune Flecken? Johanna hatte auf alles eine Antwort. »Du solltest einen Gartenstammtisch eröffnen«, hatte irgendwann einer ihrer Stammkunden gesagt. Und irgendwie hatte sie der Gedanke nicht losgelassen. Ein regelmäßiges Treffen mit interessierten Gleichgesinnten, bei dem man Wissen und Samen austauschen konnte, gemeinsame Gartenausflüge machte … Das klang wunderbar.
Am nächsten Tag war Johanna zu ihrem Onkel gegangen, der bei einer Druckerei arbeitete, und hatte Flyer drucken lassen und zum ersten Stammtisch des »Klubs der Grünen Daumen« eingeladen. Jetzt stand sie supernervös in ihrem Hofladen und flehte innerlich, dass zumindest irgendwer kommen würde.
*
Kreisverkehre, überall Kreisverkehre. Als Vera hier im Südburgenland in die Schule gegangen war, hatte es die noch nicht gegeben. Jetzt schien das ganze Landstraßennetz voll davon zu sein. Bis zu einer Million Euro kostet die Errichtung eines Kreisverkehrs, hatte Vera einmal gelesen. Eigentlich unglaublich, dass ein paar Quadratmeter Asphalt so teuer waren. Hier im Bezirk mussten mittlerweile zig Millionen in die Erde versenkt worden sein.
Es gab sogar einen zweispurigen Turbokreisverkehr vor dem Einkaufszentrum am Stadtrand. Aber der schien den Verkehr manchmal eher zum Stocken als zum Fließen zu bringen. Vera wäre fast auf das Auto eines Pensionisten aufgefahren, der nach der Einfahrt in das Rondeau scharf abbremste, statt turbomäßig die Kurve zu nehmen. Jetzt stand der Wagen des Mannes in der Mitte der beiden Fahrbahnen. Der Lenker blinkte verwirrt einmal links und einmal rechts. Andere Fahrzeuge begannen zu hupen. Vera hatte Mitleid mit dem alten Mann. Als dieser den Führerschein gemacht hatte, war der korrekte Spurwechsel in einem millionenteuren Turbokreisverkehr sicher noch kein Thema gewesen.
Sie war spät dran. Heute war dieser Gartenstammtisch in Johannas Hofladen, für den sie sich angemeldet hatte. Beim Betreten des Hofladens wusste Vera sofort, welche von den Frauen in der Gruppe Johanna war. Die kleine, stämmige Frau mit den rotbraunen Locken und den wachen grünen Augen strahlte einfach eine natürliche Kompetenz aus, die sie sofort als Hausherrin offenbarte.
»Entschuldigt bitte mein Zuspätkommen … der Verkehr.« Vera biss sich auf die Zunge. Durfte man auf dem Land den Verkehr als Ausrede verwenden oder klang das blöd? »Ich meine, der Kreisverkehr.« Okay, das klang jetzt noch blöder. Zum Glück ignorierten die anderen ihre Verlegenheit.
Sie nutzte die Begrüßungsrunde, die nun folgte, um die anwesenden Frauen ausgiebig zu mustern. Was für ein bunter Haufen. Johanna trug dunkelgrüne Gummistiefel und eine giftgrüne Tunika. Farben, die ihre roten Haare noch mehr zum Leuchten brachten.
Neben ihr stand eine große, schlaksige Frau, die sich als Isabella vorstellte.
»Sie ist Kräuterpädagogin und führt die Drogerie in Pinkafeld«, erklärte Johanna.
Vera wusste nicht, was eine Kräuterpädagogin war. Inwiefern brauchten Kräuter eine Erzieherin? Sie beschloss, das bei nächster Gelegenheit zu recherchieren.
»Mathilde«, sagte eine dritte Frau und reichte Vera die Hand. Sie sah aus wie eine Rockabilly Braut. Als sie Vera die Hand drückte, schob sich der Ärmel der Bluse hoch und gab den Blick auf ein Tattoo frei. Eine Blumengirlande.
»Mathilde ist Köchin im ›Kurfürstenhotel‹ in Bad Tatzmannsdorf«, sagte Johanna.
Vera wusste nicht, ob erwartet wurde, dass auch sie ihren Beruf erklärte. Und was sollte sie sagen? Das Erste, das ihr spontan einfiel, war: geschasste Journalistin mit Schneckenproblem. Während sie noch überlegte, betraten zwei ältere Damen den Laden. Es schienen Stammkundinnen zu sein, denn sie wurden von Johanna herzlich auf südburgenländisch begrüßt. »Jo schau, seids a scho do, kimmts eina und druckts eich glei an Kaffee owi.«10
»Das sind die Grete und die Mitzi.« Sie stellte die Anwesenden einander vor. Dahinter betrat Eva den Raum.
»Super, dass du auch gekommen bist.« Vera freute sich, Eva zu sehen.
»Nachdem wir jetzt vollzählig sind, können wir nun beginnen«, sagte Johanna, hakte auf einer Liste die Namen der Teilnehmerinnen ab und hob den Jahresmitgliedsbeitrag von je drei Euro pro Person ein.
»Das mit dem Klubbeitrag muss leider sein, damit mir der vom Finanzamt keine Probleme macht«, seufzte sie. »Der unterstellt mir ständig, dass ich hier schwarz ein Kaffeehaus führe, drum hab ich das Ganze jetzt gleich als Klub bei der Bezirkshauptmannschaft angemeldet. So hat alles seine Ordnung.«
Reich wird die mit unseren paar Euros eh nicht werden, dachte Vera. Aber um Reichtum schien es Johanna nicht zu gehen. Das erste Thema des Gartenstammtisches war sinnigerweise »Sparsam und nachhaltig Gärtnern«.
Handouts wurden ausgeteilt. Johannas Tipps reichten von Anzuchttöpfen aus Eierkartons und Klopapierrollen über Kaffeesatz als Dünger bis zum Bau einer Rankhilfe für Bohnen aus selbstgeflochtenen Weidenruten.
Jetzt weiß ich endlich, was ich mit den alten Eierkartons mache, die mir die Nachbarn ständig vor die Tür stellen, dachte Eva. Bei Tipp 5, der da lautete »Die Erde eines Maulwurfshügels im Backrohr sterilisieren und dann als Anzuchterde verwenden«, war sie sich hinsichtlich der Umsetzung nicht so sicher. Maulwurfserde im Dampfgarer. Sie wusste genau, wie Paul auf so etwas reagieren würde. »Jetzt bist echt ein Fall für die Psychiatrie«, würde er sagen.
Johanna begann mit ihrem Vortrag: »Am günstigsten fahrt ihr, wenn ihr mit dem Kreislauf der Natur gärtnert. Baut nur samenfeste Sorten an, keine Hybride, dann lasst ihr ein Fünftel der Ernte stehen, bis sie blüht, und gewinnt das Saatgut. Das klappt toll bei Salat, Mangold, Gurken, Tomaten. Bei Wurzelgemüse bilden sich Samen oft erst im zweiten Jahr. Samen von reifen Zucchini und Kürbissen kann man besonders leicht ernten, es dürfen nur keine ungenießbaren Zierkürbisse in der Nähe angebaut werden, denn die verkreuzen sich. Ansonsten kann das Kreuzen aber auch eine spannende Angelegenheit sein. Ihr bekommt über die Jahre eigene Hofsorten, die optimal an euren Standort angepasst sind. Bei Bohnen macht das besonders Spaß. Bunt, gescheckt, getupft, die Natur hat immer Überraschungen parat. Und wenn ihr Samentütchen zukauft, seid auf der Hut. Da gibt es enorme Unterschiede in Preis und Inhalt. In manchen sind gerade mal fünf Samen drinnen, in anderen das Doppelte und Dreifache. Ich schlage ohnehin vor, dass wir bei unserem nächsten Treffen einen Samentausch machen.«
»Saaaamentausch«, sagte Mathilde langgezogen. »Das klingt heiß!«
»Und aus den Blumensamen, die überbleiben, können wir dann Samenbomben basteln und das Burgenland zum Blühen bringen«, schlug eine der älteren Besucherinnen vor. »Der Ploberger hat letztens im Fernsehen erklärt, wie das geht. Man muss nur Samen mit Erde, Tonpulver und Wasser mischen und dann daraus Kugeln formen.«
Die Frau, von der dieser Vorschlag kam, hatte eine Kappe auf. Sie war sicher schon über 80, aber sie gab sich kriegerisch wie eine Guerillakämpferin.
Sie kam Vera bekannt vor. War das nicht die Malerin Grete Sobotka, die sich im Südburgenland ein Kellerstöckl gekauft hatte? In den 1980er Jahren hatte die Sobotka für die Hainburger Au demonstriert und sich an Bäume gekettet. Ihr Kampfgeist für die Natur war offenbar ungebrochen.
Samenbomben, keine schlechte Idee. Zum Beispiel, um die Grüninseln in den hässlichen Kreisverkehren zu bombardieren, dachte Vera, aber gemessen an der Anzahl würde es dafür wohl Tonnen von Blumensamen brauchen.
»Ich war ja früher beim hiesigen Verschönerungsverein, aber da bin ich ausgetreten, weil die wollen immer nur Muschkateln setzen«, sagte die Guerilla-Grete kämpferisch: »Die haben ja null Geschmack oder Sinn fürs Regionale. Dabei sind heimische Wiesenblumen so viel schöner als das künstliche importierte Zeug aus Holland.«
»Ich kann auch was beitragen«, sagte Mathilde: »Bei uns im Hotel bleiben immer jede Menge Plastikkübel von der Molkerei und leere Ölkanister über, die dann weggeschmissen werden. Ich kann die das nächste Mal mitbringen, wenn Bedarf besteht. Man kann darin Brennnesseljauche ansetzen oder sie zum Schneckenabsammeln nehmen.« Zustimmendes Gemurmel erfüllte den Raum.
»Kann ich euch fragen, was ihr gegen die Schnecken tut?«, fragte Vera.
»Jessas, dei Schnecka«11, seufzte die zweite ältere Frau namens Mitzi. »I woas no genau, wia da erste rote Schneck in Owawort eizogn is. Im 87er Johr wor deis. Dei san va Bocksdorf iwa Stegersbach zu uns aufikrallt. I bin hinteri in mein Goardn, der wos ban Boch glegn is, und do hots nur so gwurlt, olles vulla Schneckn. Mia hots so graust.«12
»Die Spanische Wegschnecke ist in den 80er Jahren über Gemüsetransporte in Österreich eingeschleppt worden«, ergänzte Johanna. »Angeblich waren sie gar nicht in den Kisteln selbst, sondern in den Hohlräumen der Radfelgen. Und weil die Schnecken hier keine natürlichen Feinde haben, haben sie sich rasend schnell vermehrt und sind bis heute ein Riesenproblem.«
»Die Leit hom dann olle iahnere Gärtn gschliffen wegn dei Schneck, wals iahna olles ogfressn hom, und dann is a die Zeit kummen, wos olles in Supermoakt kaft hom«, bestätigte Mitzi.13
Johanna nickte. »Jetzt hat das Garteln und Selbstversorgen ein Comeback. Nur gegen die Schnecken gibt es noch immer keine Lösung. Indische Laufenten helfen, das sind die einzigen Vögel, die die bitteren Schnecken fressen, aber die brauchen einen Tümpel oder einen Bach und müssen vom Gemüse ferngehalten werden, weil sie das sonst auch fressen. Am besten ist, man versperrt den Schnecken einfach den Zugang zum Beet. Ich baue mein Gemüse zum Großteil in alten Badewannen an.«
Vera bedankte sich für die Antwort. Das Ganze klang logisch und war durchaus eine Überlegung wert, auch wenn sie keine Ahnung hatte, wo man alte Badewannen auftreiben konnte.
»Ich würde jetzt gerne zum Thema ›natürlich Düngen‹ kommen«, sagte Johanna.
»I häng immer an Strumpf mit Hianamist in die Reigntonne, so hob i glei a düngts Wossa«, sagte die Mitzi: »Friacha, oisa Junge, howi a immer die Rossäpfel aufklaum miassn, wenn d’ Ressa vabei san, owa heit hot jo kuana mehr Ressa im Dorf. Drum howi hiats d’Hiana, und eppa tua i ma a no a Goass ham.«14
»Tierischer Dünger ist eine super Sache, aber es ist auch schon viel gewonnen, wenn ihr anfangt, eure Küchenabfälle zu kompostieren«, riet Johanna. »Ich habe einen Experten von der Firma ›Inkaerde‹ eingeladen, der euch erklären wird, wie das richtig geht, er müsste gleich da sein. Will inzwischen wer einen Apfelfleck?«
Fliegender Themenwechsel vom Abfall zum Apfel. Aber alle griffen mit Appetit zu, und der Kuchen war ein Gedicht. »Könnte ich das Rezept haben?«, fragte Eva.
»Da gibt es kein Rezept, das macht man iwahaps«, sagte Johanna verwirrt. »Das ist einfach Mürbteig mit Apfelfülle.«
Vera lachte. Sie hatte während ihrer Zeit bei »Lust aufs Land« öfters genau diese Antwort von Bäckerinnen am Land bekommen. Frauen wie Johanna hatten das Backen einfach im Gefühl. Da wurde nichts gewogen oder gemessen.
Die Hofladentür ging auf. Ein junger Typ in Arbeitshosen und T-Shirt betrat den Raum.
»Ah, der Finz von der ›Inkaerde‹, grad haben wir über dich geredet«, sagte Johanna.
Der Finz sah nett aus. Normal, dachte Vera. Sie hatte sich bei dem Wort »Inkaerde« irgendwie einen exotischeren Repräsentanten erwartet. Jemanden im Poncho mit Panflöte. Sie musste selber über ihr blödes stereotypes Denken lachen.
Finz hatte einen Stoß Prospekte und mehrere Päckchen Erde mitgebracht.
Vera überlegte, ob sie seine Erläuterungen aufzeichnen oder mitschreiben sollte. Wäre sicher nicht schlecht. Aber das Ganze mit dem Smartphone zu machen, wirkte hier in diesem Rahmen ziemlich deplatziert.
»Hat wer einen Stift?«, fragte sie in die Runde und nahm die Rückseite eines Kassenbons, den sie in ihrer Handtasche fand, als Schmierzettel. Alle Anwesenden hatten geflochtene Weidenkörbe mit Notizblöcken und Stiften dabei. Hier war alles noch so angenehm analog.
Finz räusperte sich und fuhr sich mit der Hand durch sein dichtes braunes Haar.
»Das Wichtigste, was ihr wissen solltet, ist, dass Erde ein Lebewesen ist. Unterirdisch wird zehn Mal so viel Leben ernährt wie oberirdisch. Pro Hektar gibt es 25 Tonnen Bodenleben – sofern die Erde intakt ist. Aber die klassische Landwirtschaft laugt den Boden aus. Egal ob Griechen oder Römer, alle großen Kulturen sind früher oder später am Boden gescheitert. Eine Zeit lang konnten sie das kompensieren, indem sie Kriege begannen und andere Länder eroberten. Trotzdem, älter als 1000 Jahre ist keine Kultur geworden. Wenn wir die Erde fruchtbar halten wollen, was gerade in Zeiten der Klimakrise und der Bevölkerungsexplosion ein riesen Thema ist, müssen wir ihr Substanz zurückgeben, und das geht nur über Humusaufbau. In Österreich haben sich bereit 3000 Landwirte diesem Ziel verschrieben, aber jeder Einzelne kann dazu beitragen, indem er anfängt, zu Hause zu kompostieren.«
Finz hatte eine ruhige Stimme, drückte sich klar aus, schien von dem überzeugt sein, was er vertrat. »Hier«, sagte er und griff zu einem Säckchen Erde, öffnete es und reichte es herum.
»Was ist das?« Vera befühlte den Inhalt mit den Fingern. Er fühlte sich grob und fasrig an und roch leicht nach Torf. »Fühlt sich an wie ganz normale Blumenerde.«
»Richtig«, sagte Finz und zog die Stirn in Falten. »Nur dass Blumenerde zumeist gar keine echte Erde ist, sondern ein Mix aus Torf und Nährstoffen. Torf – dafür werden jahrtausendealte Moorlandschaften zerstört. Das hat nichts mit Erde zu tun. Das ist tote Materie. Gemüse, das darauf angebaut wird, schmeckt fad. Es gibt sogar Wissenschaftler, die glauben, dass unsere modernen Zivilisationskrankheiten daher kommen, dass wir unser Gemüse auf künstlichem Substrat ohne jede Art von Bodenlebewesen anbauen. Und jetzt schaut euch das an.«
Das zweite Säckchen machte die Runde. Diesmal war der Inhalt feuchter, krümeliger. Die Erde wirkt irgendwie fetter, dachte Vera, echter.
»Das ist Kompost. In dieser Handvoll Erde stecken acht Milliarden Kleinstlebewesen.« Eva, die das Säckchen in der Hand hielt, zuckte erschrocken zurück, als hätte sie einen Sack voller Flöhe geöffnet. »Keine Angst, die beißen nicht«, sagte Finz und grinste. Eva lief rot an.
»Wer von euch hat einen Komposthaufen daheim?« Alle bis auf Vera zeigten auf. »Und was kommt da alles drauf?«
»Küchenabfälle«, sagte Mathilde.
»Zeitungen, Gartenabfälle, Grünschnitt, Laub«, ergänzten die anderen. Die burgenländischen Landfrauen schienen allesamt Kompostexpertinnen zu sein.
»Und was darf keinesfalls drauf?«, fragte Finz.
»Gespritzte Zitrusfrüchte, Unkraut, das Samen trägt, und Fleischabfälle«, sagte Vera, stolz, die Antwort zu kennen. Sie hatte zwar keinen Komposthaufen, aber einmal einen Artikel darüber geschrieben.
»Falsch«, sagte Finz. »Das liest man zwar überall, aber es ist Blödsinn. Alles Organische kann kompostiert werden. Der Kompost muss nur heiß genug werden. Dann werden Spritzmittel abgebaut, Samen getötet. Und Fleisch verfault nicht, sondern kompostiert. Und heiß wird euer Komposthaufen, wenn ihr ihn richtig aufsetzt. Ich kann euch den YouTube-Kanal ›Erdgeflüster‹ empfehlen, schaut euch den einmal an, da gibt es einen Film zur richtigen Anleitung.«
»Erdgeflüster«, flüsterte Vera Eva zu. Sie kam sich gerade vor wie eine schlechte Schülerin, die vom Lehrer getadelt wurde, und reagierte auf dieses peinliche Gefühl mit der gleichen Übersprungshandlung wie früher in der Schule: Sie begann, mit ihrer Sitznachbarin zu tratschen. Aber Eva ließ sich nicht darauf ein, sie nickte nur und schrieb eifrig weiter.
»Wenn ihr Heißkompost richtig herstellt, könnt ihr sogar kranke Pflanzen kompostieren, zum Beispiel Tomatenranken, die die Braunfäule haben«, erklärte Finz. »Die Natur findet dann eine Lösung, bildet aktive Gegenspieler im Kompost, so geht moderner Pflanzenschutz. Zumindest in der Theorie. Denn in der Praxis sind die meisten Komposthaufen reine Abfallhaufen. Merkt euch eines: Wenn es stinkt, ist es kein Komposthaufen. Zu viel Rasenschnitt, zu viele Küchenabfälle, dann beginnt es zu stinken und zu faulen. Und das zieht dann nur die Schnecken an.«
Schnecken, immer nur Schnecken, dachte Vera. Irgendwie waren diese Viecher allgegenwärtig.
Gerade hatte Finz ein drittes Säckchen herumgereicht. Eine schwarze Komposterde, die er selbst nach einem geheimen Rezept der Inkas herstellte.
Nix Poncho und Panflöte. Daher kam also der Name seiner Firma.
Vera studierte Finz und fragte sich, wie es wohl gekommen war, dass ein junger Typ sich dermaßen brennend für Kompost interessierte.
9 Die Straßen sind aus Lehm, aber daheim ist daheim.
10 Ja schau, seid ihr auch schon da, kommt herein und drückt euch einen Kaffee herunter.
11 Jesus, die Schnecken
12 Ich weiß noch genau, wie die erste rote Schnecke in Oberwart eingezogen ist. Im Jahr 1987 war das. Die sind von Bocksdorf über Stegersbach zu uns heraufgekrochen. Ich bin nach hinten in meinen Garten, der beim Bach gelegen ist, und dort hat es nur so gewuselt, alles voller Schnecken. Mir hat es so gegraust.
13 Die Leute haben dann alle ihre Gärten geschleift wegen der Schnecken, weil die ihnen alles abgefressen haben, und dann ist auch die Zeit gekommen, wo sie alles im Supermarkt gekauft haben.
14 Ich hänge immer einen Strumpf mit Hühnermist in die Regentonne, so habe ich gleich ein gedüngtes Wasser. Früher, als ich jung war, habe ich immer die Pferdeäpfel aufsammeln müssen, wenn die Rösser vorbeigekommen sind, aber heute hat ja niemand mehr Pferde im Dorf. Darum habe ich heute die Hühner, und vielleicht nehme ich mir auch noch eine Ziege nach Hause.