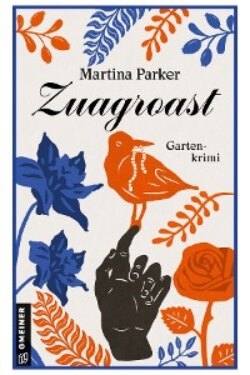Читать книгу Zuagroast - Martina Parker - Страница 6
Kapitel 1
Egreschl und Nacktschnecken
ОглавлениеObwohl Nacktschnecken Zwitter sind und sich daher auch alleine befruchten können, paaren sie sich mit Leidenschaft. Manche Schnecken streicheln sich dabei bis zu 24 Stunden lang, bevor es zur Sache geht. Den größten hat dabei die Limax redii. Bei einer Körpergröße von 13 bis 15 Zentimetern hat diese Schnegelart einen bis zu 85 Zentimeter langen Penis.
Vorsätzlicher Mord wäre Vera Horvath in ihrem früheren Leben in der Stadt nie in den Sinn gekommen. Doch jetzt lebte sie im Südburgenland. Und es schien, als würde das Land das Schlimmste in ihr zum Vorschein bringen.
Es war ein Morgen, der für Gärtner prinzipiell nach Hoffnung roch: Sonne, Vogelgezwitscher, die Aussicht auf eine baldige reiche Ernte. So würde es zumindest ein poetisch veranlagter Mensch beschreiben. Vera war eher der praktische Typ.
Sie ging den schmalen Weg entlang, der vom Haus zum Bauerngarten der Urlioma führte. Das Gras war hoch und morgenfeucht, und sie spürte, wie die Feuchtigkeit durch das dünne Netzmaterial ihrer Turnschuhe drang und die kühle Nässe ihre Zehen erreichte und klamm werden ließ.
Vera zog die Zehen ein, beugte sich zu einem kleinen dornigen Strauch herunter und griff vorsichtig nach einer Stachelbeere. Wie hatte die Urlioma immer auf Heanzisch dazu gesagt? Egretscherl, genau – wie lautmalerisch. Sie drückte die noch grüne Frucht prüfend zwischen Zeigefinger und Daumen.
Die Beere fühlte sich hart an. Sie wiederholte den Test bei ein paar anderen Früchten, verletzte sich dabei an einem langen Dorn, fluchte und widmete sich dann den Beeren, die auf der Hinterseite des Busches weiter außen, näher zur Sonne wuchsen. Endlich ertastete sie eine, die ihr reif schien. Sie knipste das borstige Ende und den Stielansatz mit den Fingernägeln ab und schob sich die Stachelbeere in den Mund.
Die Frucht zerplatzte beim Daraufbeißen, das gelartige Fruchtfleisch war eher süß als sauer. Die brauchten wohl noch zwei, drei Wochen. Vera war dennoch auf den Geschmack gekommen und nahm noch ein paar weitere Egretscherl in der hohlen Hand als Wegzehrung auf ihre morgendliche Inspektionsrunde mit.
Unter der Hortensie grinste sie ihr Gartenzwerg an. Die Hortensie hieß Annabelle. Der Gartenzwerg hatte keinen Namen. Er war auch kein Sympathieträger, sondern ein unbeholfenes Abschiedsgeschenk von Veras Ex-Kollegen von der Zeitschrift »Lust aufs Land«, bei der sie die letzten acht Jahre als Redakteurin gearbeitet hatte.
»Lust aufs Land« war jahrelang das Erfolgsprodukt des Verlags gewesen, wie alle Magazine auf dem Markt, die das Wort »Land« im Titel trugen. Honigbiene, Heimat und Harmonie statt Krieg, Krise und Klimawandel. Zu den besten Zeiten hatten wir mehr Leser als das »Profil«, dachte Vera bitter. Aber die fetten Jahre waren vorbei. Die Printkrise hatte auch vor den Heften, die die heile Welt promoteten, nicht Halt gemacht.
Sankt Martin in der Wart – mit 18 hatte Vera geglaubt, diesen Ort für immer hinter sich gelassen zu haben. Jetzt, mit 42, saß sie im Haus der verstorbenen Urlioma und versuchte, eine Gstätten zu bändigen, die so gar nichts mit den illustren Gartenbildern in der »Lust aufs Land« zu tun hatte. Die Urlioma hatte lange im Heim gelebt, bevor sie gestorben war und Vera das Haus hinterlassen hatte. In dieser Zeit hatten Brennnesseln und Brombeeren die Herrschaft über die einstmals gepflegten Beete an sich gerissen. Vera sah ihre wuchernden Triebe überall emporkommen.
Gab es noch etwas Schlimmeres? Ja, die Schnecken. Diese schleimige wurmförmige Plage, die alles vernichtete, was zögerlich emporwuchs. Erst hatten die Schnecken die Erbsensprösslinge und den Pflücksalat über Nacht weggefressen, dann die aufkeimenden Kürbis- und Gurkenpflanzen. Die Schnecken waren die Feinde des Neubeginns, die Zerstörer der gärtnerischen Zuversicht.
Vera hatte im Kampf gegen die Schnecken alle Empfehlungen aus der »Lust aufs Land« ausprobiert. Sie hatte Eierschalen als abschreckende Barriere um die Jungpflanzen gestreut. Die Schnecken ließen sich nicht aufhalten. Am nächsten Tag waren die Jungpflanzen weg. Hindernisse wie den Kupferdraht, die Sägespäne und den Kaffeesatz überwanden die Viecher mühelos.
Eingegrabene Bierfallen hatten den Effekt, dass, angelockt vom Bierdunst, alle Schnecken aus dem Bezirk Oberwart zum Massenbesäufnis kamen. Und Besoffene haben wohl wirklich immer ein Masel. Denn ertrunken waren nur wenige.
Inzwischen hatte Vera schon so viel Geld für Schneckenbarrieren und immer neue Jungpflanzen ausgegeben – letztere natürlich alte Sortenraritäten in samenfester Bioqualität – dass sie um das Geld ihr Gemüse auch gleich im teuersten Delikatessengeschäft Wiens hätte kaufen können.
Vera steckte sich eine Stachelbeere in den Mund. Heute war es besonders schlimm. Die Roten Wegschnecken dachten gar nicht daran, sich ihrem Namen entsprechend am Weg aufzuhalten. Einzelne Exemplare wiegten sich in den Ruten der Sommerhimbeeren und hatten die heranreifenden Früchte bereits mit einer Schleimschicht überzogen, die in der Sonne getrocknet war und wie dünne Folie glitzerte. Ein Dutzend fetter, ledriger Exemplare kroch über die Kohlrabi und fräste sich zielstrebig durch die jungen Früchte. Besonders schlimm hatte es das Salatbeet erwischt: Das Grazer Krauthäuptel war Austragungsort einer wahrhaften Schneckenorgie, je zwei oder gar drei Exemplare paarten sich dort, indem sie sich seltsam verschlungen aneinanderpressten. Der Gartenzwerg grinste dämlich.
Vera dachte an die Kündigung. Aussortiert. Sie war ausgemustert worden. Zu alt, wertlos, unnütz und offenbar sogar zu deppert, um den Urliomagarten halbwegs in Schuss zu halten und mit ein paar hirnlosen Schnecken fertig zu werden. Sie spürte einen Knoten im Hals. Tränen schossen ihr in die Augen. Wut stieg in ihr hoch.
Sie steckte sich die restlichen Stachelbeeren auf einmal in den Mund, um die Hand frei zu haben. Dann griff sie zum Löwenzahnstecher, den sie nach dem gestrigen Kampf gegen die Brombeerwurzeln am Beetrand abgelegt hatte. Ein letzter prüfender Blick auf ihr erstes Opfer. Dann hob sie die Hand und stach zu. Die Schnecke sank beim Versuch, sie zweizuteilen, in die weiche Erde ein, und Vera hackte noch ein paar Mal auf die Stelle, um ganz sicher zu sein, dass das im Erdreich versunkene Tier tot war. Beim nächsten Exemplar war sie klüger: Sie bugsierte ihr Opfer erst mit dem Werkzeug aus dem Beet heraus, bevor sie es auf dem Rasen erledigte. Die dritte Schnecke war besonders leicht zu erlegen, weil sie am hölzernen Beetrand emporkroch, der dem Schneidewerkzeug entsprechend Widerstand leistete. Ein einziger Schnitt mit der scharfen Klinge genügte. Schleimige, gelb-graue Innereien quollen aus den Körpern der Toten. Schnecken haben kein Blut, aber das, was Vera erfasste, konnte man nur als Blutrausch bezeichnen. Eine nach der anderen erledigte sie wie im Fieber. Zehn, elf, zwölf, 13 – Vera zählte mit – 29, 30, 32 … Die Nacktschnecken auf den Himbeeren schüttelte sie von den Ruten, bevor sie sie erledigte. Und es fühlte sich gut an, erleichternd, befreiend, befriedigend … bis sie die letzte Stachelbeere zerbiss und bemerkte, dass das schleimige Massaker vor ihr auf unangenehme Art dieselbe Textur hatte wie der Obstbrei in ihrem Mund. Vera ließ den Löwenzahnstecher sinken. Ihr war schlecht.
Sie bohrte das Werkzeug ein paar Mal in die Erde, um dieses vom Schneckenschleim ihrer Opfer zu befreien, und ging dann langsam zum Haus zurück.
Eigentlich war das Urliomahaus ja ein Hof. Aber Vera war vorsichtig mit diesem Begriff, seit sie zum ersten Mal die zweifelnden, fragenden Blicke von Besuchern aus der Stadt bemerkt hatte. Diese hatten sich unter »Hof« einen stattlichen Vierkanter vorgestellt, wie man ihn im Waldviertel findet. Das Urliomahaus hatte gerade einmal vier winzige Räume mit niedrigen Decken und kleinen Kastenstockfenstern. Küche, Bad, Wohnzimmer und Schlafzimmer.
Die Urlioma hatte ausschließlich in der Küche gelebt: auf der Bettbank neben dem Beistellherd, auf dem den ganzen Tag eine Suppe vor sich hin geköchelt hatte. Der Beistellherd wurde auch Sparherd genannt, weil er bei geringstem Kostenaufwand ein echtes Multitalent war. Er wärmte die Küche, seitlich gab es ein Becken, in dem den ganzen Tag heißes Wasser bereitstand. Und das Backrohr war nicht nur nützlich, um »Grumpan zu brodn«1, hier konnte man – bei gemäßigter Temperatur – auch Nüsse und Pilze trocknen und sogar Eisfüße wiederbeleben.
Vera konnte sich noch an einen Winter erinnern, als sie als Kind so lange in einem Schneehaufen herumgesprungen war, bis ihre Schuhe und Socken pitschnass waren. Die Urlioma hatte geschimpft, als sie die Bescherung gesehen hatte. »Jessas, hiaz wiarst ma no kraunk. Hiaz muaß i di vor die Rearn setzen.«2 Dann hatte sie Vera gepackt und auf einen Hocker vor den Herd gesetzt, das Türl aufgemacht, eine Decke ins Backrohr gelegt und »der Vera ihre nackerten Fiaß« auf die Decke gelegt.
Veras nasse Socken und Handschuhe hängte die Urlioma auf dem Scherengitter über dem Ofen zum Trocknen auf. Und Veras nasse Lederschuhe kamen in das Wärmefach unter dem Rohr. Vera konnte die Wärme von damals heute noch spüren.
Das Wohnzimmer hatte die Urlioma nie beheizt. Nicht nur aus Spargründen. Das Wohnzimmer wurde nur zu Weihnachten benutzt oder wenn jemand gestorben war. Und nicht nur Christbaumnadeln und Weihnachtsmehlspeise, auch die bis zum Begräbnis zu Hause aufgebahrten Toten hielten sich in einem kalten Raum einfach länger frisch.
Das ehemalige Schlafzimmer der Urlioma hatte Vera mittels Rigipswand in zwei Räume teilen lassen. Der Arbeiter, der das erledigen musste, hatte ob dieser Bausünde die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Aber ihr war keine andere Lösung eingefallen. Ihre 13-jährige Tochter Letta brauchte ja auch ein eigenes Zimmer. Einen Rückzugsbereich.
Das mit dem Rückzugsbereich war voll aufgegangen. Wenn sie nicht in der Schule war, lag Letta die meiste Zeit mit ihren Kopfhörern in ihrem Verschlag, wie sie ihr Kämmerchen nannte, und wartete. Sie wartete darauf, dass sie endlich alt genug war, um in die Stadt zurückzuziehen.
»Ich hasse das Burgenland«, sagte Letta oft zu ihrer Mutter, und ihre dunklen Augen wurden dann noch eine Spur schwärzer. »Dir ist schon klar, dass du mein Leben zerstört hast.« Für Letta kam der Umzug nach Sankt Martin in der Wart einer Verbannung gleich.
Vera zog ihre feuchten Turnschuhe aus und stellte sie auf die Brüstung des Arkadengangs zum Trocknen in die Sonne. Der Arkadengang war typisch für südburgenländische Bauernhöfe – so klein diese auch sein mochten.
Vera hatte irgendwann einmal eine Geschichte über burgenländische Arkaden geschrieben und wusste seither, dass das älteste bekannte Arkadenhaus der 1874 errichtete Pfarrhof der evangelischen Pfarre Oberwart war. Zu der Zeit lebten die meisten burgenländischen Bauern noch in Lehmbauten mit Strohdächern. Aber als Mitte des 19. Jahrhunderts die Abhängigkeit der Bauern von den Grundherren abnahm, wollten die Bauern auch so feudal wohnen wie die Priester und Kleinadeligen und statteten ihre neu gebauten Höfe mit überdachten Bogenkonstruktionen in Renaissanceanmutung aus. Das sah nicht nur nach mehr Prestige aus, es war auch praktisch. Denn die so gewonnene Laube war zumindest im Sommer ein zusätzlicher Lebensraum.
Hier war es auch egal, wenn man ein bisserl Dreck machte, perfekt für Tätigkeiten wie Ribiseln orebeln3, Bohnschadln auslossn4 oder Nüsse knacken. Und unter den regensicheren Bogengängen trockneten dann der aufgehängte Kukuruz5 und die Knoblauch- oder Zwiebelzöpfe vor sich hin.
Vera hatte noch keine Ernte eingebracht, die sie unter den Arkaden hätte verarbeiten können. Dann gibt’s halt Käsetoast zum Mittagessen, dachte sie und ging in die Küche zurück. Den isst Letta wenigstens. Sie wusch sich die Hände und warf den Plattengriller an.
»Da ist schon wieder alles sperrangelweit offen, irgendwann werden s’ euch noch was stehlen.« Vera zuckte erschreckt zusammen. Ihr Mutter Hilda Horvath stand wie eine Erscheinung hinter ihr.
»Wer soll uns was stehlen?«, fragte Vera stirnrunzelnd. Sie bereute die Entscheidung, ihrer 75-jährigen Mutter ein iPad geschenkt zu haben, mittlerweile zutiefst. Seit diese im WeltWeitenWahnsinn surfte, kam sie jeden Tag mit neuen Horrorgeschichten an.
»Na die Trickbetrüger«, sagte Hilda. »Zu älteren alleinstehenden Frauen wie du eine bist, kommen die besonders gerne.«
Vera zuckte bei den Attributen »älter« und »alleinstehend« leicht zusammen. Sie war 42, Single und Alleinerzieherin, aber nicht alleinstehend.
»Hast das heute Früh in der ›Krone‹ gelesen?«, fragte sie forschend zurück.
»Ich hab die ›Krone‹ gekündigt«, sagte Hilda, »weil die hab ich jetzt eh gratis online abonniert.«
»Du hast die ›Krone‹ nicht abonniert, sondern auf deren Facebook-Seite ein Like-Hakerl gesetzt.«
»Ich hab sie abonniert, auf meinem Facebook steht bei der ›Krone‹ abonniert«, sagte Hilda beharrlich.
»Und deswegen bekommst jetzt den ganzen Unsinn in deinen Feed gespült«, seufzte Vera. Kein Wunder, dass bei diesem Medienverständnis Print zum Sterben verurteilt war.
»Was für ein Feed?«, fragte Hilda. »Und sag nicht Unsinn, da erfährt man interessante Sachen. Gestern haben sie was über die Heidi gebracht. Ich versteh echt nicht, dass die mit diesem Sänger zusammenbleibt. Der war ja früher mal fesch, aber jetzt ist der so blad geworden.«
»Welche Heidi, Mama?«
»Na, das Model. Aber vielleicht steht die auf Blade. Der mit den Autos, der Fabio Brillatore, der war ja auch blad.«
»Er heißt Flavio Briatore, Mama. Und was hat das jetzt mit den Trickbetrügern zu tun?«
»Na, gar nichts. Das erzähl ich dir nur so, man wird ja noch ein Gespräch führen dürfen.«
Sie rollte beleidigt mit den Augen. »Also die Trickbetrüger kommen in die Häuser. Sie kommen zu zweit, und einer fragt, ob er ein Glas Wasser haben darf oder geht aufs Klo, und der andere raubt inzwischen die Wohnung aus.«
»Und wo ist das passiert, Mama?«
Vera hatte sich angewöhnt, alle Erzählungen ihrer Mutter genau zu hinterfragen. Eine Berufskrankheit aller Journalisten.
»Na, in Deutschland, aber die kommen sicher auch zu uns. Gestern hat es bei mir auch nach 19 Uhr am Abend geläutet. Ich hab gar nicht aufgemacht. Nach 19 Uhr. Das ist a Frechheit.«
»Du hast doch einen Türspion, hast du nicht nachgeschaut?«
»Natürlich hab ich geschaut. Es waren der Harry und der Dietmar vom Sportverein.«
»Und warum hast du dann nicht aufgemacht, wenn du gesehen hast, dass es welche vom Sportverein waren, die du kennst?«
»Na, weil die auch nur mein Geld wollen. Genauso wie die Trickbetrüger. Die gehen um Spenden. Und zehn Euro will ich denen nicht geben, und fünf Euro sind zu wenig. Da wirst dann hinterher im ganzen Dorf ausgerichtet. Dann heißt es gleich, die alte Horvath ist sierig. Drum ist es besser, man tut so, als wär man nicht zu Hause. Zum Schluss hätten s’ mir noch einen Kalender geschenkt. Also echt, wer braucht jetzt einen Kalender. Einen Kalender verschenkt man im Dezember, nicht im Mai. Du musst echt noch viel lernen, wenn du jetzt wieder am Land leben willst. Was kochst du da?«
Der Käse, dachte Vera. Shit. Er hatte sich durch die Hitze verflüssigt, war über die Platten auf die Heizstäbe geronnen und dort zu einer stinkenden Masse verschmort. Was war nur aus Käse geworden? Früher war Käse beim Grillen in Form geblieben. Er war an den Rändern ein bisschen braun geworden, und dann hatte er beim Reinbeißen Fäden gezogen. Aber das, was da über die Platten kroch, war eine dottergelbe Suppe.
»Supermarktklumpert«, kommentierte Hilda. »Auf meinem Facebook schreiben die, dass im Käse gar keine Milch mehr drinnen ist. Und in einer steirischen Käsefabrik hams sogar Käfer im Käse gefunden. Ich kauf Käse nur im Bauernladen, aber nur, wenn die Frau Fuith aus Mariasdorf Dienst hat, weil die anderen Verkäuferinnen …«
»Nach was riecht es da so komisch?«, fragte Letta stirnrunzelnd. Der Hunger hatte sie offenbar aus ihrem Verschlag getrieben. Sie nahm die Kopfhörer ab. »Leave me alone …«, die Stimme von Deprirapper NF waberte aus den Lautsprechern.
»Ich hab den falschen Käse gekauft«, gestand Vera.
»Na super. In Wien hätten wir jetzt Pizza bestellen können«, sagte Letta. »Aber hier in der Einöde müssen wir verhungern.«
»Du kommst mit zu mir, ich mach dir ein Schnitzerl mit Reis«, sagte Hilda zu ihrer einzigen Enkelin. Die Bereitschaft, zu jeder Tages- und Nachtzeit Schnitzerl mit Reis zu machen, hatte ihr den Bonus eingebracht, dass Letta zu ihr weitaus freundlicher war als zu allen anderen Menschen in ihrem Umfeld.
»Wie war’s in der Schule?«, fragte Hilda.
Letta rollte mit den Augen. »Geht so. Die haben mich heute gefragt, ob meine Mama mal was mit einem Basketballer hatte.«
Vera zuckte zusammen. Sie wusste, was diese Anspielung bedeutete. In der Oberwarter Basketballmannschaft gab es zahlreiche dunkelhäutige Legionäre aus den USA. Kurz überlegte sie, ob die Bemerkung wohl rassistisch gemeint war. Aber vermutlich war es nur neugieriges Gerede ohne Hintergedanken.
Lettas Haut war dunkler als die der anderen Kinder. Bei einer Buntstiftzeichnung hatte sie nie nach dem »hautfarbenen« Rosa gegriffen, das alle anderen Kinder benutzten, um Gesicht und Hände auszumalen, sondern immer nach Ockerbraun. Ihre Hautfarbe war das Erbe ihres brasilianischen Vaters. Ein Fotograf, mit dem Vera eine heftige, wenn auch komplett dysfunktionale Beziehung gehabt hatte, bei der die Distanz zwischen Rio und Wien noch das kleinste Problem gewesen war. Vera hatte seit ihrer Schwangerschaft keinen Kontakt mehr zu ihm. Letta, eigentlich Violetta, war wirklich das einzig Positive, das dieser Typ je zusammengebracht hatte, dachte sie.
»Hattest du was mit einem Basketballer?« Letta sah sie fragend an.
»Nein«, seufzte Vera.
»Die Heidi hat auch ockerfarbene Kinder«, sagte Hilda fröhlich. »Und jetzt mach ich dir ein Schnitzerl.«
1 Kartoffeln zu braten
2 Jesus, jetzt wirst du noch krank werden. Jetzt muss ich dich vor das Backrohr setzen.
3 Johannisbeeren abrebeln
4 Bohnenschoten öffnen
5 Maiskolben