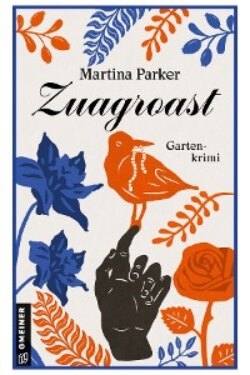Читать книгу Zuagroast - Martina Parker - Страница 18
Kapitel 9
Veras Alltag
ОглавлениеKatzen sind Raubtiere und fressen im Notfall alles, was ihnen das Überleben sichert – auch wenn es Herrchen oder Frauchen ist. Da sie eine Vorliebe für frisches Fleisch haben, knabbern sie besonders gerne an Leichen im frühen Stadium der Verwesung. Bevorzugt werden exponierte Körperteile wie Nase, Mund, Hände oder Füße angefressen.
»Rexi, Reeeexi, Reeeeeeeeeeexxxxxxiii.« Vera wurde durch lautstarkes Rufen aus dem Schlaf gerissen. Sie blickte auf das Display ihres Handys, das neben ihr am Nachtkasterl lag. 5.35 Uhr. »Reeeeeeeeexxxxxxxxiiiiiiiiiiiii, wo bist denn, do kimm her, Rexi, jo wo is denn mei Rexi, braver Rexi, kimm zum Frauli, REEEEEEEEEEEEXXXXIIIIII.« Die Stimme der Nachbarin überschlug sich fast. Aber der Rexi stellte sich taub oder war es längst geworden. Vera seufzte tief und zog sich die Decke über den Kopf. Das mit dem ruhigen Landleben war ein Mythos. Die Nachbarin hatte ihren Schäferhund wie immer frühmorgens zum Äußerln rausgelassen, und der Rexi dachte – ebenfalls wie immer frühmorgens – nicht im Traum daran, wieder ins Nachbarhaus zurückzukehren. Vera mochte die Nachbarin, sie mochte auch den Rexi. Aber an Schlaf war jetzt nicht mehr zu denken, und außerdem war es eh langsam Zeit aufzustehen. Sie stieg aus dem Bett und ging schlaftrunken zum Fenster, um zu checken, wie das Wetter heute war. Es war grau und sah windig aus. Eher November als Anfang Mai. Rexi hob gerade das Bein und pinkelte gegen den gelben Sack mit Plastikmüll, den Vera gestern an den Straßenrand gestellt hatte.
Hier am Land gab es ein genaues System, an welchen Tagen in welchen Ortsteilen Restmüll, Papier oder der gelbe Sack von der Müllabfuhr abgeholt wurde. Die Bewohner stellten dann Tonnen und Müllsäcke an den Straßenrand. Weil nur wenige den Plan auswendig konnten, richtete man sich nach dem, der als Erstes damit begann. Nicht auszudenken, was passieren würde, würde sich hier jemand einen Scherz erlauben und zum Beispiel an einem Plastikabholtag Papier hinausstellen. Der Nachahmeffekt würde das Dorf ins Chaos stürzen.
Der Nachbar schräg vis-à-vis hatte einen schwarzen Müllsack hinausgestellt. Vermutlich waren ihm die gelben Säcke, die man bei der Gemeinde bekam, ausgegangen. Neben dem Müllsack stand ein Sechsertragerl Puntigamer Bier. Offenbar ein Bestechungsversuch an die Müllabfuhr, damit die Männer über die Farbverfehlung hinwegsahen. Irgendwann schreib ich mal ein Buch über das alles hier, dachte Vera.
Sie öffnete langsam die Tür zu Lettas Kabuff. »Letta, aufstehen, heute ist Schule.«
Letta stöhnte grantig. Dass der Schulbus schon um 6.40 Uhr fuhr, weil die Schule hier am Land um 7.25 Uhr begann, kam für sie einer Folter gleich. »Dafür bist schon um 13 Uhr fertig mit allem«, hatte Oma Hilda getröstet. Aber Letta wusste nicht, wofür sie fertig sein sollte. Für endlose langweilige Nachmittage hier in der Einöde? Vera füllte Kaffee und Wasser in die Bialetti und stellte den Espressokocher auf den Herd. Sie wusste nicht, ob es vertretbar war, dass eine 13-Jährige starken italienischen Kaffee trank, aber anders kam Letta in der Früh gar nicht in die Gänge, und außerdem gab sie eh reichlich Milch dazu. An Frühstück war um diese Uhrzeit nicht zu denken. Vera packte ihr eine Jause ein. Einen Apfel, den Letta wochenlang zur Schule hin und wieder zurück tragen würde, bis er angeschlagen und faul weggeworfen werden würde, und ein Vollkornbrot mit Hummus und Paprika, das noch heute im Mist landen würde. Letta würde sich später beim Schulautomaten eine in Plastik eingepackte Zimtschnecke rausdrücken, die voller Chemie und Transfette war. Aber Vera hatte keinen Nerv mehr für die ewige Schuljausen-Diskussion. Sie beschloss, in der Apotheke Vitamintabletten für Letta zu kaufen. Als Ausgleich.
Letta zog sich missmutig ihre Jeansjacke an, schulterte ihren Rucksack und ging zu Tür. »Ciao, mein Schatz, hab viel Spaß«, sagte Vera betont fröhlich.
»Werd ich haben«, sagte Letta. »In zwei Jahren. Sobald ich Geld verdienen darf, ziehe ich nach Wien zurück.«
»Du schmeißt die Schule sicher nicht, du machst Matura!«, rief Vera, aber sie war sich nicht sicher, ob Letta das noch gehört hatte. Die Tür war bereits krachend ins Schloss gefallen.
Vera atmete tief durch. Die Katze strich um ihre Beine. Sie hatte Lettas Abgang genutzt, um durch die offene Tür blitzschnell ins Haus zu kommen. Sie war schon da gewesen, bevor Letta und Vera ins Urliomahaus eingezogen waren. Sie war grau, alt, struppig und namenlos. Sie gehörte niemandem und fraß bei jedem, der ein weiches Herz hatte und sie fütterte. Vera hatte ein weiches Herz. Sie riss einen Softbeutel Katzenfutter auf und ärgerte sich, dass wie jedes Mal beim Öffnen ein bisschen was vom Inhalt auf ihre Hand spritzte. Irgendwann würde sie dem Katzenfutter-Hersteller ein Beschwerdemail schreiben. Konnte der seinen depperten Katzenfuttersoftbeutel-Aufreißfalz nicht spritzsicher designen? Ihre Laune war am Tiefpunkt.
Und das nicht nur, weil sie vom Geschrei der Rexibesitzerin geweckt worden war, weil Letta die Schule schmeißen wollte und ihre Hand mit ekligem Katzenfutter bespritzt war. Sie wusste zum ersten Mal in ihrem Leben nicht, wie es wirklich weitergehen sollte.
Sie hatte kaum mehr Geld auf dem Konto und noch schlimmer, sie hatte keine Perspektive.
Sie schnappte sich ihren Laptop und checkte die Mails. Das erste war von ihrer Hausbank. Ihr Kundenberater hatte eine digitale Nachricht in ihrem Postfach hinterlassen. Vermutlich ging es um ihren voll ausgeschöpften Überziehungsrahmen. Vera löschte das Mail. Das war das Gute an der Digitalisierung. Man musste sich nicht mehr persönlich mit solchen Lästigkeiten befassen. Der Avatar des Kundenberaters, den sie eh nicht persönlich kannte, konnte in der virtuellen Mailbox versauern.
Veras Handy läutete. Es war Eva. »Hi, geht’s dir gut?«
»Oh hallo, ja danke, ich sitz gerade am Computer.« Das klang zumindest beschäftigt. Sie musste ja nicht sagen, dass sie schon fast soweit war, sich im Internet Katzenvideos anzuschauen.
»Du, ich ruf dich eh wegen was Beruflichem an. Du hast doch gesagt, dass du auch Homepage-Texte schreibst. Also, der Paul hat doch jetzt ein neues Planungsbüro, der würde einen Text für seinen neuen Webauftritt brauchen.«
Vera horchte auf. Das kam ja wie gerufen.
»Viel zahlen kann er aktuell aber nicht«, dämpfte Eva Veras aufkeimende Begeisterung. »Er stellt sich ja beruflich gerade erst wieder neu auf. Es ist aber echt nicht viel Text. Er braucht nur eine Startseite und eine kurze Bio und vielleicht die Beschreibung von ein, zwei Projekten, damit die Leute hier herunten sich ein Bild darüber machen können, wer er ist und was er so macht.« Eva nannte den Betrag, den Paul als Honorar veranschlagt hatte. Der war so klein, dass der Paul dafür nicht mal einen halben Designerturnschuh hätte kaufen können. Eine Wiener Agentur hätte dafür nicht einmal einen Dreizeiler getextet. Aber Vera war nicht mehr in Wien. Sie knirschte innerlich mit den Zähnen, sagte aber dennoch ja. Lettas Zimtschnecken in Plastik mussten ja irgendwie finanziert werden.
»Ich schick dir auch gleich eine Mail mit allen Infos.«
»Ist gut, ich danke dir, wir sehen uns dann eh beim nächsten Gartentreffen.« Noch während sich Eva verabschiedete, fuhr Vera ihren Webbrowser hoch. Sie wollte mal sehen, was der WeltWeiteWahnsinn über Paul ausspuckte.
Sie tippte Pauls Namen in die Suchmaschine und begann mit einer Bildsuche. Das Ergebnis war nicht besonders aussagekräftig. Es waren entweder Bilder von modernen Häusern, die geradlinig wie Duplo-Steine waren, nur nicht so bunt, oder Porträts, die Paul von seiner besten Seite zeigten. Paul beim Handshake mit dem Landeshauptmann, Paul bei einer Veranstaltung zum Thema »Visionäres Wohnen«, Paul beim Spatenstich für das »Seewinkler Inselparadies«. Fesch war er ja, der Paul. Und charismatisch. Er stand auf allen Bildern aufrecht – Siegerlächeln. Siegerpose. Vera, die bucklig vor dem Laptop gesessen hatte, straffte unbewusst ihre hängenden Schultern und verzog den Mund zu einer Grimasse.
Eva hatte gesagt, Paul hätte gerne Infos über seine Projekte. Vera startete eine neue Suche zum Thema »Seewinkler Inselparadies«. Die Artikel, die sie dazu fand, hatten wohl eins zu eins den PR Text übernommen. Wohnluxus am Wasser, stylische Residenzen am See, zeitgemäße Architektur, Imagegewinn für die Region. Die Beiträge überschlugen sich fast vor Lobhudeleien. Ein einziges Magazin witterte Verstöße gegen die für die Seeregion geltenden UNESCO-Weltkulturerbe-Schutzbestimmungen. In den Kommentaren zum Artikel war eine erbitterte Diskussion zwischen Befürwortern der Siedlung und Umweltschützern entbrannt. Ein Kommentar weckte besonders ihre Aufmerksamkeit: »Die Siedlung kannst demnächst eh mit dem Bagger in den See schieben, die Häuser sind jetzt schon feucht und schimmlig«, schrieb ein gewisser CostaPannonius.
Sie öffnete ein neues Suchfenster und tippte auf gut Glück »Seewinkler Inselparadies« und »Baumängel« ein. Bingo! In kürzester Zeit fand sie einen Chat, in dem betroffene Käufer ihr Leid klagten. Risse im Putz, feuchte Flecken zwischen Glasflächen und Wand, Flachdächer, bei denen es hineinregnete. Offenbar waren die Nachbesserungsarbeiten noch im Gange. Ob der adrette Paul da wohl geschlampt hatte? Komisch, dass davon kaum was in den Medien war.
»Du sollst keinen Aufdeckerartikel schreiben, sondern Werbung für den Typen machen«, schalt sich Vera selbst. »Dafür wirst du bezahlt.«
Dennoch saß sie noch eine ganze Zeit lang nachdenklich vor dem Computer. Bis sie plötzlich aufgeregtes Gegacker hochschrecken ließ. Sie lief nach draußen. In einer der Blumenkisten vor dem Haus lag ein Ei. Davor lief laut gackernd ein Huhn auf und ab. Vera traute ihren Augen nicht. Sie wusste, dass sie ganz sicher kein Huhn besaß. Auch niemand von den unmittelbaren Nachbarn besaß Hühner. Wo das wohl herkam? Das Huhn war rot-braun und weiß gesprenkelt und sah etwas zerrupft aus. Sein Hals war ganz kahl. Vermutlich das letzte in der Hackordnung, das auf der Suche nach einem sicheren Legeplatz vor seinen Artgenossen geflüchtet war. Vera nahm das Ei in die Hand. Es war noch ganz warm. Das Huhn schien bereits das Interesse an seinem Ei verloren zu haben. Es stolzierte Richtung Garten davon und machte sich über den Salat her, der in einem der Beete aufkam. Na toll, dachte Vera. Kurz überlegte sie, das Huhn zu verscheuchen, aber andererseits war ein frisches Ei im Gegenzug für ein paar mickrige Salatpflanzerln ein guter Tausch. Und außerdem liebte Letta Tiere. Vielleicht würde sie das Huhn auf andere Gedanken bringen.
Vera hatte panische Angst um Letta, seit sie zum ersten Mal bemerkt hatte, dass Letta alles zu Hause hortete, was scharf war. Messer, Scheren, Rasierklingen, Teppichcutter, Glasscherben.
Ritzen ist ein merkwürdiges Phänomen: Während die meisten Menschen Schmerzen oder körperliche Schäden instinktiv vermeiden, schneiden sich andere selbst. Meist sind es Jugendliche, in aller Regel Mädchen.
Letta wusste selbst nicht mehr, wie es angefangen hatte. Eigentlich war alles wie immer gewesen. Stress in der Schule, Streit mit ihrer Mutter. Die beiden hatten sich angeschrien, Letta war ins Badezimmer der weitläufigen Wiener Altbauwohnung geflüchtet. Auf dem Rand der Wanne war Veras Rasierer gelegen. Letta hatte danach gegriffen und dann die Klinge ganz langsam über ihren linken Unterarm gezogen. Einmal. Und dann noch einmal. Und noch einmal. Es war ein schönes Gefühl gewesen, es hatte Erleichterung gebracht. An diesem Tag hatte sie sich zum ersten Mal selbst verletzt.
Monatelang war es ihr gelungen, die blutigen Schnitte und Narben zu verstecken. Sie trug lange Shirts, sogar im Hochsommer, wenn es draußen 35 Grad im Schatten hatte. Sie zog sich für den Turnunterricht auf dem Klo um und verdeckte ihre Unterarme mit Stulpen oder unzähligen Armketten und Festivalbändern.
Vera hatte »es« vom Klassenvorstand des Wiener Gymnasiums erfahren, das Letta damals besuchte. Andere Mütter hatten sich beschwert, dass Letta ihre Töchter mit dieser Ritzerei »angesteckt« hätte.
Vera hatte Letta die Jacke vom Leib gerissen und die Narben gesehen. Narben, die alt und silbrig weiß waren, geometrisch wie ein Spinnennetz. Narben, die frisch und rot waren und wulstig hervortraten. Narben, die von Verzweiflung zeugten.
»Warum tust du das?«, hatte Vera gefragt.
»Es hilft mir, die Traurigkeit auszuhalten«, hatte Letta geantwortet. Woher diese Traurigkeit käme? Schweigen.
»Das ist nur eine Modeerscheinung, eine pubertäre Phase, das tun jetzt alle Mädchen«, hatten Veras Freundinnen sie beruhigt. »Wir hatten damals alle Essstörungen, und die heute ritzen sich. Da geht es um den Kick.«
Aber Vera fühlte trotzdem ein nagendes Gefühl der Schuld. Letta war anders, sie war schon durch ihre Hautfarbe auf den ersten Blick anders, und daran war nur sie, ihre Mutter, schuld.
»Letta spürt sich nicht«, hatte die Schulpsychologin gesagt. »Sie steht neben sich. In so einer Situation lässt einen der Schmerz wenigstens irgendetwas spüren. Wenn Blut fließt, merkt sie, dass sie noch am Leben ist.«
»Letta idealisiert das Leiden«, hatte der Klassenvorstand gesagt: »Wir haben ›Die Leiden des jungen Werther‹ durchgenommen. Und während der Rest der Klasse die Leiden als erbärmlich übertrieben und Werther als Vaserl bezeichnet hat, hat Letta ihn glühend verteidigt.«
Vera hatte Letta zehn Mal zum Psychiater geschickt. Die Ritzerei hatte aufgehört, aber Letta war immer noch traurig. Die anderen Mütter hatten ihren Töchtern den Umgang mit Letta verboten.
»Das Mädel gehört aufs Land, hier kommt sie auf andere Gedanken«, hatte Oma Hilda gesagt. Und in Veras aktueller beruflicher Situation war der Umzug ins Südburgenland ohnehin die einzige Lösung. Eine neue Schule, ein neuer Start, neue Freunde. Tanzunterricht, damit Letta sich wieder spüren konnte. Vera hoffte, dass sich ihre Erwartungen erfüllen würden.