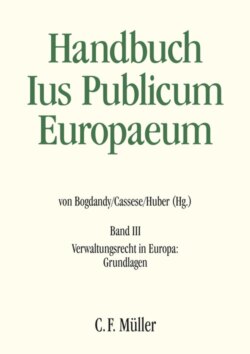Читать книгу Ius Publicum Europaeum - Tomasz Rechberger, Michał Ziółkowski, Andrzej Wróbel - Страница 28
На сайте Литреса книга снята с продажи.
b) Expansion der Verwaltung und konstitutioneller Rechtsstaat
Оглавление24
Die Gründung des Norddeutschen Bundes und die Reichsverfassung von 1871 haben zunächst wenig Auswirkungen auf die Verwaltung, denn diese bleibt organisatorisch und funktional im Wesentlichen bei den Gliedstaaten. Die Herausforderungen der industriellen Revolution, der Migrationsbewegungen und neuer politischer Forderungen wirken dann aber in vielfacher Hinsicht vor dem Hintergrund der soeben beschriebenen neuen Grundbegrifflichkeit auf die Entwicklung des Verwaltungsrechts ein. Die Aufgabe der sozialen Gestaltung, insbesondere der Umgang mit sozialen Problemen,[71] wird zunehmend „dem Staat“ als Wirkungseinheit zugewiesen, was schon in der Gründerzeit zu einer enormen Expansion des Verwaltungsapparats und des Verwaltungsrechts führt. Dieser Modernisierungsschub erfolgte unter Führung des Reiches. Ähnliches soll sich einhundert Jahre später im Zuge der europäischen Integration ereignen.
25
Da sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die disziplinbegründenden Kategorien des Verwaltungsrechts formen, bedarf es der Kenntnis ihrer wichtigsten Eckpunkte. Europaweit einmalig ist der bis heute prägende Exekutivföderalismus, der sich zunächst aus der Konstruktion des Reiches als eines Bundes der Fürsten ergibt.[72] Einen weiteren Schlüssel zum Verständnis bildet die unklare und umstrittene Legitimation sowohl des neuen Nationalstaates wie der Bundesstaaten. Die demokratischen Forderungen, die 1816 und in der Revolution von 1848 gestellt werden,[73] haben nur geringen Erfolg; es gibt namentlich keine Volkssouveränität wie etwa in den Vereinigten Staaten, dem großen Vorbild vieler liberaldemokratischer Revolutionäre.[74] Die parlamentarischen Versammlungen weisen nur wenige demokratische Elemente auf, da sie in der Regel aus einer aristokratischen ersten und einer oft dem Zensuswahlrecht unterliegenden zweiten Kammer bestehen;[75] zudem ist ihr Einfluss gering, da die Bestellung der Exekutive und des Beamtenapparats weitgehend dem Monarchen vorbehalten bleibt.[76]
26
Die deutschen Verfassungen beruhen bis 1918 auf einem ambivalenten Kompromiss zwischen dem monarchischen und dem demokratischen Prinzip.[77] Während die britische Verfassung, deren wahrer Souverän der „King in Parliament“ war, problemlos demokratische Reformelemente integrieren konnte,[78] erlaubte die in Deutschland durch den Wiener Kongress gefestigte Auffassung von monarchischer Legitimität keine derartige Entwicklung.[79] Darüber hinaus weist die unklare legitimatorische Grundkonstellation in föderaler Aufstellung eine Reihe von Parallelen mit der heute in der Europäischen Union anzutreffenden Situation auf, so dass der Vergleich hier erhebliches Erkenntnispotenzial für den europäischen Rechtsraum bieten kann.[80]
27
Institutionell sind die meisten Verwaltungen von der Legitimität des Monarchen abhängig und auf diesen verpflichtet. Vor diesem Hintergrund sollte sich noch bis weit in die Weimarer Republik die Vorstellung halten, dass eine vollständige Demokratisierung für Deutschland nicht der richtige Weg sei und dass die monarchische Abschirmung der Verwaltung gegenüber den politischen Parteien am ehesten das Prinzip einer objektiven, unparteilichen und wirkungsvollen Erledigung öffentlicher Aufgaben sichere.[81] Viele Deutsche ordneten sich dieser autoritären Struktur mit einem Selbstverständnis unter, das Heinrich Mann in seinem Roman „Der Untertan“ wirkungsmächtig persifliert.[82]
28
Im Zuge der genannten Herausforderungen – industrielle Revolution, Migrationsbewegungen, demokratische Forderungen – nehmen Umfang und Zugriff der Staatsbürokratie im ausgehenden 19. Jahrhundert deutlich zu.[83] Eine bekannte rechtswissenschaftliche Formulierung fasst dies wie folgt zusammen: „Die Verwaltung, bisher wesentlich Ordnungsgarant, wurde jetzt auch wesentlich Leistungsträger.“[84] Leistungen der Verwaltung werden so zu einem wichtigen Legitimationsmoment staatlicher Herrschaft. Zugleich setzt der Aufstieg des intervenierenden Staates das Individuum den Eingriffen der Verwaltung in bis dahin unbekanntem Maße aus. Das verstärkt die Notwendigkeit einer tragfähigen Legitimationsbasis der öffentlichen Gewalt besonders mit Blick auf das wirtschaftlich starke, aber politisch eher schwache Bürgertum, das die infrastrukturellen Segnungen des modernen Staates zwar begrüßt, als Ausgleich für die wachsende Staatsmacht gleichzeitig aber Garantien zur Sicherung der Freiheit, insbesondere in wirtschaftlicher Hinsicht, verlangt. Größere demokratische Partizipation erscheint vielen dagegen politisch unerreichbar. Verfassungsrechtliche Institutionen allein können dem bürgerlichen Verlangen dabei freilich kaum genügen; sie sind von fraglichem Nutzen, solange keine Umsetzung in der Verwaltungspraxis erfolgt.[85] Etwas Umfassenderes wird gebraucht: der „Rechtsstaat“.[86]
29
In dieser Tradition impliziert der Begriff des „Rechtsstaates“ die Bindung der öffentlichen Gewalt an eine Reihe fundamentaler Rechtsprinzipien eher verwaltungs- denn verfassungsrechtlicher Natur,[87] die das Handeln der Verwaltung regeln und eine gewisse Absicherung gegen die (monarchische) Exekutive bieten. Ein Schlüsselbegriff ist die sog. Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. Dazu gehören die Gesetzesbindung der Exekutive (Vorrang des Gesetzes), der Vorbehalt des Gesetzes für administrative Eingriffe in Freiheits- und Eigentumsrechte, sowie ergänzende, zumindest verwaltungsinterne, Kontrollmechanismen.[88] Der Rechtsstaat wird damit zum Synonym für die Domestizierung und Rationalisierung der öffentlichen Gewalt und gilt als Antipode des absolutistischen Machtstaates.[89] „Rechtstaat“ ist in diesem Verständnis ohne Demokratie möglich, wird gar als eine Art „Ersatz“ gedacht. Dies erklärt manche Denkfigur zum europäischen Rechtsraum, etwa wenn Joseph H. Kaiser 1965 mit Blick auf die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft vom Beruf seiner Zeit sprach, einen europäischen Rechtsstaat, aber eben keine europäische Demokratie zu schaffen.[90]