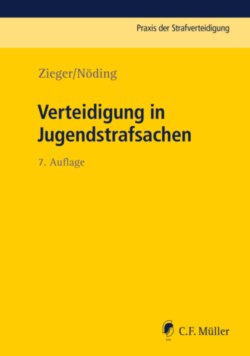Читать книгу Verteidigung in Jugendstrafsachen - Matthias Zieger - Страница 28
1. Bedeutung des Erziehungsgedankens
Оглавление31
Während Fehlverhaltensweisen und Fehlentwicklungen von Kindern unter 14 Jahren nur mit den Angeboten des Jugendhilferechts[1] und den Eingriffsmöglichkeiten des Familien- und Vormundschaftsrechts (§ 1666 BGB) begegnet werden kann, tritt für Jugendliche ab 14 Jahren das „Erziehungsstrafrecht“ neben das Jugendhilferecht. § 12 JGG verbindet Jugendstrafrecht und Jugendhilferecht, wenn dort Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII) und Heimerziehung (§ 34 SGB VIII) als Erziehungsmaßregeln angeordnet werden dürfen. Deshalb soll nach der Intention des Gesetzgebers der Jugendrichter nach Möglichkeit zugleich auch Vormundschaftsrichter sein (§ 34 Abs. 2 Satz 1 JGG), wobei diese Aufgabenverbindung in der Praxis eher die Ausnahme darstellt.
32
§ 2 Abs. 1 JGG normiert an zentraler Stelle das Ziel der Anwendung des Jugendstrafrechts: Es soll „erneuten Straftaten eines Jugendlichen oder Heranwachsenden entgegenwirken“. Der Erziehungsgedanke, der auch in §§ 5, 18 Abs. 2, 21 Abs. 1 JGG zum Ausdruck kommt, ist dabei Grund, Rechtfertigung und Grenze für die Anwendung des Jugendstrafrechts. Zwar ist Aufgabe des Jugendstrafrechts auch der Schutz der Allgemeinheit vor Straftätern. Die Erziehung ist aber nach dem Willen des Gesetzgebers das zur Zweckerreichung einzusetzende Mittel. Es geht um „Erziehung zum Legalverhalten“. Die „Erziehungsstrafe“ soll die Allgemeinheit dadurch vor weiteren Straftaten des jungen Angeklagten schützen, dass auf ihn mit den besonderen, erzieherisch ausgestalteten Einwirkungsmöglichkeiten des JGG Einfluss ausgeübt wird. Das Jugendstrafrecht hat in all seinen Anwendungsbereichen Vorrang vor dem Erwachsenenstrafrecht (§ 2 JGG). Die Person des Beschuldigten, die Möglichkeiten seiner erzieherischen Beeinflussung im Sinne künftigen Legalverhaltens stehen im Vordergrund, nicht dagegen die Verteidigung der Rechtsordnung. Generalpräventive Zwecke im Sinne der Abschreckung anderer potentieller Täter dürfen im Rahmen der jugendstrafrechtlichen Sanktionsfindung nicht verfolgt werden.[2] Das Jugendstrafrecht ist grundsätzlich spezialpräventiv ausgerichtet.[3]
Diese Zielsetzung steht nicht im Belieben des Gesetzgebers. Strafrecht und Strafvollzug müssen nach der Entscheidung des BVerfG vom 31.5.2006 wegen Art. 1 Abs. 1, 6 Abs. 2 u. 3 GG auf die besondere Situation junger Menschen Rücksicht nehmen. Es heißt dort:
„Jugendliche befinden sich biologisch, psychisch und sozial in einem Stadium des Übergangs, das typischerweise mit Spannungen, Unsicherheiten und Anpassungsschwierigkeiten, häufig auch in der Aneignung von Verhaltensnormen, verbunden ist. Zudem steht der Jugendliche noch in einem Alter, in dem nicht nur er selbst, sondern auch andere für seine Entwicklung verantwortlich sind. Die Fehlentwicklung, die sich in gravierenden Straftaten eines Jugendlichen äußert, steht in besonders dichtem und oft auch besonders offensichtlichem Zusammenhang mit einem Umfeld und Umständen, die ihn geprägt haben … Ein der Achtung der Menschenwürde und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit staatlichen Strafens verpflichteter Strafvollzug muss diesen Besonderheiten, die jedenfalls bei einem noch jugendhaften Entwicklungsstand größtenteils auch auf Heranwachsende zutreffen, Rechnung tragen.“[4]
Der Erziehungsgedanke im Jugendstrafrecht wird allerdings immer wieder auch kritisiert, weil junge Beschuldigte unter Berufung auf angeblich erzieherische Notwendigkeiten manchmal härter bestraft werden als Erwachsene. So werden insbesondere wiederholt begangene Bagatelldelikte aus vermeintlicher „erzieherischer Konsequenz“ oder um „die erforderliche erzieherische Einwirkung“ zu ermöglichen (§ 18 Abs. 2 JGG) bei Jugendlichen härter geahndet als bei Erwachsenen. Problematisch ist auch, dass der Jugendliche im Jugendgerichtsverfahren nicht nur eine Verurteilung seines Tatverhaltens, sondern oft darüber hinaus eine Herabsetzung seiner Person erlebt, wenn ihm unter Berücksichtigung seines sonstigen Verhaltens und seiner Lebenssituation z.B. „schädliche Neigungen“ i.S.d. § 17 Abs. 2 JGG nachgesagt werden. Vorschriften, welche die erzieherische Qualität des Jugendstrafverfahrens sichern, gibt es nur im Bereich der Jugendhilfe (§ 52 SGB VIII), für die übrigen Verfahrensbeteiligten höchstens als unverbindliche Sollvorschriften (§§ 35 Abs. 2 Satz 2, 37 JGG). Der Beginn des Strafverfahrens – regelmäßig entsteht der erste Kontakt zur Kriminalpolizei – ist im JGG überhaupt nicht geregelt und schon gar nicht erzieherisch gestaltet. Alle diese Feststellungen münden in die zugespitzte Behauptung, das Jugendstrafrecht sei kein Segen, sondern eine Strafe für die Jugend.[5] In seinem Gutachten für den 64. Deutschen Juristentag 2002 schlug deshalb H.-J. Albrecht zwar einerseits die Beibehaltung der Strafmündigkeitsgrenze von 14 Jahren und die generelle Einbeziehung von Heranwachsenden in das Jugendstrafrecht vor, wollte aber anderseits den teils nichtssagenden, teils in seinen Auswirkungen schädlichen Erziehungsgedanken als Grundlage des Jugendstrafrechts und als Leitlinie für die Bemessung von jugendstrafrechtlichen Sanktionen ganz aufzugeben und ersetzen durch die Anerkennung einer regelmäßig geringeren Schuld junger Täter, verbunden mit einem geringeren Normstabilisierungsbedürfnis, die Anwendung des Subsidiaritäts- und Verhältnismäßigkeitsprinzips und die Berücksichtigung der schädlichen Folgen insbesondere von freiheitsentziehenden Sanktionen bei Jugendlichen und Heranwachsenden,[6] hat sich mit diesem Vorschlag aber nicht durchgesetzt.
Diese Überlegungen müssen den Verteidiger veranlassen, für die strikte Einhaltung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, des Subsidiaritätsprinzips (§§ 5, 17 Abs. 2 JGG) einzutreten und mit Hinweis darauf, dass Jugendstrafrecht eben immer auch Strafrecht bleibt, darüber zu wachen, dass die Schuldschwere die Grenze jeglicher jugendrichterlicher Sanktion sein muss.[7] Nicht die Lebensführung eines Jugendlichen überhaupt steht zur Beurteilung des Jugendrichters, vielmehr sind Maßnahmen des Erziehungsstrafrechts stets nur „aus Anlass der Straftat eines Jugendlichen“ (§ 5 Abs. 1 JGG) zu prüfen und ggf. anzuordnen. Werden diese Grundsätze ernst genommen und damit die Gefahr einer die Jugendlichen gegenüber Erwachsenen benachteiligenden Erziehungsideologie gebannt, wird sich die Anwendung des Jugendstrafrechts regelmäßig zugunsten des jungen Mandanten auswirken und der Erziehungsgedanke die jugendstrafrechtliche Reaktion angemessen begrenzen.
33
Das JGG definiert das Erziehungsziel in § 2 Abs. 1 JGG dahin, dass die Anwendung des Jugendstrafrechts neuen Straftaten entgegenwirken soll. In § 21 Abs. 1 JGG spricht es von dem angestrebten „künftig rechtschaffenen Lebenswandel“. Da die Erziehung im Jugendstrafrecht Mittel zum Schutz der Allgemeinheit vor weiteren Straftaten des jungen Täters ist, kann die dem Jugendgericht zugewiesene erzieherische Einwirkung auf den Angeklagten nicht weiter gehen, als dies für ein Leben ohne Straftaten unerlässlich ist. Das folgt auch aus dem Schuldprinzip: Nur „aus Anlass einer Straftat“ darf eine Sanktion erfolgen (§ 5 JGG), also nur so weit, wie das für ein Leben ohne Straftaten erforderlich ist.[8] Es wäre deshalb unzulässig, wenn ein Richter allein deshalb, weil er die bisherige Erziehung für verfehlt hält und ihr eine neue Richtung und neue Inhalte geben will, bestimmte Erziehungsmaßregeln anordnet. Das Schlagwort aus der Berliner Hausbesetzerbewegung „Sie wollen unser Bestes, aber das sollen sie nicht haben“ hat so gesehen also durchaus seine Berechtigung. Erzieherische Einwirkung auf den Jugendlichen mit den Mitteln des Jugendstrafrechts ist nur zulässig, soweit dies erforderlich ist, um ihn von der Begehung weiterer Straftaten abzuhalten.
Im Anschluss an die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 16.1.2003 zum Recht der Eltern auf Beteiligung am Jugendstrafverfahren[9] wird wieder verstärkt darüber diskutiert, ob der Staat im Jugendstrafverfahren eigentlich befugt ist, in das vorrangige Erziehungsrecht der Eltern (Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG) durch gegen den Willen der Eltern angeordnete erzieherische Maßnahmen einzugreifen. Sein Wächteramt zum Schutz der Kinder und Jugendlichen (Art. 6 Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 GG) rechtfertigt zwar ein Eingreifen bei Erziehungsversagen der Eltern.[10] Aber nicht jede Straftat eines jungen Menschen beweist ein Versagen der Erziehungsberechtigten. Zwar wird der auch den Jugendgerichten aufgegebene Rechtsgüterschutz auch in diesen Fällen jugendrichterliche Maßnahmen erlauben. Es bedarf dann einer Konkordanz der in Rede stehenden Rechtsgüter und Rechte.[11] Erziehungsmaßregeln sollten dann möglichst einvernehmlich, jedenfalls unter Beteiligung der Eltern nach dem Leitbild des § 10 Abs. 2 JGG (Notwendigkeit der Zustimmung der Eltern, dort allerdings nur nötig zur heilerzieherischen Behandlung oder Entziehungskur) angeordnet werden.[12]
Teil 2 Materielles Jugendstrafrecht › I. Grundzüge des JGG › 2. Anwendungsbereich des Jugendstrafrechts, Verhältnis zum allgemeinen Strafrecht