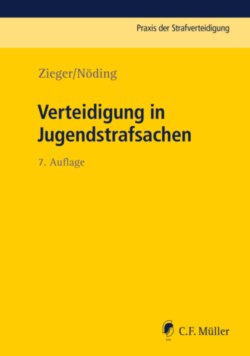Читать книгу Verteidigung in Jugendstrafsachen - Matthias Zieger - Страница 33
1. Strafmündigkeit und Verantwortungsreife
Оглавление39
Nach § 19 StGB ist als Kind schuldunfähig, wer noch nicht 14 Jahre alt ist. Während Kinder also nicht strafmündig sind, geht § 3 JGG bei Jugendlichen (14–18 Jahre) von einer „relativen“ bzw. „bedingten Strafmündigkeit“ aus. Es muss jeweils die Verantwortungsreife („Entwicklungsreife“) zum Zeitpunkt der Tatbegehung geprüft und festgestellt werden, sie darf nicht unbesehen unterstellt werden. Dagegen folgt aus der Nichterwähnung des § 3 JGG in § 105 Abs. 1 JGG, dass bei Heranwachsenden (18–21 Jahre) die Strafmündigkeit unabhängig von der Frage, ob Jugendstrafrecht angewandt wird oder nicht, stets zu bejahen ist.
Es gibt immer wieder Stimmen, die für eine Änderung dieser Strafmündigkeitsgrenze eintreten. Teils wird eine Heraufsetzung des Strafmündigkeitsalters auf 16 Jahre,[1] teils auch nur eine partielle Herausnahme der 14- und 15-Jährigen aus dem personellen Anwendungsbereich der Jugendstrafe[2] gefordert. Sobald von Kindern begangene Straftaten ein gewisses Medienecho finden, werden dagegen – meist aus dem rechtskonservativen politischen Spektrum – Rufe nach einer Absenkung der Strafmündigkeitsgrenze laut.[3]
Die Verantwortungsreife nach § 3 JGG muss als Schuldvoraussetzung jeweils positiv festgestellt werden. Bei nicht zu beseitigenden Zweifeln an ihrem Vorliegen ist die Verantwortungsreife zu verneinen.[4]
§ 3 Satz 1 JGG verlangt als Voraussetzungen der Verantwortungsreife zunächst die Einsichtsfähigkeit, also die ethische Reife („nach seiner sittlichen Entwicklung“) und die Verstandesreife („nach seiner geistigen Entwicklung“). Voraussetzung der Einsichtsfähigkeit ist, dass das Unrechtsbewusstsein gefühlsmäßig beim Jugendlichen verankert ist. Er muss Recht und Unrecht intellektuell unterscheiden können. Der Jugendliche muss wissen, dass das konkrete Verhalten Unrecht ist. Dafür ist nicht erforderlich, dass er die einzelnen Rechtsbegriffe des von ihm verwirklichten Straftatbestandes kennt. Ausreichend ist, dass er die tatsächlichen Umstände, aus denen sich die Strafbarkeit seines Verhaltens ergibt, kennt und als rechtlich verboten einschätzt.[5]
Er muss weiter die Handlungsfähigkeit (Steuerungsfähigkeit), also die Fähigkeit besitzen, sein Verhalten nach dieser Einsicht einzurichten.[6] Sie darf nicht einfach aus der Einsichtsfähigkeit gefolgert werden. Sie kann nur aus einem generalisierenden Vergleich mit anderen, tatähnlichen Situationen und der Fähigkeit, das als Unrecht erkannte Handeln zu unterlassen, gefolgert werden.[7]
Die Verantwortungsreife ist keine Eigenschaft, die für alle denkbaren Tatbestandsverwirklichungen ein für alle Mal festgestellt wird. Anerkannt ist vielmehr die „Teilbarkeit der Strafmündigkeit“. Ein Jugendlicher weiß zumeist, dass man ein fremdes Fahrrad nicht stehlen darf, manche Jugendliche können sich aber nicht vorstellen, dass der Verkauf eines gestohlenen Fahrrades an einen Gutgläubigen ebenfalls strafbar ist (den Tatbestand des Betruges erfüllt). Ein Jugendlicher wird im Regelfall wissen, dass er eine andere Person nicht verletzten darf (§ 223 StGB); er kann aber wegen seiner noch kindlich strukturierten Persönlichkeitsstruktur zugleich nicht in der Lage gewesen sein zu erkennen, dass seine körperlichen Einwirkungen den Tod seines Opfers herbeiführen konnten (§ 227 StGB).[8] Daraus folgt, dass jeweils für das konkrete, in Rede stehende Delikt – auch und gerade bei tateinheitlicher Begehung – die Verantwortungsreife besonders geprüft und bejaht werden muss, um zu einem Schuldspruch gelangen zu können.[9]
Eine sorgfältige Prüfung der Verantwortungsreife findet in der Praxis kaum statt. Sie wird in Urteilen floskelhaft bejaht. Das mag daran liegen, dass der Reifebegriff so schwer fassbar und seine Abgrenzung zum Verbotsirrtum und zur Schuldfähigkeit unklar ist.[10]
Hinweis
Fehlt in einem Urteil die positive Feststellung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit der verurteilten Jugendlichen gänzlich, so stellt dies einen Revisionsgrund dar, auf dem das Urteil beruht und der im Regelfall zur Aufhebung des Urteils führen wird.[11] Es lohnt sich also – vor allem nur mit der Revision angreifbare – Urteile auf das eventuelle Fehlen entsprechender Feststellungen zur Verantwortlichkeit durchzusehen.
Teil 2 Materielles Jugendstrafrecht › II. Verantwortungsreife › 2. Abgrenzung zum Verbotsirrtum und zur Schuldfähigkeit