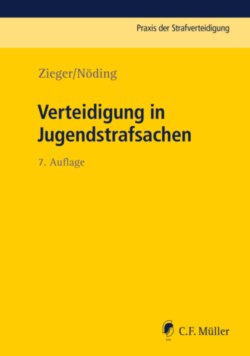Читать книгу Verteidigung in Jugendstrafsachen - Matthias Zieger - Страница 29
2. Anwendungsbereich des Jugendstrafrechts, Verhältnis zum allgemeinen Strafrecht
Оглавление34
Das Jugendstrafrecht findet nach § 1 JGG Anwendung, wenn ein Jugendlicher oder ein Heranwachsender eine „Verfehlung“ begeht, die nach den allgemeinen Vorschriften mit Strafe bedroht ist. Gemeint sind also nur Verbrechen und Vergehen. Somit sind Ordnungswidrigkeiten, da sie nur mit einem Bußgeld geahndet werden können, keine Verfehlungen. Für sie gilt das OWiG, jedoch werden die Vorschriften des JGG sinngemäß auf das Bußgeldverfahren angewandt, soweit § 46 Abs. 1 OWiG nichts anderes bestimmt.[13]
Die Altersgrenzen für Jugendliche (14–17 Jahre) und Heranwachsende (18–20 Jahre) definiert § 1 Abs. 2 JGG. Maßgebend ist das Alter im Zeitpunkt der Tatbegehung. Kinder unter 14 Jahren sind strafunmündig, ihnen fehlt die Schuldfähigkeit (§ 19 StGB). Ein evtl. erforderliches Einschreiten obliegt allein den Erziehungsinstanzen (Eltern, Schule, Jugendamt, Vormundschaftsrichter).[14]
35
Jugendstrafrecht ist in erster Linie Rechtsfolgenrecht. Es enthält darüber hinaus aber auch eine Anzahl besonderer Vorschriften zu Gerichtsverfassung und Jugendstrafverfahren (§§ 39–81a, 102–109, 112 JGG).
§ 2 Abs. 2 JGG erklärt im Übrigen die allgemeinen, im Erwachsenenstraf- und Strafverfahrensrecht geltenden Vorschriften für anwendbar, soweit das JGG nichts anderes bestimmt. Hier ist aber zu fragen, ob es nicht mit Rücksicht auf die Besonderheiten jugendlicher Delinquenz geboten ist, das Straf- und Strafprozessrechts jugendadäquat auszulegen. Kann eine Jugendgruppe wirklich als „Bande“ z.B. i.S.d. § 244 Abs. 1 Nr. 2 StGB (Bandendiebstahl) angesehen werden?[15] Mehr auf der Ebene der tatsächlichen Feststellungen liegt es, dass jugendlicher Jargon für jede Art von Messereinsatz („ich habe ihn abgestochen“) nicht ohne weiteres als Bekenntnis eines Tötungsvorsatzes missverstanden werden darf. Ähnliches gilt bei der Auslegung des Bedrohungstatbestandes (§ 241 StGB) im Hinblick auf jugendtümliche Groß- und Wichtigtuerei.[16] Auch im „Abziehen“ von Statussymbolen (Handy, Markenkleidung) darf nicht einfach nur die Erfüllung des Raubtatbestandes, vielmehr muss erkannt werden, dass es hier zumindest auch um das Ausleben von jugendlichen Überlegenheitsgefühlen geht.[17]
36
Die §§ 5–7 JGG enthalten eine abschließende Aufzählung der Rechtsfolgen, die im Jugendstrafrecht zulässig sind (Erziehungsmaßregeln, Zuchtmittel, Jugendstrafe, Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder in einer Entziehungsanstalt, Sicherungsverwahrung, Führungsaufsicht, Entziehung der Fahrerlaubnis). Da die Strafrahmen des Erwachsenenstrafrechts grundsätzlich nicht gelten, ist die Klarstellung in § 4 JGG erforderlich, dass für die Frage, ob eine Tat ein Verbrechen oder ein Vergehen darstellt, das Erwachsenenstrafrecht maßgeblich ist.
Dagegen können alle im Erwachsenenstrafrecht vorgesehenen Nebenfolgen eintreten mit Ausnahme der in § 6 JGG aufgezählten Folgen (betreffend öffentliche Ämter, aktives und passives Wahlrecht). Fraglich ist nach der Reform der Vorschriften zur Vermögensabschöpfung im Jahr 2017 aber auch weiterhin, ob die Einziehung des Wertes von Taterträgen (§ 73c StGB n.F.) und die Einziehung des Wertes von Tatprodukten, Tatmitteln und Tatobjekten (§ 74c StGB n.F.) im Anwendungsbereich des Jugendstrafrecht unzulässig ist oder als Nebenfolgen über § 6 JGG entsprechende Anordnung getroffen werden können.[18]
37
Die Rechtsfolgen und Verfahrensregeln im Jugendstrafrecht sind nicht immer „milder“ oder „günstiger“ als diejenigen des Erwachsenenstrafrechts, sie sind vielmehr „anders“.[19] In manchen Vorschriften benachteiligt das Jugendstrafrecht junge Straftäter: Gegen einen Erwachsenen kann ein Verfahren gegen Auflagen nach § 153a StPO mit seiner Zustimmung und mit derjenigen des Gerichts eingestellt werden, ohne dass der Beschuldigte ein Geständnis ablegen muss. Die vergleichbare Vorschrift in § 45 Abs. 3 JGG verlangt aber, dass der Beschuldigte geständig ist. Während bei Erwachsenen das Mindestmaß der Freiheitsstrafe nur einen Monat beträgt (§ 38 Abs. 2 StGB), beträgt die Jugendstrafe mindestens sechs Monate (§ 18 Abs. 1 Satz 1 JGG). Wo Erwachsene mit einer kleinen Geldstrafe davonkommen, können Jugendliche angewiesen werden, an einem zeitaufwändigen sozialen Trainingskurs teilzunehmen (§ 10 Abs. 1 Satz 3 Nr. 6 JGG) oder Arbeitsleistungen zu erbringen (§ 10 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 JGG). § 52a JGG lässt es zu, dass der Richter die Anrechnung der Untersuchungshaft auf die Jugendstrafe ganz oder teilweise unterlässt, wenn eine Anrechnung im Hinblick auf das Verhalten des Angeklagten nach der Tat oder aus erzieherischen Gründen nicht gerechtfertigt ist. Bei Erwachsenen gilt nach § 51 Abs. 1 Satz 2 StGB nur die erste Alternative. Im Jugendstrafrecht sind die Rechtsmittelmöglichkeiten sachlich und instanziell gegenüber dem Erwachsenenstrafrecht beschränkt (§ 55 JGG). Bei Tatbegehung in unterschiedlichen Reifestufen kann die Bildung einer Gesamtstrafe ausgeschlossen sein.[20] Benachteiligungen gibt es auch noch in anderen Punkten: obligatorische Bestellung von Bewährungshelfern, § 24 Abs. 1 JGG; Möglichkeit der Teilvollstreckung vor Rechtskraft, § 56 JGG; Eintragung von Einstellungen in das Erziehungsregister, § 60 Abs. 1 Nr. 7 BZRG.
Dies sind Widersprüche zwischen Jugend- und Erwachsenenstrafrecht, die materiell und prozessual dem Verbot der Schlechterstellung zu widersprechen scheinen. Aus der generell geringeren Schuld junger Täter, dem Verhältnismäßigkeitsprinzip, dem Grundsatz, dass die Strafe nicht höher sein darf als die Schuld des Angeklagten, und aus der Pflicht, die geringere soziale Kompetenz junger Beschuldigten zu berücksichtigen, wird der Grundsatz hergeleitet, dass Jugendliche im Jugendstrafverfahren materiell und prozessual nicht schlechter gestellt sein dürfen als Erwachsene im Erwachsenenstrafverfahren.[21] Die genannten Vorschriften sind gesetzlich geregelte Ausnahmen von diesem Verbot. Der Verteidiger muss sich deshalb unter Berufung auf das grundsätzliche Verbot der Schlechterstellung bemühen, die Benachteiligungen für seine jungen Mandanten z.B. dadurch gering zu halten, dass er geltend macht, dass das Fehlverhalten, das bei einem Erwachsenen nur zu einer Freiheitsstrafe unter sechs Monaten führen würde, im Jugendstrafrecht dann eben nicht mit Jugendstrafe, sondern nur mit Erziehungsmaßregeln oder Zuchtmitteln geahndet werden darf,[22] und bei einem nicht geständigen jungen Mandanten muss er verstärkte Bemühungen unternehmen, die Einstellung des Verfahrens wenn nicht nach § 153 StPO i.V.m. § 45 Abs. 1 JGG, so doch zumindest nach § 45 Abs. 2 JGG (Einstellung wegen anderweitiger erzieherischer Maßnahme) oder nach § 153a StPO[23] durchzusetzen, was bei diesen Alternativen auch ohne Geständnis möglich ist. Er hat außerdem die Möglichkeit und die Pflicht, bei der Anwendung der durch Sonderbestimmungen des JGG nicht ausgeschlossenen Verfahrensregeln der StPO (z.B.: Ausgestaltung der Belehrung, Sitzungspolizei) auf eine den Grundsätzen des Jugendstrafrechts und der geringeren sozialen Kompetenz der Angeklagten Rechnung tragende Auslegung hinzuwirken.[24]
38
Per Saldo ist aber das Jugendstrafrecht regelmäßig das günstigere Recht:
| • | Bei Jugendlichen muss zusätzlich die Verantwortungsreife positiv festgestellt werden (§ 3 JGG), |
| • | es gibt einen viel größeren Bereich ambulanter und informeller Reaktionsmöglichkeiten (§§ 10, 15, 45, 47 JGG), |
| • | die Anordnung von Untersuchungshaft ist erschwert (§§ 71 Abs. 2, 72 JGG), |
| • | der Anwendungsbereich der Pflichtverteidigung ist ausgeweitet (§ 68 JGG), |
| • | die notwendig zu beteiligende Jugendgerichtshilfe leistet nicht nur dem Gericht Aufklärungs- und Entscheidungshilfe, sondern auch dem jungen Beschuldigten Beratung, Beistand und Hilfe und regt Diversionsmöglichkeiten an (§ 38 JGG, § 52 SGB VIII), |
| • | es kann auch bei einem Schuldspruch davon abgesehen werden, dem Angeklagten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen (§ 74 JGG), |
| • | es gibt erweiterte Bewährungsmöglichkeiten (§§ 21, 27, 61 ff. JGG), |
| • | die Einheitsstrafenbildung (§ 31 Abs. 1 JGG) ermöglicht die Festsetzung einheitlicher Maßnahmen bei tatmehrheitlich begangenen Straftaten unter im Vergleich zur Gesamtstrafenbildung des Erwachsenenstrafrechts deutlich weiteren Anwendungsvoraussetzungen, |
| • | über die Anwendung des § 31 Abs. 3 JGG können Jugendstrafen nebeneinander gestellt und zur Bewährung ausgesetzt werden, die insgesamt deutlich über dem an sich bewährungsfähigen Strafmaß liegen: Die Restjugendstrafe kann nach Teilverbüßung viel früher zur Bewährung ausgesetzt werden als bei Erwachsenen (§ 88 JGG). |
Deswegen wird sich der Verteidiger regelmäßig für die Anwendung des Jugendstrafrechts einsetzen. Auch in der Rechtsprechung ist anerkannt, dass z.B. dann, wenn das Alter eines jungen Angeklagten nicht sicher festzustellen ist, nach dem Grundsatz „in dubio pro reo“ das Jugendstrafrecht anzuwenden ist.[25]
Das Jugendstrafrecht strahlt zugunsten junger Erwachsener sogar auf das Erwachsenenstrafrecht aus („Fernwirkung des Jugendstrafrechts“). Dies folgt zum einen aus § 114 JGG, wonach bis zum 24. Lebensjahr Freiheitsstrafe in einer Jugendstrafvollzugsanstalt vollzogen werden kann.[26] Ansonsten gibt es bei jungen Erwachsenen nach der Rechtsprechung Milderungsmöglichkeiten, beispielweise beim „minder schweren Fall“,[27] bei der Bemessung von Freiheits- oder Geldstrafe,[28] bei der Bewährung oder wenn ein junger Erwachsener eine Tat aus einer Gruppensituation („um nicht als Schwächling dazustehen“) begangen hat.[29]