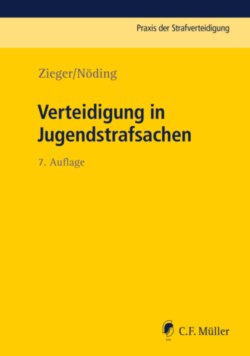Читать книгу Verteidigung in Jugendstrafsachen - Matthias Zieger - Страница 35
3. Prüfung der Verantwortungsreife
Оглавление41
§ 3 JGG führt in der jugendrichterlichen Praxis zu Unrecht nur ein Schattendasein. Danach ist ein Jugendlicher (nur dann) strafrechtlich verantwortlich, „wenn er zur Zeit der Tat nach seiner sittlichen und geistigen Entwicklung reif genug ist, das Unrecht der Tat einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln“. Wird der Gesetzesanspruch ernst genommen und werden Ermittlungen in dem durch § 43 JGG vorgegebenen Umfang auch hierzu durchgeführt, gibt es eine Reihe von tat- und täterbezogenen Konstellationen, in denen sich eine nähere Prüfung der Verantwortungsreife aufdrängt, wobei über den Bericht der Jugendgerichtshilfe (§ 38 Abs. 2 JGG) hinaus das Gericht sich oft auch auf ein nach § 43 Abs. 2 JGG einzuholendes Sachverständigengutachten wird stützen müssen.[19]
S. Muster 5 Rn. 272, Antrag auf Begutachtung zur Verantwortungsreife.
42
Entgegen der Rechtspraxis ist die Verantwortungsreife nicht nur in den Fällen zweifelhaft, in denen eine Extremsituation eine altersgemäße Sozialisation unmöglich machte, z.B. bei längerer sozialer Isolation,[20] sondern auch bei vielen anderen tat- und täterbezogenen Fallgruppen. Das zeigt der gelungene Formulierungsvorschlag der Jugendstrafrechtsreform-Kommission der DVJJ auf:[21]
„Die Einsichtsfähigkeit liegt regelmäßig nicht vor, wenn die strafbare Handlung Rechtsgüter verletzt oder gefährdet, deren Schutzwürdigkeit alterstypisch nicht erkannt wurde oder wenn sie lediglich Ausdruck einer kindlichen Einstellung war. Die Steuerungsfähigkeit kann insbesondere dann fehlen, wenn der Jugendliche die Tat unter dem beherrschenden Einfluss anderer oder in einer vergleichbaren Konfliktsituation begeht.“
Für die Praxis des Strafverteidigers empfiehlt sich die Orientierung an anerkannten Fallgruppen. Die Verantwortungsreife ist insbesondere dann fraglich,
| • | wenn der Täter erst 14 oder 15 Jahre alt ist – je jünger ein Täter ist, desto eher können Zweifel an der strafrechtlichen Verantwortlichkeit im Sinne des § 3 JGG bestehen,[22] |
| • | wenn schon in strafunmündigem Alter begonnene Straftaten fortgesetzt werden,[23] |
| • | wenn es um „komplizierte Straftatbestände“ geht (z.B. Verstöße gegen das PflVG, Bestechung, Hehlerei, Betrug),[24] |
| • | bei Fahrlässigkeitstaten, dort insb. bei unbewusster Fahrlässigkeit,[25] |
| • | bei Diebstahlstaten, wenn der Jugendliche durch aggressive Werbung verführt wird,[26] |
| • | bei Straftaten, die aus dem Spiel heraus entstanden sind,[27] |
| • | bei einer Straftat aus einem für den jungen Menschen schwer zu bewältigenden Konflikt heraus,[28] |
| • | bei Taten junger Ausländer oder Flüchtlinge bzw. bei Taten, die aus Kulturkonflikten heraus begangen werden,[29] |
| • | bei Straftaten, die junge Täter zusammen mit ihren Eltern oder älteren Geschwistern auf deren Veranlassung hin begehen,[30] |
| • | bei Intelligenzminderung oberhalb der Schwelle psychiatrischer Diagnosen,[31] |
| • | wenn ein junger Mensch schwere Sozialisationsdefizite aufzuweisen hat,[32] |
| • | wenn die Taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung Bezug zu Entwicklungsproblemen (Pubertät) des Täters haben.[33] |
Zur sachverständigen Prüfung, ob im Einzelfall die Voraussetzungen des § 3 JGG vorliegen, ist in erster Linie ein Jugendpsychologe berufen,[34] auch wenn die Praxis meist auf die im Erwachsenenstrafrecht tätigen forensischen Psychiater zurückgreift. Um überhaupt eine sachverständige Begutachtung durchzusetzen, wird der Verteidiger nicht nur darauf hinweisen, welche anerkannte Fallgruppe vorliegt, die eine besonders sorgfältige Prüfung der Verantwortungsreife nahe legt. Er wird gegenüber dem stets zu hörenden Einwand, dass der Jugendrichter genug Erfahrung hat,[35] um aus dem Eindruck, den er aus dem Bericht der Jugendgerichtshilfe und in der Hauptverhandlung von dem Jugendlichen gewinnt, die notwendigen Schlüsse auf die Verantwortungsreife zu ziehen, darauf hinzuweisen haben, dass es nach dem insoweit eindeutigen Wortlaut des § 3 Satz 1 JGG nicht auf den Reifeeindruck ankommt, den der Jugendrichter in der Hauptverhandlung gewinnt, sondern auf die Reife, die der Jugendliche „zur Zeit der Tat“ hatte und dass es für die insoweit notwendigen rückblickenden Betrachtungen unbedingt entwicklungspsychologischen Fachwissens und Sachverstandes bedarf.
Kann die Verantwortungsreife nicht festgestellt werden, ist das Verfahren im Vorverfahren nach § 170 Abs. 2 StPO einzustellen, im Zwischenverfahren die Eröffnung des Hauptverfahrens nach § 204 StPO abzulehnen, in der Hauptverhandlung kann der Richter zwischen Freispruch und Einstellung nach § 47 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 JGG wählen.[36] Trotz der registerrechtlichen Folgen (Eintragung in das Erziehungsregister) wird der Richter die Einstellung vorziehen,[37] weil er sonst befürchtet, dass der junge Angeklagte, der vielleicht sogar ein Geständnis abgelegt hat, den Freispruch missversteht als Freibrief für ähnliche Taten. Auch der Verteidiger hat nicht unbedingt ein Interesse daran, dass die objektive Strafbarkeit des Verhaltens seines Mandanten im mangels Verantwortungsreife freisprechenden Urteil „festgeschrieben“ wird. Auch bei einer Einstellung mangels Verantwortungsreife sind die notwendigen Auslagen der Justizkasse aufzuerlegen, denn das „Ermessen“ des Jugendrichters besteht ja nur in der Wahl zwischen Einstellung oder Freispruch (§ 47 Abs. 2 JGG i.V.m. §§ 464, 467 Abs. 1 u. 4 StPO).