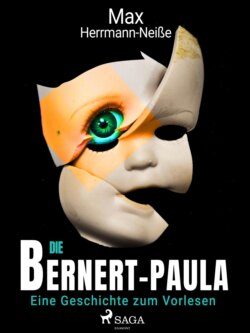Читать книгу Die Bernert-Paula. Eine Geschichte zum Vorlesen - Max Herrmann-Neisse - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
X
ОглавлениеIm Frühling 1914 hatte Paula, unbeschadet ihres dauerhaften Verhältnisses mit Frau Elfriede Goller, wieder einmal eine reelle Liebschaft mit einem jungen Mann, der ihr gesellschaftlich näher stand: dem Uhrmachergehilfen Emil Klose. Die handfesten erotischen Genüsse waren immer neben der nützlichen Spielerei mit Elfriede erledigt worden und ein Privatbezirk geblieben, in den man dem Honoratiorenfrauchen keinen Einblick gewährte, ja, von dem sie nicht einmal etwas ahnte. Die Partner waren meist verdorbene Gassenreudel, die Paulas Körperfehler nicht störte. Durch Paulas unersättliche Geilheit, ihre unerschöpfliche Erfindungsgabe auf dem Gebiet lasterhafter Worte und Werke, durch ihre völlige Vorurteilslosigkeit und Schamlosigkeit, wurde da ein kleines ästhetisches Manko mehr als aufgehoben. Alle diese Bekanntschaften waren natürlich flüchtig geblieben: man traf sich, war grade in Stimmung, tat an allen möglichen und unmöglichen Orten das Vergnügliche, Verbotene, behielt sich in gutem Angedenken. Je nach Temperament und Charakter erzählte einer dann später wohl noch anerkennend: »Die Bernert-Paula, das ist Ihnen ein Aas!« oder verlogen kritisch: »Eigentlich hat es mich nachher angekotzt.« Jedenfalls herrschte ein reger Durchgangsverkehr, und im Saal zur »Sonne« spielte die Tanzmusik sonntäglich von vier bis zwölf passend: »Mein Herz, das ist ein Bienenhaus, die Mädchen sind darin die Bienen, sie fliegen ein, sie fliegen aus, grad wie in einem Bienenhaus, in meines Herzens tiefster Klause, juridirallera, juridirallera, juridiri, juridiri, juridiriridiralla!«
Mit dem Klose-Emil verhielt es sich anders. Sein Vater war Kolporteur, Mitglied der Sozialdemokratischen Partei, in einer Zeit, da so etwas noch als besondre Verworfenheit galt. Eigentlich war er ein umgänglicher, fideler Mann, durchaus kein Fanatiker. Durch vieles Bücherlesen war er zu seiner extremen Stellungnahme gekommen. Und da er seine Buchweisheit gern zum besten gab und in seiner, nie bös gemeinten Spottlust vor nichts haltmachte, wurde er des öfteren von humorlosen Gendarmen bei despektierlichen Äußerungen geschnappt. Karrieresüchtige Juristen, die schneidig einen freimütigen Witz zur Majestätsbeleidigung und eine skeptische Beurteilung der offiziellen Politik zum Landesverrat aufbauschten, schickten ihn von Zeit zu Zeit ins Gefängnis. Frau Klose, ehemalige Kellnerin, die der Sozialist aus übereilter und übertriebener Liebe zu den Opfern der Gesellschaftsordnung geheiratet hatte, nahm ihm sein anstößiges Rebellentum herzlich übel. Sein Sohn Emil hatte später unter des Vaters Verhalten wirklich zu leiden. Lehrer, um ihre der Obrigkeit wohlgefällige Gesinnung zu zeigen, quälten den wehrlosen Knaben mit gehässiger Anspielung auf »vaterlandslose Gesellen«, und in der Religionsstunde ging der Unterricht mit beleidigender Vorsicht um das räudige Schaf dieser Herde in großem Bogen herum. Aber der Junge bewunderte seinen Vater, dichtete in jugendlicher Begeisterung ihm ein heroisches Schicksal mit Opfermut und Standhaftigkeit an, spürte der Mutter Widerstreben, schimpfte es weiblichen Kleinmut, verachtete sie deswegen und ging ganz im Vater, dem leidenschaftlich geliebten und verehrten Vorbild, auf. Ihm hörte er begeistert zu, vor ihm wurde er gesprächig, gab ihm die richtigen Stichworte für die gewohnte politische Brandrede, die alles über den Haufen rannte. Der Mutter gegenüber blieb er schweigsam, im Verkehr mit Gleichaltrigen unbeholfen, argwöhnisch, zurückhaltend. Frühzeitig überfütterte er sich mit allerart Lektüre, wie sie dem Vater Kolporteur durch die Hände ging. Aber wahllos geriet ihm alles durcheinander, es war kein Plan und keine einheitliche Entwicklung dabei. Und so ergab sich, daß der Junge seinen Mitschülern, was den Umfang des Gelesenen anlangte, um viele Jahre voraus und danach für das richtige Leben unbeholfen, wirr, unbrauchbar gemacht war, mehr als der naivste, von keinerlei Literaturballast beschwerte Taugenichts. Es war sein heimlicher Traum, das Gymnasium zu besuchen und zu studieren, um Vaters Politik, besser fundiert, zum Sieger zu machen. Papa Klose, immer zuversichtlich, bestärkte den Sohn in seinen Plänen, spann sie phantasievoll weiter aus, malte mit Worten das berauschende Bild: Emil Klose als Volkstribun, seine Reichstagsrede reißt alle hin, unter der roten Fahne, mit dem Gesang der Internationale, führt man Deutschland herrlichen Zeiten entgegen. Aber er hätte wissen sollen, daß Kloses froh sein mußten, wenn sie halbwegs etwas zu beißen hätten, daß sie nie und nimmer das Schulgeld fürs Gymnasium erübrigen könnten, daß andrerseits für den Sohn des politisch Verdächtigen kein Stipendium in Frage käme, und er mit Kind und Kegel höchst unsichren, um nicht zu sagen: lausigen Zeiten entgegenzog. Frau Klose hatte zu den verstiegenen Gesprächen zwischen Vater und Sohn nur mißbilligend den Kopf geschüttelt. Doch als Emil die Volksschule hinter sich hatte und es nachweislich keine andere Möglichkeit gab, als den Jungen ein Handwerk lernen zu lassen, da nahm Emil das nicht dem Vater übel, sondern schob alle Schuld auf die Mutter. (Die Vernunft spricht gegen ihn. Aber wirklich hat er aus tieferen Gründen damit doch nicht so sehr Unrecht.) Er wurde noch verschlossener, unleidlicher, menschenscheuer, tat in seiner Lehrstelle korrekt, doch unnahbar seine Pflicht, schlang lustlos das Essen hinunter und saß, bis er vor Müdigkeit umfiel, über Büchern. Geselligkeit war durchaus nicht seine Sache und Leichtfertigkeit das Gegenteil seiner Veranlagung. Auch kümmerte er sich kaum um Mädchen. Er sah, wie verständnislos seine Mutter Vaters Idealen gegenübertrat, und schloß daraus, das ganze weibliche Geschlecht sei Höherem abhold und dem Rebellentum hinderlich. Dabei kam ihm zugute, daß er keine sehr sinnliche Natur war und unter Anfechtungen fleischlichen Gelüstes nicht zu leiden hatte.
Zur Bernert-Paula brachte ihn seine Vorliebe für die Unterdrückten und Benachteiligten, sein Mitleid mit jeder vom Schicksal schlecht behandelten Kreatur. Er lernte sie auch unter Umständen kennen, die sie ihm als ein bedauernswertes Opfer der grausamen Feigheit körperlich Überlegener erscheinen ließ.
Nachdem ihr das Verfahren mit Elfriede Kausch so gut gelungen war, hatte Paula den Musiker Kusche, dem für seine Helferdienste sehr konkrete Genüsse versprochen worden waren, immer wieder hinzuhalten gewußt. Zuletzt wurde sie übermütig und erlaubte sich unangebracht freche Späßchen mit ihm, bestellte ihn hinaus nach Davidshöhe und versetzte ihn dort, oder lud ihn, war ihre Mutter auf Arbeit, bei sich ein, hatte dann noch zwei, drei Mädel zu Gast und es kam zu nichts als einem durch albernes Geschwätz verlornen Nachmittag.
Nun aber hatte der Hoboist genug und eine massive Wut im Bauche, Zeit war es, der unverschämten Vogelscheuche einen Denkzettel zu erteilen, und er legte sich auf die Lauer. Und da Paula nicht auf ihrer Hut war, längst nicht mehr an den unwichtigen Hoboisten dachte, war er eines Abends nah am Ziel seiner gut vorbereiteten Rache.
An diesem Abend war Paulas Mutter über Erwarten früh nach Haus gekommen. Eigentlich stand ein kurzer Besuch von Frau Elfriede bevor, aber was Paula mit ihr besprechen wollte, ging die alte Bernert nichts an. Also galt es, Elfriede auf der Straße abzufangen. Kusche hatte den Jungen, der Frau Gollers Botschaft überbringen sollte, bestochen, Elfriedes Briefchen gelesen. Als er frühzeitig die Alte nach Haus kommen hörte, machte er sich auf Überraschungen gefaßt und bezog in der Flurnische einen Beobachtungsposten. Diesmal lohnte sich’s. Bald ging die Tür, tapp tapp tapp kam es den langen, winklig verbauten Korridor entlang.
Plötzlich wird Paula gepackt, bekommt sie erst mal zwei zünftige Watschen, und dann fängt der gräßliche Kerl an, Paula Stück um Stück auszuziehen. Sie wehrt sich mit Händen und Füßen, so gut sie kann, schlägt, stößt, beißt, wagt aber keinen Hilfeschrei. Oben war Mama, unten nahte vielleicht schon Frau Elfriede – es war eine peinliche, allerlei unliebsamen Komplikationen ausgesetzte Situation.
Da knarrte wirklich das Haustor. Paula wußte nicht, ob sie vor dem, was da kam, bangen oder sich darauf freuen sollte. Kusche war jedenfalls so in Rage, daß er nichts hörte. Mit einem Mal ergriff ihn jemand am Kragen, beutelte ihn gehörig hin und her, die ehrliche Entrüstung gab dem schmächtigen Klose-Emil außergewöhnliche Kräfte. Paula sah keinen andren Ausweg, als einen Ohnmachtsanfall vorzutäuschen. Sofort war Emil um sie bemüht, und Kusche entwich schleunigst. Paula, in ihrer Kleidung ziemlich außer Rand und Band, präsentierte sich ihrem Retter besinnungslos in möglichst vorteilhafter Position. Er sah ein aufreizend schmales Bein, schwarz bestrumpft, mit rotem Band, darüber eine Handbreit nackten Schenkel, weiße Spitzenhose, dann blickte er erst mal diskret weg, um weiter oben, auf verkümmertem Brustkorb, immerhin zwei niedliche Wölbungen mit keck rosigen Tüpfchen zu bemerken, was ihn, wider seinen Willen, doch in unerklärlicher Weise nervös machte. Paula spürte sofort ihren Eindruck auf den unbekannten Retter, entschloß sich, zu erwachen, und kam mit Seufzern, Augenverdrehen, niedlich erstauntem Ach zu sich. Tat, als entdecke sie nun erst ihre Entblößung, machte übertrieben schamhafte Gesten, bat den Beschützer, sich umzuwenden, und brachte ihre Kleider in Ordnung. Dann schleppte sie sich, auf seinen Arm gestützt, bis zum Haustor, dankte artig für seine Hilfe, aber nun sei sie gänzlich ungefährdet. Er stellte sich förmlich vor: Klose-Emil, wollte eine polizeiliche Anzeige machen. Da lenkte sie ein. Es handle sich um einen armen Irren, der nicht wisse, was er mache, man dürfe das seiner armen alten Mutter nicht antun, deren einziger Ernährer er sei. Emil dachte begeistert: »Engel, Heilige du!« küßte der Geschmeichelten, fast Erschreckten die Hand und wurde für die nächste Mittagspause in die Zerboni-Promenade bestellt. Diese Rettungstat, die ihm selbstverständliches Beispiel gegenseitiger Menschenhilfe schien, verschwieg er zu Hause schamhaft.
Im grellen Sonnenlicht des andern Tages kam Paulas Mißgestalt allerdings so kraß zum Vorschein, daß Emil im ersten Augenblick erschrak. Da er aber unter allen Umständen anständig handeln wollte, und sein vernunftsmäßiger Entschluß dort, wo seine Befolgung schwerfiel, erst recht für ihn galt, zwang er sich, noch liebenswürdiger zu Paula zu sein, als er sich ohnehin vorgenommen hatte.
Paula war allerdings zuerst gar nicht klug daraus geworden, wes Geistes Kind er sei. Er hatte so eine schwülstige Art, von der Ungerechtigkeit in der Welt zu reden, und setzte zuviel Bildung voraus, andrerseits vertrat er über die natürlichsten Dinge gradezu kindliche Vorstellungen. Er war weder Kusche noch Hanke. Aber grade, daß er ein so seltener Vogel war, reizte sie. Und er gab ihr gleich beim ersten, ganz platonischen Zusammensein, die zwei Mark, um die sie ihn mit einem dürftigen Vorwand anpumpte.
Sie gewöhnten sich aneinander. Paulas natürliche Rudelhaftigkeit fand Wohlgefallen an seinem doktrinären, doch ernsthaften Rebellentum. Sie einverleibte sich papageienhaft den Wortschatz seiner Propaganda – wer wußte, wozu es gut war? Irgendwann konnte man alles einmal gebrauchen. Er aber war sehr froh darüber, daß er eine so willige Zuhörerin und gelehrige Schülerin gefunden hatte.
Zuerst teilte er sein holdes Geheimnis dem Vater mit. Der war gleich Feuer und Flamme: eine proletarische Seele wurde durch seinen Sohn für den revolutionären Glauben gerettet. Emil mußte ihn bald mit ihr bekannt machen. Und Paula und der Kolporteur verstanden sich sofort ausgezeichnet. Diesem lustigen alten Herrn gegenüber war der Ton von vornherein gegeben: sie verwandte die politischen Sprüche, die sie bei Emil aufgeschnappt hatte, sang des Sohnes Lob, plinkte Herrn Klose vertrauenserweckend zweideutig an, daß er einen väterlich tätschelnden Griff riskierte, kam dem mit rausgestrecktem Podex entgegen und schmeichelte seiner Eitelkeit, indem sie mit einer Bemerkung den galanten Fähigkeiten der Generation der Väter den Vorzug vor dem bedenklichen Zustand der Söhne gab.
Eines Nachmittags – während Emil, über die Lupe gebeugt, ins Räderwerk einer Uhr äugte – saß Papa Klose, Lebemann alter Schule, mit Paula im Hinterstübchen des »Preußenhofes«. Er erzählte, um Mitleid werbend, von seiner Frau, die ihn in geistigen Dingen im Stich lasse, unverstanden und einsam sei er, und faßte Paula um die Taille. Da gestand sie, daß es ihr mit ihrer Mutter ganz ähnlich ginge: rückständig sei sie im höchsten Grade, Paula aber natürlich durchaus freiheitlich gesinnt. Worauf sie sich küßten und das elektrische Klavier: »Wer uns getraut« spielen ließen. Von Emil zu reden vermieden beide. An dieser künstlich erleuchteten Stätte schäbiger Gelegenheitsmacherei waren sie, indes draußen über weiten Wiesenfiächen die Sonne schien, zwei mit Vorbehalt und ohne Liebe zum erotischen Handel Bereite. Madame Klapper drückte zwei Augen zu. Bei sich mißbilligte sie des Familienvaters Klose sträfliche Verirrung, denn sie war in ihrem Privatleben eine solide Bürgersfrau, die leider durch ihre geschäftlichen Erfahrungen ihre Überzeugung von der Unzuverlässigkeit des männlichen Geschlechtes immer wieder bestätigt fand. Zimmer sieben beherbergte dreißig Minuten lang ein seltsames Paar, und Papa Klose lernte allerlei hinzu.
Den schwerfälligen Emil verführte sie etliche Zeit später, es war eine mühselige Sache und sie mußte ihn endlich bei seiner Rebellenehre packen. Ob er sich denn vor dem Odium scheue, ohne staatliche Genehmigung ein Mädchen liebzuhaben? Oder liebe er sie etwa nicht mehr, sei er ihrer überdrüssig geworden, hätte er eingesehen, daß sie mordsgarstig wäre? Dieser Appell an sein revolutionäres Kavalierstum schlug ein. Paula lockte ihn in den nämlichen »Preußenhof«. Das Vorspiel mit elektrischem Klavier und Weinspende fiel diesmal aus, Madame Klapper war so taktvoll, ihnen Zimmer fünf anzuweisen, und Paula vergoß hinterher Tränen und ließ sich schwören, daß Emil sie heiraten würde, wenn er nicht aus Prinzip jede Konzession an bürgerliche Bräuche verabscheue.
Er setzte aber durch, daß Paula in die Wohnung seiner Eltern zog. In einem Hause, in dem sie immer den Nachstellungen des Musikus ausgesetzt sei, könne er sie nicht länger lassen. Paula half etwas nach, brach mit ihrer Mutter einen Zank vom Zäune, nahm die bei ähnlicher Gelegenheit oft geäußerte Aufforderung: »Scher dich zum Teufel!« wider Erwarten ernst und erschien bei Kloses als bedauernswertes Opfer, das von einer Rabenmutter grausam verstoßen worden war. Natürlich war Emil mitleidsvoll um seine Braut bemüht, Vater Klose hätte keinen Protest riskieren können, auch wenn er es gewollt hätte, und Frau Klose hatte ja sowieso nichts bei sich zuhause zu sagen.
Nun kamen sich die beiden Männer unerhört kühn vor, weil sie sich so offenkundig über die Satzungen der bürgerlichen Gesellschaft hinwegsetzten, und der alte Esel erzählte allen, die es hören oder nicht hören wollten, stolz, sein Sohn lebe in wilder Ehe mit Fräulein Paula Bernert. Paula hatte dabei gute Tage. Niemand kommandierte und kontrollierte sie, der Frau Klose ging sie möglichst aus dem Wege, und das war auch ganz nach derem Wunsche, und die beiden Männer scharwenzelten um sie herum und verwöhnten sie nach Kräften. Paula spielte ihnen auch gern die Gebrechliche, Kränkelnde, Schutzbedürftige vor, lag viel im Bett und fing wieder an, ununterbrochen zu schmökern, wobei Emil sie mit revolutionärer Literatur versah, der alte Kolporteur aber mit pikanter, mehr insgeheim zirkulierender Lektüre.