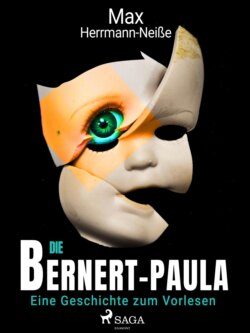Читать книгу Die Bernert-Paula. Eine Geschichte zum Vorlesen - Max Herrmann-Neisse - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
V
ОглавлениеSie besuchte die Höhere-Töchter-Schule und war ungefähr im gleichen Alter wie Paula. Anfangs nahm sie von den Bernerts keinerlei Notiz, wenn sie zufällig einmal durchs Zimmer mußte, wo ihre Mutter aufpaßte, daß ja kein Stoffrest verlorenging, und aus einem so und so oft reparierten Kleide immer noch etwas halbwegs Verwendbares zurechtgestoppelt wurde. Wie ekelhaft Mama diesem schäbigen Schneiderweib glich! Richtig hexenhaft hockten die beiden in dem Unrat von Lappen und Fetzen; welche Schande, von so etwas abzustammen! Wenn sie an ihre Mitschülerinnen: die Bielauer Baronesse, die Tochter vom Kommerzienrat Hahn oder die Landrat-Lotte dachte, kamen ihr Tränen ohnmächtiger Wut. Krachend schlug sie die Tür hinter sich zu.
Da kramte die Witwe Kausch seufzend vor der Bernert-Alten ihre mütterlichen Bekümmernisse aus. Ganz aus der Art geschlagen sei das Mädel, die Elfriede, hochmütig, verschwenderisch, vergnügungssüchtig. Woher sie das bloß hätte, sie, die Kausch, und ihr Bruno, Gott hab’ ihn selig!, wären doch gewiß anders gewesen, von ihnen hätte sie derlei nicht lernen können! »Für nichts Ernstes hat Ihnen das Mädel Interesse, jede Arbeit ist ihr zu schwierig oder zu niedrig, nur an Putz und Bequemlichkeit denkt der Fratz, jeder Sechser muß vernascht werden, vom Sparen hält sie nichts und mit ihrer Garderobe geht sie um, als ob sie nichts koste, und immerzu möchte sie etwas andres, ein paar neue Schuhe, einen neuen Hut oder Mantel. Als ob sie nicht an mir das beste Beispiel hat, wie lange trage ich schon die Winterpelerine, und sie sieht noch immer leidlich aus, und was kann man nicht noch alles aus einem alten Stück machen! Aber nein, die Elfriede muß immer gleich alles wegschmeißen, es bleibt ein Kreuz, wie das einmal enden soll! Wenn ich die Augen zudrücke und niemand mehr da ist, der aufpaßt, wird sie bei ihrer Verschwendungssucht bald alles durchgebracht haben«, lamentiert Frau Kausch in einer ehrlichen Besorgnis, die Paula äußerst lächerlich erschien. Noch größren Spaß machte ihr das Lob, das die alte Kausch ihr selbst dann spendet: »Ja, ja, liebe Frau Bernert, ich bin recht mit meinem Kinde gestraft! Da stehen Sie anders da! Ich kann garnicht sagen, wie sehr ich Sie beneide. Ihre Paula ist jetzt schon eine zuverlässige Hilfskraft für Sie, ein so fleißiges Mädel, auf die können Sie sich verlassen, und Sie wissen, daß Sie im Alter mal eine Stütze haben werden.«
Die alte Bernert stimmte in das Lob ihrer Tochter ein, tat rührselig überzeugt und strich ihr übers Haar. Dabei war zuhause immer Zwist, Paula versuchte, wo sie nur konnte, dem Zwang zur Arbeit zu entwischen, kratzte oft aus und ließ sich den ganzen Tag über nicht blicken. Jetzt machte sie zu dem Gerede der beiden Mütter ein scheinheiliges Gesicht. Innerlich war sie mit sich im reinen. Frau Kausch hätte nicht mehr nötig gehabt, unbesonnenerweise nachsichtig auf Paulas Gebresten anzuspielen. »Da sieht man eben, daß Schönheit auch nicht das vollkommene Glück bedeutet, denn ein schmuckes Mädel ist die Elfriede ja, aber das schadet in diesem Fall eher, als daß es nützt: desto mehr Nachstellungen wird sie ausgesetzt sein. Gottlob ist sie in dieser Beziehung noch das reine Kind, und sobald sie in das Alter kommt, wird es hoffentlich möglich sein, sie mit einem anständigen jungen Mann zu verheiraten. Freilich hat der dann auch seine Schwierigkeiten; bei unsereinem weiß man nie, ob nicht nur die Mitgift gemeint ist. Danken Sie Gott, Frau Bernert, daß Ihnen solche Sorgen wenigstens erspart bleiben!« Da hatte die Witwe Kausch sich jede menschliche Rücksicht Paulas verscherzt. Paulas Mutter aber war imstande, sich wirklich bei Gott zu bedanken.
Als Elfriede Kausch das nächste Mal im Korridor hochnäsig an Paula vorbeistreichen wollte, sagte Paula untergeben: »Guten Tag, gnädiges Fräulein!« Und fügte, ehe Elfriede sich von der Überraschung erholen konnte, mit einem Verschwörerflüstern, das neugierig machte, hinzu: »Ihre Mama tut Ihnen Unrecht.« Das »Sie« der Gleichaltrigen und das »Gnädige Fräulein« wirkten überwältigend. Und daß Paula gleich hinterher im Zimmer verschwunden war und, als Elfriede eintrat, wie immer bei der Schneiderarbeit mit den beiden Frauen saß und mit keinem verstohlenen Blick zu Elfriede auf das Vorgefallene Bezug nahm. Nach einigen Tagen, in denen Paula unzugänglich blieb, war Elfriedes Widerstandskraft gebrochen. Dem Schneidermädel wurde ein Papierknäuel zugeschoben, das den Termin und den Ort zu einer geheimen Aussprache angab.
Diese entscheidende Zusammenkunft der beiden Mädchen fand auf dem Dachboden statt; über den ganzen Raum waren Leinen gespannt, auf denen die Wäscheklammern wie Sperlinge auf Telegraphendrähten saßen und unter denen man geduckt durchkriechen mußte, in der Ecke standen ein paar leere Wäschekörbe, die wurden umgestülpt und auf ihnen saß man. Elfriede hatte anfangs ungefähr die reservierte Haltung, die der Audienz erteilenden Königin in den Klassikerdramen einer Schülervorstellung wohl ansteht. Trotzdem war Paula gleich die Überlegnere. Obwohl sie die Rolle der unterdrückten und schmählich vernachlässigten Waise spielte, die ihre ergebenen Dienste anbot, bestimmte und lenkte sie sofort Form und Ton des Verhältnisses zu einander. Mit berechnetem Zögern, wobei der nächste Satz den vorhergegangenen schon wieder halb zurücknahm, abschwächte und verleugnete, deutete Paula der höheren Tochter an, daß etwas mit ihrer Abstammung nicht stimme. Aber wie sich die Sache rundheraus verhalte, das war nicht herauszulocken. Sie dürfte nicht so reden, wie sie wollte, aber sie hätte es nicht übers Herz gebracht, Fräulein Elfriede (das »Fräulein« machte sich immer gut und wurde auch von einem erregten Herzen registriert) ohne Warnung zu lassen. Dies Geplänkel zog sich geraume Zeit hin. Immer mehr bekam Paula das Honoratiorenkind in die Verfassung, in der sie es haben wollte. Längst war angedeutet und allerdings nachher fast widerrufen worden, daß Herr Kausch nicht Elfriedes wirklicher Vater gewesen und daß es unverantwortlich von Frau Kausch wäre, ihre Tochter nicht endlich aufzuklären. Über den Rang des wirklichen Vaters hatte Paula nichts gesagt, aber es stand für Elfriede fest, daß er dem ihres angeblichen Papas weit überlegen sein müsse. Mit dem Hochmut einer Jugend, die sich eben erst in höhere Bildungsbezirke vortastet, kreidete sie dem alten Kausch seine Sprachverstöße als Verbrechen an: Vanille hatte er »Fahnille« ausgesprochen und hartnäckig fanatisch und phantastisch verwechselt! Als die Unterredung beendet war, war nichts Genaues ausgesagt und doch der Stachel in Elfriedes Empfinden getrieben. Paula hatte gesiegt, die andre kam von ihr nicht mehr los. Es folgten weitere heimliche Zusammenkünfte, die das unnatürliche Band noch fester knüpften. Vom ursprünglichen Thema, Elfriedes wirklichem Vater, war kaum noch die Rede. In dieser Beziehung blieb für Elfriede alles im Vagen, Rätselhaften und behielt desto dauerhafter einen verführerischen Reiz. Den vornehmen Mitschülerinnen machte Elfriede affektierte, dunkle Andeutungen, die nicht verstanden wurden. Die Bielauer Baronesse, die Tochter vom Kommerzienrat Hahn und die Landrat-Lotte kamen überein, sie nicht mehr ernst zu nehmen und sich von der fragwürdig Gewordenen in vorsichtiger Distanz zu halten. Plötzlich sah Elfriede sich aus dem kleinen Kreis der Bevorzugten ausgeschlossen, begegnete sie bei der Masse ihrer Mitschülerinnen grenzenloser Schadenfreude, denn die knapp gehaltenen Töchter von mittleren Beamten hatten von vornherein den begünstigteren Sprößling einer für ihre Begriffe schmierigen Parvenüfamilie der verachteten Tütenkrämerart gehaßt.
Wider ihren Willen wurde jetzt Elfriede in die radikale Opposition gedrängt und dem Gassenbalg Paula auf Gedeih oder Verderb verbunden. Immer noch trafen die zwei Mädchen sich heimlich, niemand wußte von dieser Freundschaft, nichts ahnten die beiden Mütter.