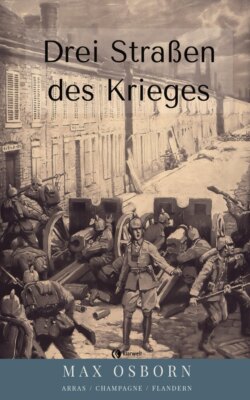Читать книгу Drei Straßen des Krieges - Max Osborn - Страница 13
In den eroberten feindlichen Gräben
ОглавлениеAuf der Vimy-Höhe,
Anfang Februar 1916
ie lange Februarnacht ist noch nicht zu Ende, als ich in dem kleinen Wagen der Division westwärts rumple. Durch schwarze Finsternis geht es. Kein Stern am Himmel. Ich habe keine Ahnung mehr, welchen Weg ich fahre. Ich weiß nur, dass es bitter kalt ist. Jetzt fühle ich, dass die Pferde über Pflastersteine traben, und große drohende Silhouetten draußen, die noch dunkler sind als die Nacht, lassen vermuten, dass wir irgendwelche Nester des Industriegebiets im Artois kreuzen. Jetzt wieder spüre ich, dass wir über eine Landstraße holpern, die von ausgefahrenen Rillen und notdürftig geflickten Granatlöchern zerfurcht ist. Weiter lässt sich nichts bestimmen. Wohin der Weg? In die Unendlichkeit? Wohin führt mich der Schwager Kronos, der da in der Uniform eines Chevaulegers auf dem Bocke sitzt?
Da leuchtet in der Ferne doch ein Gestirn auf. Doch es verlischt. War gar kein Gestirn, sondern eine Leuchtrakete. Andere gesellen sich dazu. Das ferne Gebrumme wird stärker. Wir nähern uns der Kampfzone. Nun blinkt auch der erste fahle Schimmer der Morgendämmerung auf. Ein seltsames, violettgraues, unheimliches Licht, das über ödes Feld hinblinzelt. Etwas Weißliches glimmt, wie die Asche erloschenen Feuers: die Gräser der Heide sind bereift. Ein eisiger Windhauch schauert herüber. Ich wickle mich noch fester in meinen Mantel. Jetzt sieht man's: Weg und Pfützen sind hart gefroren.
Im nebligen Dunst wird am Horizont ein Streifen bemerkbar. Er rückt näher und näher. Bekommt festeren Umriss und nimmt Gestalt an. Nun erkenne ich ihn: es ist die Vimy-Höhe. Ganz unschuldig liegt sie da im Morgenschleier, als wüsste sie nichts von den entsetzlichen Blutkämpfen, die nun rund dreiviertel Jahre lang um ihren Besitz toben. Eine langgestreckte niedrige Hügelkette; doch weithin in ihrer ganzen Ausdehnung sichtbar, als einzige Bodenerhebung, die das flache Gelände überragt.
Bald heißt es aussteigen und zu Fuß weiterwandern. Es wird heller. Auf dem Wege ist es lebendig. Kolonnen fahren zurück. Feldküchen rasseln hinter ihnen her. Abgelöste Trupps kommen angestapft. Blasse, müde Gesichter, die sich nach verdienter Ruhe sehnen. Beschmutzte Gestalten, über der grauen Uniform noch eine graugelbe Schicht von Staub und angetrocknetem Lehm. Reden kein Wort. Der strenge Marschrhythmus hat sich gelöst. Aber schnell geht es vorwärts. Nur ein wenig in Ruhe kommen! Ein wenig schlafen! Neue Kraft sammeln! Ziehen vorüber. Andere folgen. Wieder andere rücken von der entgegengesetzten Seite an, hinter mir her. Sie marschieren nach vorn. Der Offizier, der sie führt, fragt die ihm Begegnenden: „Wie war die Nacht?“ — „Unruhig“, tönt es zur Antwort, „sie schießen unausgesetzt.“ — „Guten Morgen!“ — „Guten Morgen . . .“
Der Boden hebt sich langsam. Häusergruppen steigen auf. Aber was für Häuser! Zersplitterte, zerwirbelte Gebäude. Wie von einem Erdbeben in ihrer Gesamtheit erfasst und durcheinandergerüttelt, umgestülpt, weggefegt. Das ist der Ort Vimy, einst ein stattliches Dorf von über zweitausendvierhundert Bewohnern, jetzt die grausame Karikatur einer Menschensiedlung. Die Kirche ein Schutthaufen; ihr Platz kenntlich nur an dem heruntergestürzten Zifferblatt der Turmuhr, das zerbrochen auf den Klamotten liegt. An einer Stelle ein Haus, von dem ein paar Balken stehen blieben, die das vollständig abgehobene und, österreichisch zu reden, „in seiner Gänze“ schiefhängende Dach balancieren. Alles ist ausgestorben. Keine Seele wagt sich mehr in den Ort des Schreckens, in den immer noch täglich die französischen Granaten fallen. Auf einem Geröllhaufen steht, fast lächerlich, hochthronend ein eisernes Kinderbettchen.
An einer zerschossenen Zeche mit noch ragenden Eisentürmen, an ein paar Häuserruinen geht es vorbei, die einst, als eine Art Vorwerk, den Namen „Petit Vimy“ trugen. Nichts Sterbliches regt sich. Es ist ein Grauen. Dann überschreiten wir eine Landstraße. Das ist sie: die „Straße Arras—Lille“, die oft Genannte, aus zahllosen Heeresberichten nur zu wohl Vertraute. Einige Kilometer weiter nördlich führt sie über Lens, das jetzt aus tausend frischen Wunden blutet. Ein wenig südlich aber zieht sie sich in einer großen Kurve über die Vimy-Höhe, eine Mulde benutzend.
Plötzlich schollert es mit furchtbarem, klatschendem Getön. Die deutschen Feldgeschütze und Haubitzen drunten sind munter geworden, und das Echo ihrer Abschüsse hallt mit so klirrendem Gebrüll aus den Hügelfalten, dass man glaubt, der Klang komme aus den Eingeweiden der Hölle. Es ist, als wenn der Teufel Gong schlägt.
Während wir mühsam durch den glitschigen Lehm aufwärts steigen, dessen dünne Frostschicht unter den Tritten schwerer Stiefel und von der emporsteigenden Sonne schon wieder in zähen Schlamm verwandelt ist, wird es um uns her immer wilder und wüster. Der ganze Höhenrücken, einst eine Musterkarte blühender Felder, ist aufgewühlt, wie umgepflügt mit riesenhaften Eisen; doch ohne Ordnung ist die weiche Ackererde hingeschüttet. Hebt man den Kopf ein wenig, so blickt man über ein wogendes braunes Meer. Aber es ist nicht ratsam, zu lange Umschau zu halten. Hier pfeifen Gewehrkugeln und Granaten. Davon wissen auch die zerzausten Bäume zur Seite zu erzählen, das „Zahnstocherwäldchen“, wie unsere Leute es treffend getauft haben. Nicht minder die armseligen Ruinen des Schlösschens und Gehöfts La Folie, die daneben auftauchen. Seitdem die Kämpfe der Frühjahrs- und der Herbstoffensive des vorigen Jahres hier gerast haben, ist in weitem Umkreise alles Zerstörung und Vernichtung.
Nun gelangen wir an unsere alten Stellungen. Sie tragen noch deutlich die Spuren des antwortenden französischen Artilleriefeuers vom 28. Januar, dem Tage des Kampfes. Grabenwände sind eingestürzt, Bretter und Balken liegen quer aufeinander. Man muss schnell hinüberklettern. Immer weiter vor, in das Gelände, das bis vor einer halben Woche noch dem Feinde gehörte. Und jetzt gähnt die Erde mit ungeheurem Rachen auf: wir stehen am Rande eines der Sprengtrichter, die an jenem Tage nach dem wahnsinnigen Krachen der Explosionen plötzlich aufklafften.
Man blickt in einen Abgrund. Kreisrund, wie mit einer Zentrifuge ausgehöhlt, sieht uns das kolossale Erdloch an, mit regelmäßig aufsteigenden Wandungen. An achtzig Meter im Durchmesser, an zwanzig Meter tief. Das Dynamit, von unseren Pionieren kommandiert, hat schauerlich präzise Arbeit geleistet. Unten im Grunde häufen sich noch weicher Boden und Gestein, das herumflog. Darunter ruhen die Leichen verschütteter Franzosen, die noch nicht ausgegraben werden konnten. Tornister liegen umher. Schmutzige Lappen und Fetzen. Teile von Gewehren. Zerrissene Uniformstücke. Die Grässlichkeit des modernen Krieges kann sich nicht sinnfälliger offenbaren. Aber erbarmungslos führen beide Parteien, die sich im Stellungskampfe gegenüber liegen, ihre Bohrlöcher und Stollen in die Erde, unter die Gräben des Feindes. Wer am frühesten fertig ist, sprengt den Gegner in die Luft. Diesmal waren wir zuerst zur Stelle. Wer weiß: vielleicht nur einen Tag später, und die Franzosen hätten den Unseren diesen mörderischen Streich gespielt.
Am Kraterrande zieht sich ein kreisrunder Weg entlang. Hier wird fieberhaft gearbeitet. Brustwehren sind eingesetzt, werden kräftiger befestigt. Alles ist gespannte Aufmerksamkeit. Mit Granaten kann der Feind nicht hierher funken; seine eigenen neuen Gräben, die man durch die Schießscharte sieht — aufgeworfenes Erdreich, Anfänge frischer Drahtverhaue — liegen zu nahe. Für Handgranaten wieder ist es an dieser Stelle zu weit. Bleibt die furchtbare Waffe der dicken Minen, die er nun auch reichlich herübersendet. Da heißt es aufpassen. Man kann diese schweren Dinger ankommen sehen — im Gegensatz zu allen anderen Geschossen —, aber wehe dem, der sich nicht zu rechter Zeit in Sicherheit bringt! Ihre Sprengwirkung ist entsetzlich. Nun schwebt gar noch ein feindlicher Flieger über uns, ganz niedrig, weil er weiß, dass er hier am ehesten vor unseren Abwehrgeschützen Ruhe hat, deren Geschosse hinabfallend sonst leicht unsere eigenen Leute treffen könnten. So verlassen wir lieber den Trichter, damit der Beobachter da oben den Seinigen keinen Wink gibt, und gehen in die benachbarten Gräben.
Es sind die eroberten französischen Stellungen, in die wir einbiegen. Vordem die vorderste Linie des Feindes und sogar noch ein Stück der zweiten. Schon ist fast alles aufgeräumt. Neue Wehren sind hergerichtet. Aber noch zeugen zahllose Spuren von den früheren Besitzern. Trümmer einer Revolverkanone. Blutige Tücher. Herumliegende Maschinengewehrmunition. Haufen von Handgranaten. Patronenhülsen. Auf dem früheren, also nach Osten gewandten Grabenrand in durchlöcherten Metallbehältern die Lagen von Stroh und Pech, die die Franzosen anzünden, um Gasangriffen zu begegnen. Ein Holzkasten mit doppeltem Deckel und den Aufschriften: „Grénades“ — „Pétards“. An einer Auslugstelle steht ein riesiger Bursche und hat einen der französischen Pelze übergeworfen, die hier erbeutet wurden: ein großes Fell mit einem Loch in der Mitte, das über den Kopf gezogen wird. Man richtet sich ein . . .
Doch noch ein anderes Zeichen spricht von den Vorbesitzern: gräuliche Unordnung (auch da, wo unsere Artillerie die Gräben fast unversehrt ließ) und noch gräulicherer Gestank. Es ist keine Übertreibung; der Unterschied mit unseren Anlagen muss jedem auffallen. In den Unterständen sieht es wüst aus. Die ganze Arbeit ermangelt der Genauigkeit. Die Unsauberkeit aber ist himmelschreiend. Es gibt keine Latrinen, und man mag sich ausmalen, was für Folgen das bei einer monatelangen Benutzung der Gräben zeitigt. Es ist ein Augiasstall, den unsere Leute auszuräumen haben; keine appetitliche Tätigkeit, aber sie wird ebenso prompt erledigt wie jede andere, nur mit einigem Schimpfen.
Viele hundert Meter geht das so weiter. Wütendes Feuer speit darüber hin. „Die sin wohl heut‘ wieder narrisch worden“, brummt ein Bayer. Die Franzosen wissen, was sie verloren haben. Dieser Westrand des Hügelrückens von Vimy und der Höhe 140 südlich von Givenchy en Gobelle war für sie von größtem Wert. Denn er beherrscht die westlich gelegenen Geländeteile, wo sie sitzen, und in die wir nun freien Einblick haben. Der Feind aber hatte seine Sehnsucht auf den Besitz der ganzen Höhenkette gestellt. Davon ist er nun weiter als je entfernt; weiter vor allem als nach der Offensive zu Ende September, da er hier kleine Vorteile errungen hatte. Das ist der stattliche Erfolg unseres Vorstoßes an dieser Stelle. Der Erfolg einer aktiv handelnden Defensive.
Wie bedeutungsvoll der Besitz dieses Hügelzuges ist, lehrt ein Blick nach Osten in die Ebene, in die wir nun zurückkehren. Die Sonne ist ganz herausgekommen, und in vollem Glanze strahlenden Lichtes liegt das Land vor uns. Dort nördlich leuchten die Dächer von Givenchy. Und weithin tauchen die Städte und Dörfer des reichen Industriebezirks auf. Die „Fosses“ mit ihren pyramidenförmigen Schutthalden und der Eisenarchitektur ihrer Fördertürme. Die gotischen alten Kirchen. Die Arbeiterkolonien. Die Häuser von Méricourt und Avion, von Billy-Montigny und Hénin-Liétard und Sallaumines. Selbst die Zinnen von Lens kann man sehen, und fern im Osten schwimmen die Umrisse von Douai im Dunst. Ja, bis nach Douai hin beherrscht der, dem die Vimy-Höhe gehört, das flache Land zu seinen Füßen! Die Wünsche der Franzosen, die dahin zielen, sind sehr begreiflich.
Es ist Nachmittag geworden, als ich die Höhe hinter mir habe. Ohne Unterlass kracht und poltert das Feuer aus beiden Lagern weiter. Wann wird das aufhören? fragt man sich. Aber es hört nicht auf. Dröhnt in die Dämmerung hinein, in die ich nun wieder mit meinem Divisionswagen rumple,
„Der Weg hier“, meint der Chevauleger, „wird auch immer unmöglicher zu befahren, seitdem sie immer hierher schießen.“ Aber wir kommen ungerupft durch, „unbelästigt“, wie man an der Front so hübsch sagt.
Und es ist wieder dunkel geworden, als ich auf einem der Bahnhöfe des Bezirks stehe, um nach Douai zu fahren. „Fährt kein Zug mehr?“ — „Nein, aber glei‘ fährt eine Lokomotiv‘ hinaus. Da können‘s aufsteigen.“
Sie kommt angefaucht, und ich fahre mit. Zwischen Maschine und Kohlenwagen sitze ich auf einer Pritsche und starre in die Dunkelheit, die das einsame Ungeheuer schnaufend durchrast. Schwager Kronos ist nun Lokomotivführer geworden und jagt abermals mit mir ins Schwarze, ins Ungewisse, ins Rätsel hinein. . . .