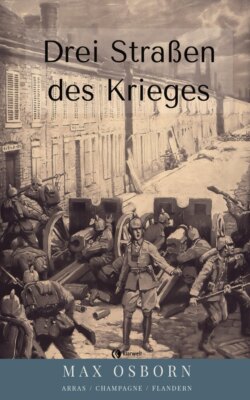Читать книгу Drei Straßen des Krieges - Max Osborn - Страница 14
Wie auf Vimy gestürmt wurde
Оглавление5. Februar 1916
ach langem Harren im Verteidigungskrieg wird uns die ersehnte Gelegenheit zum Angriff zuteil.“ So hieß es im Tagesbefehl des süddeutschen Regiments, dem beim Vorstoß auf der Vimy-Höhe am 28. Januar der Hauptanteil zugedacht war.
Es handelte sich dabei gewiss nicht um eine strategische Offensivbewegung größeren Umfanges, bei der der Truppenteil mitwirken sollte, sondern lediglich um einen taktischen Schlag, der die Stellung der Artois-Armee an einem genau bezeichneten Punkte zu verbessern bestimmt war. Aber nach den Monaten des Stilleliegens, des abwartenden, lauernden Gegenübers musste diese Weisung wie etwas Befreiendes erscheinen. Man halte das nicht für eine pathetische Redensart. Der lähmende Druck des Grabenkampfes ist so aufreibend, dass die Truppe gern die Frische der Tat dagegen eintauscht. Dann lieber das Schicksal zwingen, Farbe zu bekennen, als in der Lehmrinne warten, bis man im regelmäßig herüberspeienden Feuer des unsichtbaren Feindes an die Reihe kommt.
Die Aufgabe war, jene feindlichen Linien am Westhang der Höhe zu nehmen, von denen ich im letzten Bericht sprach. Die Korrekturen und Verstärkungen, die die deutsche Front zwischen Arras und Lens in den Kämpfen der Tage vorher, am 22., 24. und 26. Januar, weiter südlich erfahren hatte, sollten hier ihren Schlusspunkt finden. Von langer Hand waren die Vorbereitungen getroffen. An zwei Stellen, an den Flügeln der etwa dreihundertfünfzig Meter breiten Angriffsstrecke, die festgesetzt war, hatte man, in schwerer, unsäglich mühevoller Arbeit, in bedeutender Tiefe Minenstollen unter die französischen Gräben getrieben. Alles war fertig. Die Sprengkammern gefüllt. Die Pioniere auf ihren Posten. Die Artillerie eingeschossen, in gut verdeckter Stellung, mit Munition reichlich versorgt. Die Infanterie, bei der die Entscheidung ruhte, bereit.
Der 28. brach an. Alles schien wie sonst. Den ganzen Vormittag über gab es nur die übliche Kanonade und die gewohnte Schießerei der Posten. Da plötzlich, mittags um zwölf Uhr, brach die Hölle los. Mit furchtbarer Gewalt sausten die Granaten der deutschen Batterien, zu gleicher Zeit beginnend, ohne Unterlass auf die vorderen Stellungen des Feindes und, jeden Zugang absperrend, auf die weiter zurückliegenden Gräben. Alle Kaliber, bis zu den schwersten, rasten hinüber, Tod und Verderben um sich verbreitend. Mit ihnen flogen die dicken, zentnerschweren Minen, von ihren Schleudermaschinen abgeschnellt, in die Reihen der überraschten Franzosen. Die Erde bebte. Die Luft war von donnerndem Gehämmer erfüllt. Kein Aufhören. Keine Pause durch Stunden hindurch. Es war, als wollte die deutsche Artillerie einmal zeigen, dass auch sie das Trommeln gelernt habe und seine Technik nicht schlechter beherrsche, wenn es darauf ankomme, als Franzosen und Engländer.
Aber einen Unterschied gab es doch. Und einen wesentlichen. Was die Feinde früher bei ihren tagelangen Trommeleien — nicht erreichten, das glückte hier in ganz kurzer Zeit: die Zerrüttung und Verwirrung der aufs Korn genommenen Grabenbesatzung. „Am 10. und 11. Oktober“, erzählte mir der Führer des Regiments, „hatten wir an eben dieser Stelle ein Getrommel von dreißig Stunden auszuhallen, ohne dass meine Leute ins Wanken kamen. Weiß der Teufel, wie sie das ausgehalten haben. Aber sie hielten es aus. Die drüben waren schon nach vier Stunden fertig!“ Die französischen Nerven rissen. Das konnten sie nicht ertragen. „Le bombardement était démoralisant“, erklärten später die Gefangenen. Sie hielten in den Gräben nicht stand. Viele suchten während des Feuers in die Nebenabschnitte zu gelangen und überzulaufen. Einer großen Zahl glückte das auch. Andere rannten rückwärts in die zweite Linie. Mit ihnen die meisten Offiziere — was sich wiederum aus den Aussagen der Gefangenen ergab, aber auch aus dem Umstand, dass sich nachher unter den Scharen der Überwältigten und Abgeknöpften nur ein einziger Offizier befand. Eine wilde Panik hatte sie alle erfasst.
Es ist Punkt vier Uhr — und plötzlich, wie es um Mittag eingesetzt, bricht das Feuer ab. Der ungeheure Lärm schweigt. Es ist, als hätte man einem bösen Tier, das vier Stunden lang unausgesetzt tobte und brüllte, mit einem Griff den Hals umgedreht. Eine Minute lang herrscht fast Ruhe auf der Vimy-Höhe. Nur die unsicher tastenden Schüsse der französischen Artillerie, die unsere Batterien suchen, hallen noch herüber. Aber da kracht es von neuem. Fast noch grausamer. Zur Rechten wie zur Linken ertönt der entsetzliche Knall der Explosionen: die unterirdischen Minen springen, die Erde öffnet sich, Flammen und Rauchwolken wallen auf, Bergmassen fliegen in die Höhe und fallen zurück. Zur Rechten wie zur Linken sind auf eine Strecke hin die französischen Gräben verschwunden und haben abgrundtiefen Trichtern Platz gemacht. Mitten im Kampfgelände sind, wie auf das Donnerwort eines Zauberers, Amphitheater entstanden, Hunderte von Franzosen unter ihrer Sohle begrabend.
Und nun bricht mit einem Schlage die ganze deutsche Linie zum Sturm vor. Nebeneinander klettern die Kompagnien aus ihren Gräben, stürzen vorwärts, übers freie Feld, durch die zerschossenen französischen Drahtverhaue, in die feindlichen Gräben hinein. In breiter Front wettern sie heran. Die Franzosen sind wie betäubt. Sie schießen überhaupt nicht mehr auf die Stürmenden, sondern werfen die Gewehre fort, heben die Hände hoch und ergeben sich in ganzen Trupps. Einer von den Süddeutschen ist mit einem Satz in einem Sappenkopf, packt das Maschinengewehr, das dort steht, springt auf den Grabenrand, hält die Beute mit den Armen hoch empor und schreit: „Da hammer das Kind von der Sappe Eins!“ — setzt dann die Maschine nieder und stürmt weiter vor. Noch sieben andere feindliche Maschinengewehre werden genommen, im Ganzen acht. Ich sah sie ein paar Tage später in einem der Industrienester des Gruben- und Zechengebiets auf der Hauptstraße aufgebaut, mit Grün geschmückt, von zwei Landstürmern im Helm und mit aufgepflanztem Bajonett bewacht, um das ein Ilex-Kranz geschlungen war. Eine große Holztafel kündete stolz: „Erobert vom. . . Inf.-Regt. am 28. Januar 1916.“ Die französischen Einwohner des Ortes warfen scheue Blicke auf die Trophäen. Aber die Dorfjugend kam näher und starrte sie an. . .
Die Unsern wieder tragen nun ihre eigenen, vorher bereitgestellten Maschinengewehre schleunigst in die gewonnenen Gräben. Denn darauf kommt es an: das Eroberte sofort, unmittelbar nach dem gelungenen Vorstoß, in verteidigungsfähigen Zustand zu bringen. Dabei wird Leutnant W., einer der tüchtigsten Maschinengewehroffiziere des Regiments, der schon vorher leicht getroffen war, den Unfall aber gar nicht beachtet hatte, zum zweiten Male, und nun schwer, verwundet. Unverzüglich eilt auf die Nachricht hin ein Oberarzt vor in die erste, eben erst gewonnene Linie, um dem Verletzten zu helfen. Wohl diesem beherzten Eingreifen ist es zu danken, dass der schlimm Zugerichtete, wie man nun bestimmt hoffen darf, gerettet werden wird. Wie die Arzte, deren Organisation und Bereitschaft sich außerordentlich bewährte, wie die Pioniere, deren glänzend exakte Arbeit die Vorbereitung stützte und jetzt sogleich beim Räumen und Neuausbauen wertvollste Dienste tut, sekundiert die Stürmenden noch eine dritte Formation: die Fernsprechabteilung. Der Kommandeur konnte sie nicht genug rühmen. Als eine Elitetruppe habe sie sich gezeigt. Wie die Leute im schwersten Feuer die Verbindungen aufrecht erhielten, wie sie unbekümmert um einschlagende Geschosse ringsum Drähte 75 flickten, für schleunigsten Anschluss der neuen ersten Linie mit den Befehlsstellen sorgten, wie selbst Verwundete aushielten und weiter mithalfen — das sei des höchsten Lobes wert.
An manchen Stellen leisten die Feinde freilich nun doch noch Widerstand. Es kommt zum Handgemenge. Sie zeigen sich tapfer und todverachtend. Einem Franzosen glückt es sogar, ein eingebautes Maschinengewehr auszuheben und auf seinen Schultern in Sicherheit zu bringen. Aber die Widerstrebenden werden bald überwältigt. Eine Menge Kriegsgerät, Munition, Scheinwerfer und dergleichen fällt den Siegern noch zur Beute.
Und die Wucht ihres Ansturms wirkt ansteckend auf die Nachbartruppen. Hatten diese ursprünglich nur die Aufgabe, ein Eingreifen der feindlichen Anschlusslinien niederzuhalten, so packt auch sie nun die Angriffslust. Sie stoßen gleichfalls vor, gewinnen Boden, und so erweitert sich in kürzester Zeit die Front der genommenen feindlichen Stellungen von dreihundertfünfzig auf beinahe fünfzehnhundert Meter Längenausdehnung! In der Tiefe aber reicht das gewonnene Gelände bald bis in die zweite französische Linie hinein, von der ein etwa zweihundert Meter breites Stück besetzt wird.
Um vier Uhr hatte der eigentliche Angriff begonnen. Und —: „Um vier Uhr acht Minuten“, so heißt es in einem Regimentsbericht, „war alles, was wir wollten, in unserem Besitz.“ In acht Minuten war alles erledigt! Das Programm hatte sich wie am Schnürchen abgewickelt. Dabei waren unsere Verluste gering. „Gering“ — das will natürlich sagen, dass doch wieder eine Anzahl braver deutscher Jungens hinsinken musste. Aber sie verschwindet fast gegen die beträchtliche Einbuße an Menschenmaterial, die der Feind zu verzeichnen hat. Unschwer hätte man den Vorstoß noch weiter tragen können. Darüber sind sich alle einig. Man war im Zuge, und der Gegner hatte sich noch nicht gefasst. Aber das lag nicht im Plane, der nur eine bessere Gestaltung unserer Defensivstellung im Auge hatte. Unternimmt der Franzose wieder einen neuen Angriff in großem Stile, den man ja doch früher oder später zu erwarten hat, so will man möglichst geeignete Stützpunkte für die Abwehr in Händen haben. Das war erreicht, und jedes weitere Vorgehen war verboten. Man hatte nun de n Blick auf Neuville und auf die jenseits der Talsenke, in der der Ort liegt, nach Westen zu wieder ansetzende Bodenwelle. Mehr verlangte man nicht.
So machte man Halt und ließ sich „häuslich“ nieder. Mit Dank und Anerkennung erzählten mir die Leute, wie gut man für sie gesorgt habe, dass sie sich von ihren Anstrengungen ein wenig erholen konnten: sofort, noch am Abend des 28., und dann in der Nacht, wurde Mineralwasser und Wein hinaufgeschafft, immer für zwei Mann eine Flasche Wein, und tüchtig zu essen. Das war vorgesehen und klappte nun ausgezeichnet. Und auch das war keine Kleinigkeit. Denn alles muss hier auf langem Wege mühsam herangeschleppt werden, und der Feind, der sich nun langsam erholte, begann in der Nacht sein Wut- und Störungsfeuer. Zu Gegenangriffen schritt er an dieser Stelle freilich nicht. Auch in den nächsten Tagen nicht. Seine Infanterie hatte wohl genug.
In kläglichem Zustande befanden sich die Gefangenen. Sie wurden mit größter Schonung behandelt. Denn, so hieß es als Mahnung ausdrücklich in dem eingangs erwähnten Tagesbefehl vor dem Beginn des Kampfes: „Rücksichtslos gegen den Feind, solange er sich wehrt — menschlich gegen den Besiegten!“ Es ist nicht überflüssig, in den Tagen des „Baralong“ und „L. 19“ auf ein solches Wort eines deutschen Führers hinzuweisen. Dem Befehl wurde gehorcht. Die Süddeutschen, die im Sturm so wild dreinschlagen können, nahmen sich der armen Teufel gutmütig an. Die Franzofen waren noch völlig verwirrt und verschüchtert. Immer wieder sagten sie beteuernd ihr gewohntes „Bon camarade!“ Diensteifrig lieferten sie selbst alles ab, was sie bei sich trugen. Einer wollte auch sein Ehrenkreuz von der Brust nehmen. „Naa“, sagte der Bayer, vor dem er stand, „dös behalt‘st! Dös hast dir verdient!“ Der andere wird das verstanden haben, auch wenn er selbst nicht fließend Deutsch sprach . . .