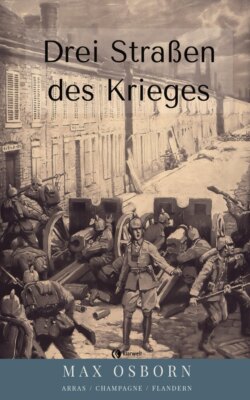Читать книгу Drei Straßen des Krieges - Max Osborn - Страница 5
I. Arras In der Hölle von Souchez
ОглавлениеAnfang Juni 1915
as Auto verlässt die kleine französische Stadt und biegt auf die gutgepflasterte Straße ein, die nach Westen führt. Über uns wölbt sich ein nächtlicher Junihimmel von märchenhaftem Gefunkel. Es ist fast Neumond, und die Sterne, vollzählig versammelt, glühen und glimmen im stärksten Lichte. Zwischen den Häusern der Stadt, die alle Lampen gelöscht, war es dunkler als hier im Freien, wo geheimnisvolle Halbhelle gebreitet ist.
Doch man kann nichts unterscheiden. Alles verfließt und verwebt miteinander, ineinander, ist in den flutenden Strom tiefdunkelblauer Dämmerung getaucht. Wie gespenstische Kulissen erscheinen die vorbeihuschenden Mauern einzelner Häuser. Sind plötzlich da, aus der Erde gezaubert, glotzen uns mit erloschenen Fensteraugen eine Sekunde lang an, und sind verschwunden, vom Nichts verschluckt. Da rechts leuchtet etwas auf. Brennt es irgendwo? Nein, es ist nur ein anderes Auto, das uns entgegen kommt und mit seinen Lichtern den Staub, den es selbst aufwirbelt, wie Flammenschein emporsteigen lässt.
Das Wagengebilde des Großen Bären weist uns den Weg. Wir jagen durch stockfinstere kleine Ortschaften, an gotischen Kirchen vorbei mit wuchtigen Türmen und Strebepfeilern und schiefangesetzten Sakristeien. Alles ausgestorben. Nur cm der Ecke wird ein Wachtposten sichtbar, oder vor einem langgestreckten Bau mahnt uns ein rotes Kreuz auf weißem Felde, dass hier Menschen leiden, die für uns bluteten. Wir beißen die Zähne aufeinander und hüllen uns fester in unsere Mäntel.
Vor einem Gittertor hält der Wagen. Die Silhouetten eines Gartens werden erkennbar. Dazwischen ein kleines Schlösschen. Im ersten Stockwerk ist ein Fenster geöffnet; ein erleuchtetes Zimmer gibt dem Auge in der wogenden Unbestimmtheit ringsum einen Halt. Totenstille. Nichts regt sich. Wie ein Geisterhaus, wie der Schauplatz eines Maeterlinckschen Schau- und Schauerspiels liegt das Gebäude vor uns. Ein Heimchen zirpt.
Da knirscht der Kies. Ein Taschenlaternchen leuchtet auf. Zwei hohe, schlanke Schatten kommen näher. Es sind die beiden Offiziere, die uns führen wollen: Hauptmann R., männlicher Ernst und ruhige Sicherheit; Leutnant v. I., blühendste Jugendfrische, bestes Blut vom Rheine. Sie haben es gastfreundlich übernommen, uns drei, zwei Kollegen und mich, in die vorderen Stellungen bei Souchez zu geleiten.
Wir fahren weiter. Nach einer Weile werden die Lichter des Autos gelöscht, und nun sind wir ganz von der Sommernacht umhüllt. Aber in dem Dunkel beginnt es sich zu regen. Graue Schatten bewegen sich. Erst einzelne. Dann immer mehr. Immer mehr. Ganze Züge drängen sich auf dem Wege. Zwischen zerschossenen Dorfhäusern liegen, sitzen, hocken ruhende Reserven. Geschlossene Kompagnien kommen von der Front. Andere rücken vor in die Schützengräben, die Kameraden abzulösen. An langen Kolonnen holpern wir vorüber. Große Wagen- und Sanitätsautomobile mit Verwundeten fahren uns entgegen. Zwei Gulaschkanonen tragen ihr sehnlich erwartetes Labsal nach vorn. Berittene sprengen an. Die Leiber der Pferde wachsen im Dunkel zu Ungetümen auf. Pioniere sind an der Arbeit. Kein lautes Wort wird gesprochen. Höchstens ein Flüstern, eine leise gesummte Liedmelodie wird hörbar. Alles Einzelne verschwindet, verschwimmt, ballt sich zu einem riesenhaften Organismus zusammen, der das Individuelle aufsaugt. Wie die Gestalten in ihrer farblosen Felduniform mit dem Boden eins zu werden scheinen, so verwachsen sie auch miteinander.
Nun steigen wir aus. Zu Fuß geht es weiter über einen staubigen, steinigen Weg. Der winzige Rest des abnehmenden Mondes ist inzwischen aufgestiegen, eine feine, schmale Sichel aus blassrot vergoldetem Silber. Aber auch ihr Licht genügt nicht, um die Granatlöcher besser zu erkennen, über die wir stolpern. Andere Lichter jedoch erscheinen plötzlich am Himmel. Raketen recken sich auf, ziehen in elegantem Bogen empor, bis ihr Feuerstreifen sich in eine Garbe auflöst — nicht anders, als werde dort drüben ein pyrotechnisches Sommernachtsfest veranstaltet. Und große, weiße Lampen stehen plötzlich am Himmel. Das sind die Leuchtkugeln der Franzosen, die mit einem Fallschirm versehen sind, um sich länger in der Höhe zu halten. Man glaubt, es seien mit einem Male Leuchttürme in die Luft gebaut. Ein greller, bleicher Schein fällt weithin über das Gelände. Es ist, als sollte rings im Umkreis alles entdeckt, ertappt, verraten werden. Zugleich blitzt es aus dem Dunkel mit jähem Geflacker auf, von allen Seiten: die Geschütze sind an der Arbeit.
Denn mit dem phantastischen Feuerwerk, das unermüdlich die Nacht aus ihrer dunkeln Ruhe schreckt, verbindet sich nun der ohrenzerreißende Spektakel der Mordinstrumente beider Fronten. Was aus der Ferne nur als ein grollendes Brummen vernehmbar gewesen, zerteilt sich nun in zahllose Laute und Klänge. Mit leisem Zwitschern sausen die Kugeln der Infanteriegewehre vorüber, wie verängstigte kleine Vögel, die eiligst flüchten. Salven knattern und rollen. Maschinengewehre knarren im Takt. Schrapnells platzen. Haubitzen speien gurgelnd ihre Ladung aus. Der Krieg umdröhnt uns krachend und polternd. Opfer suchend, Tod verbreitend. Und zur Seite murmelt und gluckst zwischen Weidengebüsch und zarten Gräsern, friedlich und unbekümmert, der Carencybach. Nebelglanz liegt auf den Wiesen. . .
Halb gedeckt durch Böschungen und Sandhaufen kommen wir vorwärts. Meist wird es um diese Zeit ruhiger, und so werden wir wohl bald unbehelligt in den Stellungen angelangt sein. Schon sind wir vor Souchez, wo sie beginnen, da bricht mit einem Male eine Hölle los. Mit unmittelbarer Wucht kracht uns der Donner in die Ohren. Über die Böschung steigt eine finstere Wolke hoch; eine Granate hat eingeschlagen. Bautz — bum! Drüben eine zweite. Wir gehen in einen Unterstand, und kaum sind wir im Erdloch, als uns die wilde Jagd rasend, mit schäumender Wut und Wildheit umtanzt. Die Granaten fahren wie besessen rings um uns her. Gerade auf unseren Weg, gerade auf den Zugang zu dem Orte haben es die Franzmänner offenbar abgesehen. Jetzt schlagen sie in die Wiese drüben. Feuerschein, Erde, Steine sprudeln auf. Jetzt jagen die Geschosse durch das Gebüsch zur Seite, die Bäume beugen sich rauschend, wehren sich heftig mit den Armen ihrer Äste, schütteln sich vor Ekel und Entrüstung. Jetzt geht es fauchend in die Straße selbst, dass uns der aufgewühlte Sand ins Gesicht spritzt.
Alle Teufel sind los. Das grausigste Konzert spielt auf. In abgerissenen, unorganischen, regellosen Rhythmen, in hundert unharmonischen Tonarten wettert die satanische Spuksymphonie über das Land. In den wunderlichsten, zerrissensten Klangfarben. Zermalmend und stampfend, fauchend und heulend, rasselnd und fast kichernd. Es ist akustisch gewordener Hieronymus Bosch. Eine hundertfache Steigerung der unwirklichen Geräusche, mit denen man auf dem Theater Fausts Hexenküche oder Peer Gynts Trollenreich lebendig zu machen sucht. Die Luft zittert. Der Boden wankt. Und — die Sterne blicken weiter ruhig in das Chaos herab, und die Nachtigallen feiern die Juninacht. . .
Ich sitze in meiner Erdhöhle fast wie in einer Loge, als sähe ich der Aufführung eines Totentanzes zu. Allerdings, die Grenzen zwischen Bühne und Zuschauerraum könnten sich leicht verschieben! So gut die Granaten hinter uns und vor uns einschlagen, könnten sie in das dünne Schutzdach fahren, unter dem wir sitzen. Aber man ist wie von einem Rausch dieses grandiosen Schauspiels erfasst und überwältigt.
Unbekümmert trotten vor uns auf dem Wege Soldaten daher, zu ihrer Pflicht oder von ihrer Pflicht. Mit ruhigen Gesichtern — ihnen ist das alles wohlvertraut. Nur ein bisschen schneller suchen sie an der gefährdeten Stelle vorbeizukommen. Und waren doch auch bis zum August 1914 meist Bürger und Zivilisten wie wir! Was für Menschen sind seitdem aus ihnen geworden!
Und nun fasst mich Zorn gegen mich selbst. Welch ein Recht hast du, Nichtkämpfer du, diesen Leuten und ihrem Heldentum, ihrer Pflichterfüllung und ihren Gefahren wirklich wie ein Zuschauer im Schauspiel so nahe zu rücken? Tag für Tag, Nacht für Nacht leben sie so, leiden sie so, kämpfen sie in dieser Hölle, um unser Land zu schützen, um mit ihrem Atmen und Sein ihr Volk vor Unheil zu bewahren. Kennen Monat um Monat, in Kälte und Hitze nichts als die unerbittliche Pflicht. Lassen sich den Tod in einer Stunde tausendmal um die Ohren sausen. Jede Sekunde bereit, alles hinzugeben. Oder vielleicht bin ich hier doch zu Recht? Um wenigstens Zeugnis ablegen zu dürfen für das Unausdenkbare, Unermessliche, was sie leisten. Um wenigstens eine Kostprobe der Furchtbarkeiten zu schmecken, die sie stündlich umdräuen, und so eindringlicher noch den Ewigkeitsdank zu empfinden, den wir ihnen schulden, und der deutschen Heimat von der ungeheuren Arbeit zu sprechen, die sie als treueste Diener des deutschen Gedankens verrichten.
Ein schwacher Schein von Helligkeit dringt in mein Lehmloch: der junge Morgen meldet sich. Und wie in dem holdesten Tagelied der Menschheitsdichtung löst auch in diesem schreckenvollsten Erdenwinkel der Triller der Lerche die Sehnsuchtsrufe der Nachtigall ab. Wahrhaftig, mitten in das ächzende Gestöhn und das rohe Knallen der Geschütze singt sie ihr Frühlied. Denn das Getöse hört nicht auf, kennt keine Pausen. Unwillkürlich fragt man sich: Wird denn der Nachtspuk gar nicht gebannt sein? Wird die Ehrfurcht vor dem aufsteigenden Weltgestirn die Mäuler der Kanonen nicht verstummen machen? Da — wirklich? — Der Lärm hält inne, die Batterien schweigen. Einen Augenblick lang ist Ruhe. Und in der Dämmerung sieht meine erregte Phantasie von dem blassen Morgenhimmel einen Gott niederschweben, der Arme ausbreitet wie sonnenbeglänzte Gebirge und mit einer Stimme, die alles Leid der Welt auslöscht, das eine Wort über die Heere, über die Völker ruft: „Friede!“
Krach — bum — bautz! „Da liegt der Brei!“ Zur Antwort auf meine Vision schlägt eine neue Granate ein. Von drüben kullert der Gegengruß über den Hügel. Das kleinere Gekläff stimmt in den Chorus ein. Nun sind sie alle wieder beisammen. Vorbei ist‘s mit dem dummen Morgentraum. Es war nur ein Atemholen. Auch die Hölle muss wohl gelegentlich einmal verschnaufen. Nun tobt sie hemmungslos von neuem weiter.
Rasch wird es ganz hell. Nun sehe ich auch das weiche Kissen, auf dem ich zu hocken glaubte — es ist ein zerfetztes blutiges Leinenstück. Wem mag es gehört haben? . . . Aber auch die Sommerlandschaft sehe ich, die sich nun ausbreitet, und den weißen Staub, der über der Straße ruht, und das Granatloch, das mich aus unmittelbarer Nähe angrinst. Wir treten den Heimweg an. Alles sieht kalt, nüchtern, grausam aus. Wieder ziehen Soldaten, Sanitäter, Transportmannschaften hin und her. Zu ihrer Pflicht. Ohne auf das Krachen und Heulen zu achten, durch das sie schreiten. Aus Morgennebel, Staub und Fabrikrauch braut sich eine weißliche Schicht zusammen, die über der Ebene schwimmt. Kirchtürme, Schornsteine, zerschossene Giebel ragen aus diesem Luftmeer wunderlich hervor. Und auf ihm schwebt die eben emporgetauchte Sonne — ein blutiger Ball. Das rechte Symbol für solchen Junitag. Gleichmütig, erbarmungslos steigt sie höher, während unser Auto wieder der Stadt zustrebt. Von fernher dröhnt noch immer der Donner, ohn‘ Unterlass, ohn‘ Ende. . .
Nein: die Götter reden nicht. Sie sprechen keine erlösenden Worte. Und die Menschen morden sich weiter.