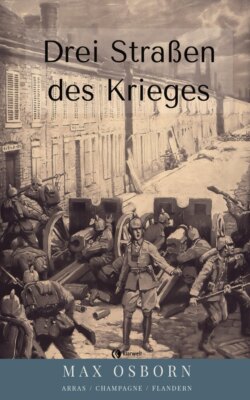Читать книгу Drei Straßen des Krieges - Max Osborn - Страница 9
Frankreichs „Schwarzes Land“
ОглавлениеIm Juni 1915
ays noir“ — es ist eine Vorstellung, die uns die bildende Kunst vermittelt hat. Constantin Meunier übernahm das Amt, als er in den Pastellen und Ölbildern, die seinen Skulpturen vorangingen, vom belgischen „Borinage“ erzählte, dem Steinkohlengebiet bei Mons.
Aber auch Frankreich besitzt sein „schwarzes Land“. In den Norddepartements, wo die deutschen Truppen stehen und mit Riesenkraft dem Sturm der feindlichen Angriffe standhalten, ist es gelegen. Dass wir es ebenso wie den belgischen Bezirk seit dreiviertel Jahren als Pfand fest in der Faust halten, ist einer der wuchtigsten Plusstriche in der bisherigen Kriegsrechnung. Kein Wunder, dass der Gegner vor Wut über diesen Verlust schäumt und immer aufs neue krampfhaft-verzweifelte Anstrengungen macht, den schmerzlichen Zustand zu ändern.
Fährt man in die Gegend von Douai ein — mit einem der Züge, die nach dem berühmten roten „Amtlichen Kursbuch für den westlichen Kriegsschauplatz“ so pünktlich verkehren und so korrekt ineinander greifen, dass man in Deutschland zu reisen glaubt —, so kündigen merkwürdige Gebilde diese dunkle Region der Arbeit an. Weit in der Runde tauchen die Silhouetten regelrecht geformter schwarzer Pyramiden auf, die aussehen wie das Schlachtendenkmal von Waterloo. Das sind die Schlackenhalden der Kohlengruben, die sich zu ansehnlicher Bergeshöhe auftürmen und als Wahrzeichen in die kahle Ebene ragen, wie festgewordene Wellen einer Meeresfläche.
Kohle und Kohlenstaub haben dem Lande seine eintönige Farbe gegeben. Die Bewohner nennen es selbst mit dem Meunier-Namen. Die Anschläge, die allenthalben eindringlich mahnen, Bäume und Pflanzen zu schonen, schließen jedes Mal mit dem ernsten Satze: „Les arbres sont la beauté du pays noir.“ Wirklich, ohne dies Grün der Blätter wäre der Anblick gar zu düster. Im Spätherbst und Winter, wenn die Äste kahl und auch nur schwarze Linien sind, muss der Eindruck trostlos sein. Aber großartig wirkt gerade in seiner Herbheit und Härte dies reich bestellte Feld menschlicher Tätigkeit, Werte schaffender Arbeit. So weit das Auge schweift, trifft es die charakteristischen Erkennungszeichen der „fosses“, der Gruben, die sich förmlich aneinander drängen. Dazwischen die weitläufigen Zweckarchitekturen der Industrie, die Hochöfen, Fabriken und eisernen Fördertürme, deren unerbittliche Sachlichkeit eine neue, moderne „Schönheit“ erzeugt. Dann die Ortschaften, aus Arbeiterkolonien und einzelnen Zeilen von Reihenhäusern zur Größe einer Stadt aufgewachsen. Finstere Wohnstätten, aus dunkelroten Backsteinen gefügt. Der Staub hat sie alle gleich gemacht, man kann sie kaum unterscheiden, und durchfährt man sie, so meint man immer wieder denselben Ort zu passieren, sich dauernd im Kreise zu bewegen.
Greifbar melden sich dann die sozialen Kontraste. Mitten aus den gleichförmigen, oft kümmerlichen und freudlos dreinschauenden Arbeitersiedlungen tauchen Villen und Schlösser auf, von sorgsam gepflegten Gärten und Parks umstanden: die Wohnungen reicher Fabrikherren und Grubenbesitzer. Vielfach in einem grässlichen Parvenüstil gehalten, mit Türmchen und Zinnen und anderem Burgenkrimskrams, der hierher passt wie die Faust aufs Auge, im Innern mit Hallen und Wölbungen und Schnitzereien, dass einem ganz übel wird. Man sieht: die Protzenbaukunst ist ein internationales Laster. Namentlich groß ist die Zahl der Zuckerfabriken — von denen ja eine, die westlich Souchez, jetzt eine geschichtliche Berühmtheit geworden. Etwa achtzehn Kilometer östlich davon liegt Courriéres, wo vor einer Reihe von Jähren ein schweres Grubenunglück zahlreiche Menschenleben vernichtete. Damals kamen westfälische Bergleute herüber, um bei den Rettungsarbeiten mitzuhelfen — es war eine jener Aktionen der Brüderschaft von Land zu Land, von Volk zu Volk, auf die man frühlinghafte Hoffnungen setzte, die nun zertrümmert am Boden liegen.
Nun sind andere Deutsche in die rauchgeschwärzte Industrieprovinz um Courriéres eingerückt. Frankreich hat es nicht anders gewollt. So sitzen denn unsere Soldaten in dem verlassenen reichen Gebiet und haben neues Leben mitgebracht. In einer französischen Druckerei werden deutsche Felddrucksachen hergestellt. In französischen Schlachthäusern walten unsere Jungens, und aus der „antichambre“, dem Vorraum, wo mit der dem französischen Idiom eignen Höflichkeit die Ochsen und Schweine vor ihrem Todesgang zu „antichambrieren“ gebeten werden, holen deutsche Metzgerfäuste die brüllenden und quietschenden Herrschaften an die Schlachtbank. Die Krankenhäuser aber sind zu deutschen Lazaretten geworden und bergen unsagbares Leid. Und deutsche Namen grüßen von den Häuserecken. „Bismarck-Straße“, „Hindenburg-Straße“, „Rupprecht- Straße“ und dergleichen haben die Unsern hier angeschrieben.
Und auf den französischen Totenfeldern ruhen die Deutschen, die das schwarze Los gezogen. Einer der größten Heldenfriedhöfe, die angelegt wurden, ist bei Lens, einem Zentralpunkt des „pays noir“, auf der Straße gelegen, die von Arras nach Lille führt. Wer diese endlosen Gräberreihen durchschreitet, der spürt, was Krieg bedeutet. Drüben brüllen die Geschütze, über dem Lenkballon, der sich in der Junisonne hell gegen den blauen Himmel abhebt, drängen sich Schrapnellwölkchen, auch in die Stadt Lens selbst schlagen ja oft genug die Geschosse ein — wer wird morgen wieder von denen, die dort kämpfen, hierhergebracht werden? Dann steht wohl wieder eine solche Reihe schlichter Särge wie heute da und wartet auf ihre stummen Bewohner.
Die Herrichtung dieses weitgedehnten Friedhofs ist mit besonderer Liebe und Sorglichkeit durchgeführt. Sie ward einer künstlerischen Hand vertraut. Leutnant v. H., in Friedenszeiten Bildhauer und Professor an einer süddeutschen Akademie, hat sich der Ehrenpflicht angenommen. Er hat auch ein würdiges Denkmal modelliert, das jetzt in Sandstein fertiggestellt wird: eine hohe, streng stilisierte Engelsgestalt, die mit ihrem Flammenschwerte Wache halten soll.
Doch wer hier auf französischem Boden bestattet wurde, wird künftig den ewigen Schlaf in einem Fleck Erde schlafen, der deutscher Besitz ist; denn das ganze Gelände soll angekauft werden, die Vorbereitungen dazu sind bereits getroffen. Diese Gräber hier sollen der rechtmäßige Besitz der Toten sein, die in ihnen ruhen. Durch Sammlungen innerhalb des Armeekorps ist alles beschafft, was jetzt den Friedhof schmückt, die Steine und Tafeln und die Holzkreuze, die oft wie alte primitive Bauernschwerter in der Erde stecken. Sogar die jungen Bäumchen, die an den Wegen stehen und einst in fernen — glücklicheren? — Zeiten die Gebeine unserer Helden beschatten sollen, hat man aus Deutschland geholt, aus den Landschaften, denen die Regimenter entstammen. Nun aber möchte man auch vermeiden, dass die Hinterbliebenen zu oft mit dem Antrag hervortreten, die sterblichen Reste ihres Verwandten, Lieben ausgraben und, in die Heimat überführen zu dürfen. Solche Wünsche sind gewiss verständlich. Doch es hat einen tiefen Sinn, dass die, die zusammen kämpften, litten und fielen, auch gemeinsam begraben werden. So will und wünscht es auch der Soldat.
Es würgt den Hals zusammen, wenn man durch diese traurigen Felder schreitet. Gute deutsche Namen begegnen uns. Darunter mancher Klang von stolzen alten Geschlechtern. Reihe auf Reihe. Dann wieder klaffen die Schlünde langgereckter neuer Grablinien auf, die ihrer armen künftigen Bewohner harren — Schützengräben des Todes. Und dort haben deutsche Soldaten den Obersten eines französischen Regiments bestattet, den sie als tapfern Gegner ehren wollten, und dem sie einen Platz mitten unter den Ihrigen bereiteten. Sie kannten nicht einmal den Namen des Feindes, dem si« so ihre Achtung bezeigten, und das Holzkreuz auf dem Hügel trägt darum die Inschrift: „Repose en paix. X. . . . . Lieutenant-Colonel du 114 me Regt. de Ligne. Enterré le 15 Mai 1915 á Lens.“
Am Eingang dieses Friedhofs aber, von dem man weithin in das schwarze Land Nordfrankreichs mit seinen Schlackenbergen und Schornsteinen blickt, in seinem alten, französischen Teile, steht ein Denkstein, an dem wir nicht vorübergehen dürfen. Es ist eines der Monumente für die Kämpfer von 1870, doch von besonderer Art. Denn dieser Stein, durch „Souscription publique“ gestiftet, wie eigens vermerkt ist, trägt unter den Widmungsworten „A la mémoire des jeunes gens de Lens morts pour la patrie“ eine Zahlentafel, die so aussieht:
Zwei Jahreszahlen also sollten sich hier vereinigen: die der Niederlage von 1870 und die — der kommenden „Revanche“. Darum blieb hier ein kleines rechteckiges Stück des Steins unbehauen, schwarz poliert, eine dunkle Frage für jeden, der den Friedhof betrat. Nun haben sie eine neue Zahl, die sie in die Tafel meißeln können. Wieder ein Jahr des Blutes und des Kummers. Aber ob es ihren Traum erfüllte, dies „1914“? Sie werden wohl wehmütig den Kopf schütteln, wenn einst der Friede kommt und sie die alte Inschrift nunmehr endgültig ergänzen. In dieser polierten kleinen Steinfläche spiegelt sich der Fanatismus, der Frankreichs neue Trauer verschuldet hat. Werden sie es endlich begreifen, einst, wenn des schwarzen Landes Essen wieder glühen?