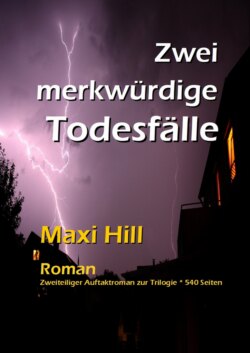Читать книгу Zwei merkwürdige Todesfälle - Maxi Hill - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
In ernster Mission
ОглавлениеWährend der Fahrt mit dem Auto durch den kleinen Ort, den angrenzenden Wald, bis zu der Stelle, wo die Kreisstraße auf die Landstraße einbiegt, gehen ihr noch die Fetzen von den Bildern eines einzigen Morgens durch den Kopf. Es gelingt ihr nicht, eine klare Linie in die Mentalität der Menschen zu bringen. Die einen sind abweisend, die anderen aufdringlich. Rita Georgi würde mit der Alten durchaus Mitleid empfinden, dem Händler indes großes Verständnis entgegenbringen können für seinen Frust, den er ganz sicher den unsicheren Verhältnissen zu verdanken hat. Aber im Dorf ist sie nicht Rita Georgi. Hier ist sie Riana Gora. Wenn sie sich vor all den dörflichen Traditionen schützen will, wenn sie ihre Ruhe haben will, wenn sie erneute Belästigungen ihres neurotischen Möchtegern-Liebhabers nicht herausfordern will, muss sie jetzt durch, auf Gedeih und Verderb.
Nein, das mit dem Verderb ist so nicht gemeint. Den Verderb hätte sie schon haben können, wenn sie geblieben wäre, wo und was sie war.
Auf der Fernstraße nach Lübben endlich wieder Leben. Und hier ist sie ab jetzt wieder Rita Georgi. Langsam wird ihr das alles zu viel und sie fürchtet, sie verheddert sich eines Tages in ihrer eigenen Identität.
Zwei Anlaufstellen hat sie in der Kreisstadt. Den Verein Soziale Vielfalt und den Jugendnotdienst.
Zum Glück ist die Stadt überschaubar und sie kann das Auto im Schlosspark abstellen und ihre Wege zu Fuß gehen. Zuerst will sie zum Jugendnotdienst.
Irgendwo unterwegs auf Bänken vor einer schmucklosen Mauer lungern ein paar junge Männer herum, trinken Bier und pöbeln die Passanten an. Auch Ritas rotes Haar muss für derbe Witze herhalten.
»He Alter, das Perlhuhn da, das glüht schon.«
»Eh, der ihr Style flasht total.«
Die Herumlungernden lachen grässlich laut, bis der eine sagt:
»Eh, halt mal dein Streichholz an die Aufgebrezelte dort …«
Rita ignoriert die Jungen und läuft unbeirrt weiter, doch nach wenigen Schritten weiß sie, dass die Kerle Recht haben. Sie selbst fühlt sich zuweilen aufgemotzt. Und sie weiß plötzlich auch, was den Jungen an der Mauer fehlt: Zuzuhören. Sich auf sie einzulassen. Ihnen einmal Recht zu geben, wenn sie Recht haben. Man muss trotzdem nicht alles schlucken, die falsche Grammatik zum Beispiel.
Warum ignoriert sie die Jungen? Ein kleines Lachen, ein guter Witz, vielleicht sogar ein kluger Hinweis? Was kann es schaden?
Wenn Eltern der Meinung sind, Erziehung sei zu anstrengend, dann ignorieren sie die Probleme der Kinder, und bald ignorieren sie ihre Kinder. So hatte auch ihre Mutter sie irgendwann ignoriert, und so hat sie diese vom Leben gelangweilten Kinder jetzt auch ignoriert. Manchmal macht man sich das Leben zu leicht.
Die Leiterin vom Jugendnotdienst Hannah Noack erwartet die Journalistin von der Spree-Rundschau schon mit Kaffee und Gebäck. Trotzdem unterbreitet sie ziemlich schnell den besten Vorschlag, den sie Rita hätte machen können.
»Wenn Sie die Probleme wirklich verinnerlichen wollen, Frau Georgi, dann kommen Sie für ein bis zwei Tage — besser noch Nächte — hierher und erleben sie mit, was es bedeutet, richtig zu reagieren.«
»Warum Nächte?«
»Nachts ist es am schlimmsten.«
Hannah Noack hält inne, als müsse sie ihre Gedanken ordnen. Und dann sagt sie in einer Art, als würde ihr genau das, was sie sagt, erst selbst richtig bewusst.
»Die Probleme der Kinder haben sich gewandelt in letzter Zeit. Kinder sind nicht mehr die unbeholfenen Kleinen. Es ist auch nicht immer häusliche Gewalt oder gar Missbrauch, was sie zu uns führt. Kinder stehen heute viel mehr unter psychischem Druck. Es werden viel zu hohe Erwartungen an sie gestellt. Überall. Zu den Versagensängsten kommen dann die schwierigen Lebensumstände in den Familien dazu und fertig ist das Problem.«
»Soll das heißen, die körperliche Gewalt ist rückläufig?«
»Nein, aber die größeren Kinder sind aufgeklärter als noch vor Jahren. Sie kennen ihr Rechte viel besser und sie haben gelernt, sich gegen die eigenen Eltern durchzusetzen.«
»Sie kommen also von selbst?«
Hannah Noack wiegt ihren Kopf bedenkend hin und her.
»Laut jüngster Statistik sind über vierzig Prozent der Inobhutnahmen Kinder unter vierzehn Jahren. Auf eigenen Wunsch kamen beinahe dreißig Prozent aller Fälle. Zum Glück ist in der Gesellschaft eine größere Sensibilität zu spüren. Die schlägt auch auf den Mut der betroffenen Kinder zurück. Der körperlichen Gewalt können sie vielleicht noch entrinnen, aber gegen den seelischen Druck können sie sich aus eigener Kraft nur schlecht wehren. «
Inobhutnahmen? Auch solch ein Wortmonstrum, das nur im Amtsdeutsch seine Nahrung findet, denkt sie, aber die Fakten regieren in diesem Moment über Feinsinn.
Glücklicherweise kennt Rita die Zahlen aus der Statistik, aber unglücklicherweise kann sie nicht gut schauspielern und so tun, als sei sie noch total uninformiert. Manchmal löst gerade die Unwissenheit des Fragenden den Befragten die Zunge.
»Wie finden Sie immer das rechte Maß? «
»Das Jugendamt muss die Mädchen und Jungen in seine Obhut nehmen, sobald Gefahr für das Wohl des Kindes besteht. Die Gefahr einzuschätzen ist ein schmaler Grat. «
»Fühlen die Kinder selbst sich danach wohler? Oder haben sie ihren Familien gegenüber Gewissensbisse?«
»Vorübergehend nicht. Eher dann, wenn sich die Situation wieder entschärft hat. Wir prüfen auch dann sehr gründlich.«
Rita denkt an den Jungen, mit dem traurigen Blick, von dem sie den Bericht entdeckt hatte. Ihr fällt sogar sein Name wieder ein: Lutz.
»Es sind doch nicht immer die Eltern? Auch Jugendliche müssen vermutlich auf den richtigen Weg gebracht werden. «
»Sofern nichts Schwerwiegendes dagegen spricht, werden sie bei uns eine Zeit lang betreut und können gemeinsam mit Experten herausfinden, welche Wege sie in Zukunft gehen wollen. Auch gestrauchelte Kinder und Jugendliche können jederzeit selbst um Aufnahme bei uns bitten. Dazu regelt der Paragraf 42 des Sozialgesetzbuches Genaueres. «
Noch während Hannah Noack spricht, klingelt das Telefon. Sie zieht die Schultern nach oben und murmelt noch beim Abnehmen des Hörers: »Entschuldigung. Wir müssen hier zu jeder Zeit ansprechbar sein.« Dann hört sie angespannt zu, ihre Augen wandern immer wieder zu Rita, so, als wollten sie sagen: Ich hab's geahnt.
»Okay, Gesine«, sagt Hannah Noack mit sehr viel Ruhe in der Stimme. »Nimm deine Schwester, setzt dich in den Bus und komm her. Hast du Geld?«
Hannah Nock nimmt rasch einen Schluck Kaffee und kritzelt etwas auf ihren Block.
»Einen Busschein also. Ist gut. Weißt du, welche Linie? …Okay, dann kommt. Und habt keine Angst, das kriegen wir wieder hin …«
Nachdenklich legt die Frau den Hörer zurück und beginnt noch nachdenklicher ihre Worte zu formulieren.
»Zwei Schwestern. Wir kennen sie gut. Ihre Mutter war ein paar Tage zur Entgiftung in der hiesigen Klinik. Zu Hause sollte sie nun auf einen Therapieplatz warten. Jetzt liegt sie wieder total betrunken auf dem Sofa, nachdem sie versucht hat, die Mädchen zu schlagen, weil sie keinen Nachschub aus der Kaufhalle holen wollten. «
»Was geschieht jetzt mit den Mädchen?«
»Sie werden in unserem Notdienst betreut und können auch hier übernachten. Morgen wird es ein Clearing geben, wie es weiter geht und wer sich um die Mutter kümmert.«
Rita schreibt alles mit, nur Worte wie Clearing ersetzt sie sofort mit allgemeinverständlichen. Die Zahlen sind ihr nicht neu, nur weiß sie zu wenig über die Gründe all dieser Fälle, wo Kinder und Jugendliche aus eigenem Wunsch die Familien verlassen.
»Die liegen in der Gesellschaft«, sagt Hannah Noack. »Chancenlosigkeit oder Überforderung der Eltern. Vernachlässigung. Delinquenz. Oder auch Straftaten – auch der Jugendlichen selbst.«
Hannah Noack schlägt vor, nicht lange zu warten. Die Nacht vom Freitag zum Samstag könnten sie gemeinsam in der Notdienststelle verbringen. Rita verbietet sich zu glauben, Hannah Noack sehe eine willkommene Abwechslung, weil sie selbst Nachtdienst hat. Das Leben wird sie dann auch das Gegenteil lehren.
Weil sie gewartet hat, bis die beiden Mädchen angekommen sind, ist es später geworden als gedacht. Vorsichtshalber ruft sie beim Verein Soziale Vielfalt erst an, ob sie noch vorsprechen kann. Sie soll unbedingt kommen. Genau genommen wäre sie jetzt lieber nach Hause gefahren. Ihr ist nicht gut, im Kopf dreht sich alles ein wenig und das ist für die Rückfahrt im Dunkeln nicht gerade angenehm. Außerdem sind die Informationen, die sie bisher hat, nicht gerade üppig, aber Rita weiß zumindest: Der Verein hat auf seine Fahnen geschrieben, Jugendliche mit Problemen dort abzuholen, wo sie sind, und sie lebensfit zu machen.
Was immer das bedeutet, will sie hinterfragen und im Kontext mit dem Jugendnotdienst in ihrem Artikel darstellbar machen.
»Wer mit Jugendlichen umgeht, braucht ein großes Spektrum an Kompetenzen, an Wissen und an menschlichen Eigenschaften«, sagt ihr die Geschäftsführerin Sigurd Bramsch, noch ehe Rita begreift, in welche Runde sie hineinplatzt. Da sitzen Sozialpädagogen, Familientherapeuten, Lehrer, Fachleute für Sozial- und Gesundheitswesen und sogar Kulturpädagogen. Auch wenn sie lieber mit Jugendlichen selbst geredet hätte, das geballte Hintergrundwissen kann auch nicht schaden.
»Wir sind etwas im Stress«, sagt die Vorsitzende und zeigt in die Runde.
»Wir arbeiten mit Hochdruck am Projekt zur Gründung einer Kompetenzagentur, die junge Leute zwischen sechzehn und siebenundzwanzig Jahren dabei unterstützt, ihren Weg in der Gesellschaft und möglichst stabil ins Berufsleben zu finden.«
Rita glaubt jetzt, dass die Zusammenkunft nicht wegen der Presse eiligst einberufen wurde, wie das manchmal der Fall ist und wie man es dann leider auch spürt.
Nach vielen aufschlussreichen Worten, komplizierten Zusammenhängen und Erörterungen brummt ihr der Kopf.
»Kann ich einmal mit jungen Leuten reden? «
»Heute nicht mehr«, sagt Frau Bramsch und schaut in die Runde auf eine andere Dame. Sie habe ein Projekt, das Präventivarbeit leiste. Dazu sei ein Schul-Club gegründet worden. Die Schule gleich nebenan sei ein Sammelpunkt für Schüler, die sonst vor oder nach dem Unterricht nur «abhängen» würden. Im Club könnten sie sich treffen, Hausaufgaben machen, Spielen oder auch mal nur miteinander reden und im Winter einen warmen Tee trinken. Dieser Club sei aber nur von sieben bis sechzehn Uhr geöffnet.
Gerade diese Zeiten versteht Rita nicht, aber sie weiß viel zu wenig, als dass sie selbst urteilen könnte.
»Und die Jugendlichen vor der Schule an der Mauer? Sind das auch Schüler von hier?«
»Vielleicht. Wir zwingen ja niemand. «
Eines wird sie sich auf alle Fälle nicht entgehen lassen. Sie wird schon bald mit den Jugendlichen sprechen.
Sigurd Bramsch verabschiedet Rita Georgi mit kurzen Worten und bittet einen jungen Mann, Frau Georgi durch die Flure zum Hinterausgang zu führen, weil der Haupteingang zu dieser Zeit schon geschlossen sei. Irgendwie gefällt ihr der Vorschlag, doch sie gesteht sich nicht ein, dass sie der junge Mann interessiert. Nicht, weil er sie die ganze Zeit mit großen, wachen Augen gemustert hat, eher, weil er recht unpassend scheint für diese Runde der Experten. Es ist ihr auch, als kenne sie ihn von irgendwo her, doch genau das ist unwahrscheinlich.
Auf dem Weg plaudert der junge Mann ganz ungezwungen und es tut gut, nach der steifen Atmosphäre einfache Worte zu hören. Das Steife kennt sie nur zu gut. In großen Runden und erst recht vor der Presse will keiner etwas Falsches sagen.
»Kommen Sie, weil es Sie interessiert, oder müssen Sie, ich meine, weil es irgendein Problem gibt?«, fragt er, beeilt sich aber gleich eine Erklärung zu geben. »Früher hat so etwas keinen toten Hund interessiert. « Er zieht den Kopf in die Richtung, aus der sie gekommen sind, als spreche er für die Experten. »Leider. «
»Es gab auch Zeiten, da wurde alles staatlich geregelt. Wäre Ihnen dieses Früher lieber? «
»Nee, nee, ganz bestimmt nicht. Obwohl – das kenn’ ich nicht mal. «
Wer von unserer Generation kennt das schon genau, denkt Rita. Aber die Meinungen darüber - die offiziellen, wie die ganz persönlichen - die kennt man doch. Wenn sie ehrlich ist, war es gerade diese Kluft, die sich für sie als Journalistin immer wieder einmal aufgetan hat. Die Kluft zwischen der Meinung ihres Vaters über diese Zeit und der publizierten Meinung.
Bevor der junge Mann ihr die Hand gibt, erkundigt er sich danach, wo ihr Auto steht und gibt ihr den Tipp, welche Gasse sie nehmen soll, um trotz der Dunkelheit schnell und sicher zur Schlossinsel zu kommen. Sie nimmt den Rat gerne entgegen und reicht ihm die Hand.
»Ich danke Ihnen«, sagt sie förmlich, obwohl sie zu Leuten seines Alters eher mal »tschau« sagt oder »bis bald«.
»Man sieht sich«, sagt er, »ich darf doch am Freitag dabei sein? Ich würde dann an der Schule auf Sie warten. «
Eine kleine Verwunderung lässt sie zögern, aber reizvoll findet sie seinen Vorschlag allemal.
»Haben Sie auch einen Namen?«
»Sie können Du sagen. Hier sagen alle Du. Ich heiße Lutz Wegener.«
»Danke Lutz Wegener«, erwidert sie und ist für einen winzigen Moment nicht nur verwundert, sondern irgendwie verstört.
Draußen ist die Dunkelheit hereingebrochen und das Städtchen sieht verändert aus. Nicht schlechter. Vielleicht sogar anheimelnd. Die große Kirche streckt ihren Turm im Lichtkegel der Scheinwerfer gegen den Nachthimmel, die Geschäftsstraße ist hell erleuchtet und das Wasser der Spree fließt bleiern durch das Fließ.
Auf ihrem Weg durch die Stadt, die so ordentlich beleuchtet in der Tat keinen Grund zur Ängstlichkeit gibt, sieht sie die traurigen Augen jenes Jungen vor sich, der ihr an diesem Morgen aus dem Computer entgegenblickte. Sie hat gemeint, es seien treue Augen. Vielleicht. Vielleicht aber sahen sie doch nur traurig aus — oder vorsichtig lauernd - wie bei diesem Lutz Wegener?
Lutz? Kann dieses Kind jetzt in seinem Alter sein? Wie ginge das zusammen. Wenn es dieser Lutz Wegener ist, dann wird sie es herausfinden. Sie muss es herausfinden. Vielleicht nicht für die Zeitung, vielleicht für sich selbst, für den Stoff eines Schicksals in einem neuen Roman. Man weiß ja nicht, was einem dazu einfallen könnte.
Eine halbe Stunde später erreicht sie ihr Dorf und sie denkt, dass sie ohne Oma Friedas Haus hätte vierzig Minuten länger fahren müssen.
In der Dorfmitte unweit von Jens Jedros Laden steht ein frisch getünchtes Haus, dem man die mehr als hundert Jahre nicht ansieht. Ein Gasthaus, das schon immer in Familientradition war. Die unteren Fenster — mit grünen Fensterläden versehen — entlassen einen faden Lichtschein auf die Dorfstraße.
Kurzentschlossen stellt sie das kleine graue Auto an den Straßenrand, nimmt den blauen Einkaufkorb aus dem Kofferraum und steuert zielsicher dem Eingang entgegen. Auf einer schwarzen Tafel steht unter der Aufschrift «Erdinger» das Angebot des Tages: Spreewälder Schweinshachse mit Sauerkraut und Brot.
Rita denkt daran, wie verrückt doch die Zeiten sind. Das neue Gasthaus auf dem Weg zum Hafen — ganz in Holz gehalten — wird auf alt getrimmt, damit es Touristen anlockt, und das hier ist uralt und man gibt sich offenbar viel Mühe, es modern erscheinen zu lassen.
Trotzdem. Können die nicht Eisbein sagen, wie es hierzulande üblich ist, weil es hierzulande einst seinen Namen bekam?
Wenn sie sich recht erinnert, hat Oma Frieda von den alten Spreewäldern erzählt, die sich vor ewiger Zeit den Knochen vom Oberschenkel eines Schweins unter die Schuhe banden, um flink über die zugefrorenen Fließe zu schlittern. Es musste genau dieser Knochen sein, der keilartig mit der flachen Seite unter dem Schuh, mit der spitzen Seite auf dem Eis lag. Kennen die Leute ihre eigene Vergangenheit nicht mehr? Sie sind doch sonst gegen alles Fremde. Manchmal ist ihnen das Fremde eben nicht fremd, manchmal geht es womöglich um Geld, um viel Geld.
Es ist gut, dass genau dieses Schild da steht. Noch besser, dass es zu ihren bissigen Gedanken über diese verkrustete Dorfgemeinschaft passt, in die sie sich leichtfertig hineinbegeben hat, ohne die Konsequenzen zu kennen. Langsam regt sich die neue Rolle wieder in ihr, für die sie kurze Zeit gar nicht in Stimmung war.
Im Vorraum des Gasthauses riecht es irgendwie modrig, irgendwie aber auch nach Seife oder als würde Großmutter in einem großen Kessel Wäsche kochen. Im Gastraum um den Stammtisch sitzen sechs Männer und zwei Frauen, stumpf in den Bewegungen, schweigsam um die Münder. Nur einer, der mit dem Rücken zu Tür sitzt, spricht über Geld, über Beiträge, wie es sich anhört. Das mittelbraune leicht gewellte Haar, der exakt ausrasierte Nacken und die eng anliegenden Ohren, das alles passt zu Jens Jedro. Er trägt einen roten Pullover, aus dem ein blitzblanker Hemdkragen blitzt.
Einer der Männer spießt verlegen mit seinem Taschenmesser einen Happen Brot vom Teller, der in der Mitte des Tisches gleich neben dem Holzschild «Stammtisch» steht, und zeigt mit seiner Beute direkt auf Rita, wie sie da mit ihrem Korb in der Tür steht und die Szenerie beobachtet. Die Köpfe der Frauen gehen synchron in dieselbe Richtung, als ob es etwas ganz Sonderbares zu sehen gibt. Der Mann mit dem roten Pullover blättert derweil in seinen Papieren herum und redet dann unbeirrt weiter. Einer der Männer, der weder jung noch alt ist, dessen Alter man wegen seines krausen Bartes nicht schätzen kann, steht auf, tritt vom Tisch weg, geht geradewegs auf Rita zu und sagt etwas in einem Ton, als habe er ihren Wunsch just in diesem Moment erwartet: »Eisbein ist aus.«
Eisbein? Sieh an, geht doch, denkt sie, und wird im Nu noch bissiger, als sie es sich bis eben noch vorstellen konnte.
»Bei mir nicht«, sagt sie und tritt ein bisschen wie naiv von einem auf das andere Bein, reibt überdies die Knöchel ihrer Handgelenke und grinst den Mann verschlagen an. Die anderen Männer starren geradeaus mit zugefrorenen Mienen. Hinter dem Tresen rumort es und im selben Moment kommt eine korpulente Mittvierzigerin mit drei übergroßen Tellern, vollgepackt mit dampfendem Eisbein und Sauerkraut, durch den engen Durchgang jongliert und flötet vor sich hin:
»Karl, wenn der Juri nicht mehr kommt, muss einer von den Männern Juris Eisbein mitessen.«
Der Bärtige, der Karl heißt und offenbar der Inhaber der Gaststätte ist, die man hier Frenzels Gasthaus nennt, dreht zornig seinen Kopf zur Frau. Die zuckt zusammen, stellt die Teller vor drei der Männer ab und ist wieder verschwunden.
Es ist entsetzlich stickig im Raum. Rita hat nicht die Absicht, eine Minute unnütz hier zu verbringen, obgleich, das zu erleben, was ihr gerade passiert, ist absolut zielführend. Es verschafft ihr sogar ein kleines Kitzeln auf der Haut. Dieses Kitzeln hatte sie schon zweimal. Das erste Mal, als sie Lenka Kalauke vom Hof gejagt hat, das zweite Mal, als sie die Garstigkeit des Jens Jedro über sich ergehen ließ. Das jetzt, dass man ihr nicht einmal ein Eisbein gönnt, ist trotzdem keine größere Sache, nur endlich eindeutig. Es ist sogar wie Balsam gegen ihre kleinen Gewissensbisse, die sie bisweilen bekommt. Wenn sie ehrlich ist, hätte es sie gewundert, ja geradezu misstrauisch gemacht, hätte man sie freundlich eingeladen.
Der Mann, dessen Stimme die von Jens Jedro ist, redet gerade davon, die nächste Versammlung gleich zwischen dem Zampern und der Zapust abzuhalten. Er spricht Sapust besonders weich, wie schon Lenka Kalauke, und er scheint ruhig und sorglos. Zwar hat er das Gerede hinter seinem Rücken wahrgenommen, nicht aber den Anlass für den Wortwechsel des Gastwirtes mit dem späten Gast.
»Es ist doch gerecht, dass, wer einen Korb bekommt, auch einen zurückbringt?«, sagt Rita schnippisch und deutet mit knapper Geste auf den Rücken im roten Pullover. Irgendwo im Unterbewusstsein von Jens Jedro entsteht gerade ein Bild, das er in diesem Moment am wenigsten erwartet hat. Sein Nacken zieht den Kopf nach vorn, doch der Körper weigert sich, der Stimme in seinem Rücken zu folgen. Bislang ist ohnehin kein System erkennbar, wie die versammelte Dorfgemeinschaft die Sache mit dem ungeliebten Gast zu Ende bringen wird, nur die Wirtin erscheint inzwischen mit weiteren drei Tellern und platziert sie vor den Wartenden.
»Wir wollen Ihnen nichts Böses, Fräulein …«, raunt die Wirtin im Vorbeigehen. Zu befürchten hat die jetzt wohl nichts mehr, ihr Mann — der bärtige Gastwirt — sitzt wieder am Tisch und massakriert angestrengt den Klumpen Fleisch auf seinem Teller.
»Ich wette, Jack The Ripper hat das Gleiche gesagt, bevor er die vielen Frauen umbrachte.«
Mit einigem Schwung stellt sie den blauen Einkaufskorb auf den Tisch nebenan, stellt sich so, dass sie der Händler Jens nicht länger ignorieren kann, und wirft ihm mit höhnischem Grinsen eine Kusshand zu.
»Die nächtliche Begegnung mit Ihnen war mir eine große Freude.«
Die Tür klappt schwer ins Schloss, ihr Schritt hallt hart von den Fliesen zurück. Ihr Mund kräuselt sich zufrieden. Sie wettet, die Stammtischgesellschaft rätselt jetzt lautstark, wer mit der nächtlichen Begegnung gemeint ist. Soll Jens Jedro ruhig zusehen, wie er da wieder rauskommt.
Draußen im Vorraum riecht es nicht mehr nach Moder und Seife. Plötzlich sticht ihr der penetrante Geruch von Schweinen in die Nase. Am liebsten würde sie mit einem Wisch die Angebotstafel ändern: Ständig im Angebot: Schweinskerle mit Sauermienen.
Dazu aber müsste sie sich wahrhaftig die Finger schmutzig machen. Riana Gora würde es vielleicht tun, aber Rita Georgi ist zu müde, zu abgespannt und dennoch so voll innerer Spannung auf den letzten Akt des Tages, dass es sie eilig nach Hause zieht.
Bevor sie unter die Dusche steigt, öffnet sie die Favoriten ihres Explorers.
Sie hat sich nicht geirrt. Lutz W. steht unter dem Text, den sie noch lesen will, bevor sie nichts, aber auch gar nichts mehr hören und noch weniger sehen will von dieser engstirnigen Welt, diesem hinterwäldlerischen Gesocks, das sich Dorfgemeinschaft nennt.
Eine halbe Stunde später perlt das warme Wasser über ihre am Morgen sehr gut eingekremte Haut. Sie steht und genießt und immer wieder denkt sie diesen einen Satz: Lutz W. ist mit ziemlicher Sicherheit dieser Lutz Wegener aus Lübbenau.
Rita fühlt sich so, als habe sie gleich zwei Rollen in einem großen Theaterstück zu spielen. Eigentlich sind es drei. Zuletzt ist noch die Nebenrolle einer Kämpferin dazugekommen, die Kämpferin gegen verkrustete Strukturen in einer Dorfgemeinschaft, die eine Mauer um sich gezogen hat, nur durchlässig für pekuniäre Vorteile.
Beklagen muss sie sich nicht. Sie selbst hatte eine Zeit lang ihren gegenwärtigen Zustand als erstrebenswert angesehen. Aber nun, wo der Winter so verdammt anhänglich ist, findet sie es nicht eben prickelnd, jeden Abend allein in ihrer Wohnung zu sitzen und vor lauter Einsamkeit zu arbeiten oder am Exposee für den nächsten Roman zu tüfteln.
Zum ersten Mal verflucht sie sogar etwas, was sie selbst einmal geschrieben hat: Einsame Menschen sollten es sich von Zeit zu Zeit einmal richtig schön machen – nur für sich selbst. Schön anziehen, den Tisch schön eindecken, bei Kerzenschein essen und einen guten Tropfen trinken.
Sie hat es ausprobiert und seither hat sie das Vertrauen in Ratgeberkolumnen völlig verloren, in ihre eigenen am meisten. Es war eine Katastrophe. Sie hat am nett dekorierten Tisch gesessen und nichts anderes gespürt, als dass sie schnöd versetzt worden ist von einem geliebten Menschen. Das war der erste Abend in ihrem neuen Leben, der mit Tränen endete. Seitdem ist sie sich gar nicht mehr so sicher, ob sie nicht doch den Erstbesten nehmen würde, wenn sie mal eine Schulter braucht. Vielleicht würde sie sogar wieder auf einen wie Nils Hegau hereinfallen?
An diesem Wochenende soll es ihr nicht so gehen. Freitagnacht, und wenn nötig am Samstag noch einmal, wird sie beim Jugendnotdienst verbringen. Ihr Artikel ist für eine ganze Zeitungsseite geplant, sobald der Umbruch es zulässt. Es ist ihr egal, wann das sein wird. Fakt ist, bei der Spree-Rundschau wird es niemanden geben, der ihren Artikel bis zur Unkenntlichkeit kürzt. Sollten die Nächte beim Jugendnotdienst keinen besonderen Anlass zur Änderung geben, steht auch der Titel bereits fest: Schattenkinder.
Hin und wieder spielt sie mit dem Gedanken, Sigurd Bramsch anzurufen und sie über die Bitte des jungen Mannes zu informieren, dessen Namen sie nicht wisse. So würde sie jedenfalls nicht lügen. Irgendeine Reaktion würde es schon geben. Entweder ihre Vermutung stellt sich als richtig heraus, oder es gibt diese gottverdammten Zufälle.
Es schneit mal wieder Ende Februar. Sie hasst diese Tage, an denen man das Kunstlicht nicht ausschalten kann, an denen man kaum bis zum Gartenzaun blicken kann. Noch einige Anrufe muss sie führen, dann wird sie sich Zeit nehmen für die Artikel, die sie über den Jungen Lutz W. gefunden hat. Inzwischen sind es mehr als zehn, Kurzmeldungen sind auch darunter.
Auf dem Anrufbeantworter bitten drei Bibliotheken der Region um einen Rückruf. «In Ihrem Interesse». «Es geht um Ihr Buch». Oder: »Wir möchten mit Ihnen eine Lesung vereinbaren.«
»Na bitte, es geht los«, murmelt sie vor sich hin. Im Bücherfrühling ist sie mit ihrem Buch bereits eingeplant, obwohl erst Anfang März mit der ersten Rezension zu rechnen ist. William Klauser, der führende Literaturkritiker, hat ihr den Termin genannt und gesagt, dass er Mark Hellmann schicke, der ein Foto schießen werde. Mark war einst nur Fotoreporter, hat sich dann aber zum Allrounder entwickelt. Quasi im Vorbeigehen auf dem Gang hat ihr Klauser sogar ein kurzes Statement gegeben. Befürchtet hat sie nichts. Klauser schreibt nie vernichtend, nur wenn man sehr sensibel liest, erkennt man die feinsinnige Mängelanalyse, die bisweilen – oberflächlich gelesen – auch noch sehr wohlwollend klingt. Das Buch sei gut, hat Klauser gesagt, aber es sei zu befürchten, dass ihr einige Menschen in der Stadt nicht mehr wohl gesinnt sein werden.
»Wieso werden?«, hat sie ihm zugeblinzelt.
»Na, na. Soweit ich es einschätzen kann, bist du überall beliebt.«
»Erstens bin ich nicht mein Buch. Zweitens ist die Autorin eine gewisse Riana Gora. Und drittens bin ich nicht nur im Verlagshaus daheim.«
Das stimme wohl, hat er gemeint. Das Pseudonym könne sehr wohl ein rettendes Moment sein.
Will Klauser – wie er liebevoll genannt wird - hat ihr in die Hand versprochen, den bürgerlichen Namen nicht zu nennen, und mit Cottbus hat sie auch nicht mehr viel am Hut. Dorthin fährt sie nur, wenn sie dringend zum Verlag muss. Wer wird sie schon als Riana Gora wiedererkennen? Also? Wichtig ist, dass die Menschen beim Lesen erkennen, woran zu zweifeln ist, nicht so sehr, an wem.