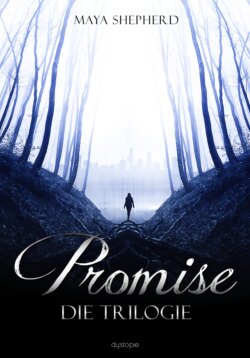Читать книгу Promise - Maya Shepherd - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1 - Die Bärentöterin
Оглавление(Sechs Jahre später)
Ein kalter Wind weht Nea ins Gesicht, während sich ihre nackten Zehen in den nassen Sand bohren und das Meerwasser ihr über die Füße schwappt. Es ist früher Morgen. Die Sonne geht langsam am Horizont auf und taucht die Welt in einen goldenen Glanz, der das tiefe Blau der Nacht vertreibt. Ihre Augen hält sie geschlossen. Sie atmet den salzigen Geruch ein und versucht, sich das Rauschen des Meeres einzuprägen. Beides ist für sie so selbstverständlich wie die Luft zum Atmen. Seit ihrer Geburt lebt sie in dem kleinen Dorf am Meer. Hier hat sie nicht nur Laufen gelernt, sondern jeden ihrer Geburtstage mit Lagerfeuer und gegrilltem Fisch am Strand verbracht. Den Ort ihrer Kindheit zu verlassen, soll einen Schlussstrich unter ihr bisheriges Leben ziehen. Zu viele Menschen sind gestorben. Zu viel Leid musste sie ertragen. Hier gibt es keine Zukunft und keine Hoffnung. Ihr Ziel ist die neu errichtete Stadt Promise im Süden. Nea wird mehrere Wochen unterwegs sein, um sie zu erreichen, doch das ist es ihr wert. Sie würde jede Gefahr und Anstrengung auf sich nehmen, um zu vergessen und von vorne anfangen zu können. Vor ungefähr zwei Jahren hatte sie von Promise erfahren. Die einzige Stadt, die über Strom verfügt. Die einzige Stadt, die ein Leben ohne Angst ermöglicht. Die einzige Stadt, die eine bessere Zukunft verspricht. Natürlich gewähren sie nicht jedem Zutritt. Es gibt strenge Auswahlverfahren, denn es ist eine Ehre, Einlass in Promise zu erhalten.
Nea ist weder Hochleistungssportlerin noch ein Technik-Genie, aber sie ist nicht auf den Kopf gefallen und lernt schnell. Sie hat in den letzten sechs Jahren einen starken Überlebenswillen entwickelt und weiß, dass sie viel schaffen kann, wenn sie erst einmal der Ehrgeiz gepackt hat. Sie gehört nicht zu den Mädchen, die sich irgendeinen starken Typen suchen, der sie beschützt, sondern hat gelernt, sich allein durchzuschlagen. Sie musste es lernen. Denn sie war alleine auf der Welt, ohne Familie oder Freunde.
Viele machen sich deshalb die Macht der Gemeinschaft zunutze und jagen oder überfallen zusammen. Gemeinsam ist man stärker als allein, doch je mehr Personen aufeinander treffen, umso deutlicher unterscheiden sich die Starken von den Schwachen. Während sich die Starken nehmen, was sie wollen, bleibt für die anderen nur der Rest.
Das beste Beispiel dafür sind die Carris. Sie sind eine Art Sekte, die sich nach der Seuche gebildet hat. Anfangs hat sie jeder als Spinner abgetan, da sie einen von ihren eigenen Leuten als Gott verehren. Angeblich ist er von den Toten wiederauferstanden und aus dem Meer gestiegen. Sie nennen ihn Ereb, den Gott des Chaos. Nie hat ihn jemand zu Gesicht bekommen. Nea glaubt nicht an Götter, weder gute noch böse.
Chaos herrscht auf der ganzen Welt, in jeder noch so kleinen Ecke, doch weder Ereb noch sonst irgendjemand kann es kontrollieren.
Doch im letzten Jahr haben die Carris immer mehr Mitglieder gefunden, sodass sie nun ein ganzes Gebiet beherrschen. Sie nennen es Dementia. Die wenigsten Menschen glauben wohl wirklich an Ereb, den Gott des Chaos, sondern haben sich den Carris nur angeschlossen, weil sie dort für ihren Glauben mit Nahrung belohnt werden. Es ist nicht unbedingt ein schlechtes System. Für viele ist es das Einfachste, aber Nea ist ihre Freiheit wichtiger als ein Dach über dem Kopf.
Jeder Bewohner in Dementia bekommt von den Carris eine Aufgabe zugeteilt. Die meisten müssen auf den Feldern arbeiten oder das Land verteidigen. Wenige Auserwählte dürfen die Zeremonien rund um die Huldigung Erebs leiten und sind damit eine Art Priester. Wer einmal Dementia betritt, den lassen sie nicht wieder gehen. Entweder schließt man sich ihnen an oder man stirbt. Doch die Carris sind nicht wirklich schlau. Man kann ihnen leicht etwas vorspielen. Genau das beabsichtigt Nea zu tun. Denn um Promise näher zu kommen, führt kein Weg an Dementia vorbei.
Bevor Nea geht, braucht sie sich von niemandem zu verabschieden. Denn obwohl sie hier aufgewachsen ist, hat sie nie engere Bindungen geschlossen. Nur das Meer, das wollte sie heute noch einmal sehen. Es war ihr stets der treueste Freund. Am Anfang, als die Trauer um ihre Eltern noch übermächtig war, hat sie Tag und Nacht am Strand verbracht und nur das stete Rauschen der Wellen konnte sie in den Schlaf wiegen. Gleichzeitig war es ihr immer auch eine Nahrungsquelle. Es hat nicht lange gedauert, bis sie gelernt hatte, ein Feuer zu entzünden. Etwas, was ihr doch im schützenden Garten ihres Elternhauses noch als ein Ding der Unmöglichkeit erschienen war. Doch die Not lehrt die einen beten und die anderen Feuer zu machen.
Das Meer gab ihr Zuversicht, wenn sie hoffnungslos war, und Ruhe, wenn sie vor Wut tobte. Es war immer da, ihr ganzes Leben lang, und es nun zurückzulassen, fällt ihr schwerer als alles andere. Doch sie muss endlich losziehen, wenn sie etwas an ihrem Leben ändern will. Nea ist schließlich nicht ohne Grund noch vor dem Morgengrauen aufgestanden und hat ihr Lager mit Schlafsack und Rucksack verlassen. In letzterem befindet sich nur das Nötigste. Ein paar Konserven, zwei Wasserflaschen, ein dünnes Seil, ein Netz, zwei Feuersteine, einen Kompass, eine Landkarte und ein Messer, mit dem sie sich sowohl verteidigen als auch ernähren kann. Kein sentimentaler Ballast. Sie besitzt weder ein Foto noch ein Andenken, Schmuckstück oder Tagebuch ihrer Eltern. Sie weiß, dass andere an solchen Erinnerungsstücken hängen, mehr als ihrem Leben gut tut. Leicht lassen sie sich damit erpressen. Dieser Gefahr kann Nea nicht zum Opfer fallen, dabei hätte sie sich so leicht ein Erinnerungsstück aus ihrem Zuhause holen können. Sie lebte schließlich bis heute in der Stadt, in der sie geboren wurde. Doch seit sechs Jahren, seit Polyora, hat sie das Haus nicht mehr betreten, sich nicht einmal in die Nähe davon gewagt. Sie will nicht sehen, wie verwüstet es nun von den Überfällen der Gangs daliegt. Sie will es so in Erinnerung behalten, wie es war, als ihre Eltern und sie noch eine glückliche Familie waren und ihr Lachen durch die großen Fenster auf die Straße drang.
Ihre Gedanken an glücklichere Zeiten versuchen sie krampfhaft an diesem Ort zu halten, doch ihre Entscheidung ist gefallen. Konsequent lenkt Nea ihre Füße aus dem Wasser und zieht sich erst ein Sockenpaar und dann noch ein zweites an. Die Löcher des einen Sockenpaares werden von dem anderen verdeckt, um so ihre Füße vor Kälte zu schützen. Zudem sind die braunen Armeestiefel etwas groß. Sie gehörten Miro.
Konzentriert bindet sie sich die Schuhe, bloß nicht wieder aufs Meer blicken und in Gedanken verfallen. Viel zu lange hat sie sich aufhalten lassen. Ein weiter Weg liegt vor ihr, quer durch den Wald, voller unbekannter Gefahren, und so stapft sie die sandigen Hügel empor, ohne sich auch nur noch einmal umzublicken.
Der Wind bläst ihr entgegen, als wolle er sie zurückdrängen, sie aufhalten. Nea wandert durch das hohe Schilfgras, immer weiter geradeaus, bis sie hinter einer bestimmt einen Meter hochgewachsenen Wiese den Wald erblicken kann. Er liegt still und verlassen da, doch es ist bereits hell genug, um ihm die Schrecken der Nacht zu nehmen. Das hohe Gras ist noch feucht vom Tau und wieder ist sie dankbar für ihren nässeabweisenden Mantel und die festen Stiefel.
Sie lässt das taufeuchte Gras hinter sich und betritt den von Nadeln übersäten und von Moos bedeckten, weichen Boden des Waldes. Von nahem wirkt er nicht länger angsteinflößend, ganz im Gegenteil. Durch die Baumkronen strahlt sanft das Licht der mittlerweile aufsteigenden Sonne und hüllt alles in einen märchenhaften Glanz. Zwischen den Bäumen tanzen einzelne Lichtstrahlen umher. Leises Vogelgezwitscher und das sanfte Rascheln von Blättern ist zu hören. All das erinnert Nea plötzlich an ein Buch aus Kindertagen, aus dem ihr Vater ihr oft vorgelesen hat. Es handelte von einer Fee, die sich in einen Menschenjungen verliebt hatte. In ihrer Phantasie hat sie sich den Wald, in dem die Fee, die in einem Baumloch lebte, neben Herrn Eichhörnchen, den Tau der Blätter zum Frühstück trinkend und saftige rote Waldbeeren zu Mittag und ein paar Nüsse am Abend essend, immer genau so vorgestellt, wie der, durch den sie jetzt wandert. Die Fee sang mit den Vögeln um die Wette, badete in Tümpeln und legte sich auf weichem, tannengrünem Moos zu Bett. So sorglos und unbeschwert. Gerade diese alberne Geschichte gibt ihr nun Mut für ihre Reise.
Mittlerweile ist es Abend geworden. Die Sonne sendet ihre letzten Strahlen über die Welt, um sie dann dem Mond zu übergeben. Ein ewiger Kreislauf. Die Strahlen, die heute Morgen zwischen den Bäumen durchschienen und den Wald in eine Zauberlandschaft verwandelten, sorgen nun dafür, dass die Bäume lange dunkle Schatten werfen. Das Licht ist zwar immer noch golden, und würde man in einem geheizten Zimmer sitzen, könnte man annehmen, dass es angenehm warm in der Sonne ist, doch die Realität sieht anders aus. Es ist bitterkalt. Auch wenn im Wald kaum Wind weht.
Es riecht nach Schnee. Auf dem freien Feld wäre es sicher noch lange hell, doch hier mitten im Wald, wo die Bäume das Licht abfangen, wird es bald so dunkel sein, dass man kaum noch die eigene Hand vor Augen sehen kann.
Für Nea bedeutet das, sich Nahrung und ein Nachtlager zu suchen. Den ganzen Tag ist sie quer durch den Wald gelaufen. Ihre einzige Orientierungshilfe ist der Kompass und eine Karte, die sie einst von einem Reisenden geschenkt bekommen hatte. Sie erinnert sich, wie er damals in das kleine Dorf am Meer kam und für einen warmen Platz am Feuer in der Gemeindehalle mit Geschichten über seine Reisen bezahlte. Angeblich war er selbst schon in Promise gewesen und hatte dort einen Spielfilm auf einer Kinoleinwand gesehen, ganz wie in alten Zeiten.
Nea war es schwer gefallen, ihm zu glauben, denn wer würde Promise freiwillig wieder verlassen, wenn er erst einmal Zutritt erhalten hatte? Normalerweise hatte sie keine Freude an unnötigen Konversationen, doch es hatte sie interessiert, was der Reisende zu berichten hatte, und so hatte sie ihn gefragt, warum er nicht in Promise geblieben sei. Er hatte gelacht und geantwortet, dass ihm dafür seine Freiheit zu wichtig sei. Er wolle selbst darüber entscheiden, wie er seinen Tag gestalte, und bräuchte niemanden, der ihm vorschreibt, was er zu tun habe. Schon damals hielt Nea dies für eine blöde Ausrede und ist auch heute noch davon überzeugt, dass er einfach nicht gut genug war, um in Promise bleiben zu dürfen. So wichtig ihr selbst auch ihre Freiheit ist, weiß sie, dass ein Leben ohne Regeln in einer Gemeinschaft nicht funktioniert. Das war schon immer so und wird wohl auch immer so bleiben. Entscheidend ist nur, wie die Regeln festgelegt werden: Demokratisch in gemeinsamer Wahl oder diktatorisch von einem Einzelnen, der nur sich selbst in die Taschen spielt. Wahrscheinlich hatte der Reisende nicht einmal Eintritt erhalten, sondern die Leinwand nur von den Stadttoren aus bewundert. Doch das hatte Nea ihm natürlich nicht ins Gesicht gesagt. Er schien sie wohl ganz nett gefunden zu haben, denn er hatte ihr eine Karte geschenkt, in die er alle Gebiete eingezeichnet hatte, die er bereits kannte. Über die alten Städtenamen sind neue Linien und Namen gezogen. Mit Rot hatte er das Gebiet der Carris markiert. Fast am anderen Ende der Karte liegt in leuchtendem Grün Promise, die Stadt der Verheißung.
Allein durch die Wege und Abstände auf der Karte scheint es Nea unmöglich zu sagen, wie viele Tage oder Wochen sie unterwegs sein wird, bis sie erst Dementia und schließlich Promise erreicht. Sie wird Dementia erst an den roten Kutten der Carris erkennen. Bis es soweit ist, darf sie sich nur wenig Zeit zum Ruhen gönnen, muss immer auf der Hut sein. Denn der Wald ist Niemandsland und man kann nie wissen, wer oder was einem dort droht. Befindet man sich erst einmal in Dementia, so weiß man, dass die Carris einen gefangen nehmen werden, sobald sie eine Person ohne Kutte entdecken. Doch auch schon hier, mitten im Wald, lauern Gefahren. So kann man sowohl auf wilde Tiere treffen, als auch auf Reisende, die sich fremdes Eigentum erschleichen wollen. Es können Fallen von Wilderen ausgelegt sein, oder man trifft einfach auf einen der Wahnsinnigen, die jemanden nicht bedrohen oder töten, weil sie Hunger haben oder das fremde Eigentum stehlen wollen, sondern einfach, um einen leiden zu sehen. Denn das Leid und der Schmerz anderer sind zu ihrem Lebenselixier geworden. Nea kann ihnen das nicht einmal zum Vorwurf machen, denn sie sind auch nur ein Opfer der neuen Welt, so wie alle anderen auch. Aber trotzdem entscheidet in so einem Fall über Leben und Tod, wer als erstes seine Waffe zieht und zusticht, zuschlägt oder sein Leben auf andere Weise rettet.
Seit einiger Zeit hört Nea das stetige Rauschen eines Gewässers und folgt ihm. Langsam wird es lauter und bald sieht sie einen schmalen Bachlauf, der sich mitten durch den Wald windet. Seitdem es keine Autos, Flugzeuge oder andere Maschinen mehr gibt, die Lärm erzeugen könnten, ist das Plätschern eines Flusses oder auch nur der Gesang einer Lerche meilenweit zu hören. Noch einer der vielen Punkte, die sie sich oft ins Gedächtnis ruft, um am Ausbruch der Seuche etwas Positives zu finden.
Der Bach ist nicht sehr tief, aber tief genug, um verschiedenen Fischen als Lebensraum zu dienen. Nea bleibt nicht mehr viel Zeit, um sich einen Fisch zu fangen, ihn zu braten und sich ein Nachtlager einzurichten. So zögert sie nicht lange, zieht die Schuhe und die zwei Paar Strümpfe aus und steigt in das eiskalte Wasser. Am Anfang hatte sie das immer die meiste Überwindung gekostet, doch mittlerweile zuckt sie kaum noch zurück. Der Hunger treibt sie zu sehr an. Es ist um einiges leichter, einen Hasen oder ein Wiesel in eine Falle zu locken, als einen Fisch zu fangen. Dafür braucht man Geduld. Langsam und vorsichtig bewegt sich Nea im Wasser, bloß keine ruckartigen Bewegungen machen. Sie bleibt so ruhig wie möglich im kalten Wasser stehen und passt sich der Umgebung an, wird ein Teil von ihr, bis ihr die Fische um die Beine schwimmen. Dann beugt sie sich nach vorne und nähert sich einem in der Strömung stehenden Fisch von hinten, indem sie mit der Hand eine Halbröhre formt, die sowohl vorne als auch hinten offen ist. Vorsichtig bewegt sie die Hand zum Mittelteil des Fisches, wobei sie ihn in Längsrichtung sachte streift. Der Fisch bleibt ruhig und schwimmt nicht weg. Er erkennt die nahende Gefahr nicht. Als sie die Kiemen des Fisches erreicht, zögert sie nicht, sondern greift gezielt zu. Er ist mittelgroß und zappelt in ihrer Hand, ringt mit dem Tod. Sie könnte ihn nun so festhalten und dabei zuschauen, wie langsam das Leben in seinen Augen erlischt, bis er still und schlaff in ihrer Hand liegt. Doch Nea tötet den Fisch nicht aus Grausamkeit, sondern um zu überleben, und so schlägt sie seinen Kopf auf den harten Stein, um ihn nicht länger leiden zu lassen. Nea tötet niemals zum Spaß, nicht einmal einen Fisch.
Nun kommen ihre Feuersteine zum Einsatz. Sie sind von großem Vorteil, wenn das Holz im Wald feucht ist. Nea stapelt ein paar trockene Laubblätter übereinander und schlägt dann die beiden Steine nur wenige Male aneinander, sodass ein Funke in das Laub fliegt. Ein sanfter Atemstoß genügt, um den Funken in ein kleines Feuer zu verwandeln. Den Fisch nimmt sie aus, spießt ihn auf einen Stock und hängt ihn ins Feuer. In der Zwischenzeit befestigt sie in einem Busch am Fuße eines Baums ihr Netz. Wenn sie Glück hat, wird sich in der Nacht ein kleines Tier darin verfangen, das sie dann am Morgen braten und mitnehmen kann. Der Fisch duftet köstlich, auch ganz ohne Gewürze. Nea hofft nur, dass sein Geruch keine Fremden anlocken wird. Denn sie ist nicht bereit zu teilen, weder ihren Fisch noch ihre Zeit oder sonst irgendetwas. Deshalb zieht sie schnell den Fisch aus dem Feuer und löscht es, sodass nur noch die Glut leise vor sich hin zischt. Es ist gerade noch hell genug, um die verbrannten Stellen am Fisch zu finden und sie mit dem Allzweckmesser abzuziehen. Der Fisch ist noch heiß, aber sein Fleisch zart. Er füllt Neas Magen mit einer wohligen Wärme. Es ist ein Moment der Ruhe, der einem nur selten in dieser Welt gewährt wird. Als sie das kleine Mahl beendet hat, wirft sie die Reste des Fisches zurück in den Bach, um keine Fleischfresser anzulocken. Sie geht zu dem Baum, an dessen Fuß sie ihre Falle aufgestellt hat, holt ihr Seil aus dem Rucksack, wirft es über eine der unteren Astgabeln und zieht es straff, testet, ob es ihr Gewicht hält. Dann zieht sie sich an dem Seil nach oben. Nachdem sie den Ast erreicht hat, wirft sie das Seil erneut ein Stück höher auf den Baum, auf einen Ast, der ihr dick genug erscheint, um ihr Gewicht tragen zu können. Wieder zieht sie sich an dem Seil empor. Als sie sicher auf dem Ast steht, steckt sie ihren Rucksack tief in den Schlafsack. Nur das Messer lässt sie draußen und schiebt es in eine Schlaufe am Bund ihrer Hose. Den Schlafsack wirft sie über den breiten Ast und steigt vorsichtig hinein. Sobald sie in dem Schlafsack liegt, bindet sie sich mit dem Seil am Ast fest. Als Miro ihr nach dem Tod ihrer Eltern vorschlug, auf diese Weise zu schlafen, hatte sie nur ungläubig mit dem Kopf geschüttelt…
„Ich werde vom Baum fallen“, rief Nea lachend aus, während sie den hohen Apfelbaum empor spähte.
„Wovor hast du mehr Angst? Vom Baum zu fallen oder überfallen zu werden?“, fragte Miro sie mit ernster Stimme. Ohne zu zögern warf er das
Seilende über den dicksten Ast und zog es fest.
So galant wie eine Katze erklomm er den Baum und grinste Nea von oben herab an: „Komm schon, Angsthase, ich helfe dir.“
Mit einem Seufzen gab Nea nach und zog sich an dem Seil den Baum empor, doch dabei war sie weder so schnell, noch so elegant wie Miro. Sie fühlte sich mehr wie ein nasser Sack Kartoffeln. Bei dem letzten Meter kam ihr Miro zur Hilfe. Mit einem festen Händedruck zog er sie neben sich auf den Ast. Während Miro in der Höhe stand, als hätte er schon immer auf einem Baum gelebt, hatte Nea Probleme, das Gleichgewicht zu halten. Nur ein Blick in Richtung Boden genügte, um sie zum Schwanken zu bringen. Verzweifelt klammerte sie sich an Miros Arm fest.
„Ich kann hier ja nicht mal stehen, wie kannst du dann von mir erwarten, hier zu schlafen?“
„Ich erwarte es nicht, es ist allein deine Entscheidung.“
Ohne sie weiter zu beachten, breitete er den Schlafsack auf dem Ast aus.
„Außerdem haben wir nur einen Schlafsack“, drängte Nea weiter.
„Seit wann stört dich das? Als wir noch in Betten geschlafen haben, bist du ohnehin jede Nacht zu mir gekommen“, zog Miro sie auf. Auch wenn sie nur seinen Rücken sah, konnte sie sein freches Grinsen vor sich sehen. Verärgert gab sie ihm einen leichten Stoß. Miro stolperte stärker, als sie erwartet hätte. Er wirkte so sicher, dass sie nicht gedacht hätte, dass etwas passieren könnte. Doch anscheinend konnte er sich plötzlich nicht mehr halten und stürzte vom Baum. In letzter Sekunde bekam er den Ast noch zu packen und hielt sich daran fest.
„Miro, Miro, das wollte ich nicht“, kreischte Nea, stürzte an seine Seite und streckte ihm hilfsbereit ihre Hände entgegen. „Komm, ich helfe dir.“
„Mach das bloß nicht noch einmal“, schimpfte Miro und ließ sich von ihr zurück auf den Ast helfen.
Kaum, dass er wieder sicher saß, begann er jedoch erneut schelmisch zu grinsen und äffte Neas Stimme nach: „Miro, darf ich bitte bei dir schlafen? Ich hatte einen Alptraum.“
Nea verkniff es sich, ihn erneut zu schlagen, stattdessen presste sie ihre Lippen schmollend aufeinander. „Dir ist das doch ganz recht. Du hast nämlich genauso Alpträume.“
„Ja, von dir, die mir jede Nacht die Hälfte meines Bettes klaut. Ich bete jeden Abend, wenigstens für eine Nacht mal mein Bett für mich alleine zu haben.“
An seinem Lächeln merkte sie, dass Miro sie nur weiter aufziehen wollte und seine Worte nicht ernst meinte.
„Gib es zu, ohne mich wärst du hoffnungslos verloren. Ohne mich könntest du nicht einmal schlafen.“
„Gar nichts gebe ich zu. Ohne dich müsste ich mir nicht immer dieses eingebildete Gerede anhören. Ohne dich hätte ich endlich meine Ruhe.“
Jetzt hat sie ihre Ruhe. Aber was gäbe sie nun dafür, noch einmal Miros überhebliche Stimme zu hören? Wütend schüttelt sie den Kopf, um die Gedanken an ihn zu vertreiben. Ein Blick durch das Blätterdach in den klaren Sternenhimmel reicht, damit ihre Augen zufallen und sie in einen traumlosen Schlaf versinkt.
Träume rauben einem oft die Kraft, da man in dieser Welt nur noch selten von schönen Dingen träumt. Meistens befindet man sich dann in einer Traumwelt, die der Realität nicht unähnlich ist. Nur mit dem Unterschied, dass sich eine ständige Nebelbank über alles legt und es oft noch grausamer zugeht, als es ohnehin schon ist. Wenn man dann morgens schweißgebadet zu sich kommt, verfolgen einen die Ängste der Nacht den ganzen Tag. Sie legen sich wie Wolken auf die eigene Konzentration, die in dieser Welt überlebensnotwendig geworden ist. Man muss auf jedes kleinste Knacken eines Zweiges lauschen und auf jeden eigenartig wirkenden Schatten achten, denn überall könnte ein Hinterhalt verborgen sein.