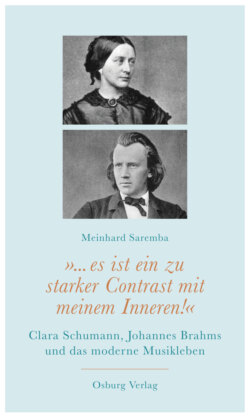Читать книгу "... es ist ein zu starker Contrast mit meinem Inneren!" - Meinhard Saremba - Страница 10
Gefangen in Zeit und Raum
ОглавлениеDie Umwege, die Clara und Johannes zunächst gingen, machten später das intensive Kennenlernen und die lebenslange Freundschaft erst möglich. Jeder hatte für sich ausreichend Erlebnisse gesammelt, um den anderen daran teilhaben zu lassen, und es hatten sich Grundhaltungen herausgebildet, die den gemeinsamen Weg durch das weitere Leben bestimmten. Dreieinhalb Jahre nach der flüchtigen Begegnung in Hamburg mag Johannes den Schumanns von dem jugendlichen Versuch der Kontaktaufnahme erzählt haben. Es ist sogar sehr wahrscheinlich, denn als Clara ihn zum ersten Mal im November 1854 in der alten Hansestadt besuchte, erinnerte er in einem Brief zur Reisevorbereitung daran, er kenne das Hotel von damals: »Sie wohnen im Viktoria-Hotel am Jungfernstieg, ich behauptete schon in Düsseldorf, Sie hätten daselbst früher gewohnt, sehen Sie ich habe recht!«18
Jedoch erschien anfangs illusorisch, dass man sich überhaupt jemals wieder so nahekommen sollte wie im Frühjahr 1850. In künstlerischer Hinsicht spielten die Schumanns in einer völlig anderen Liga als jeder andere, der in Hamburg ein Instrument beherrschte. Die wirklich hochbegabten Hanseaten hatten es andernorts zu etwas gebracht: Felix Mendelssohn Bartholdy in Berlin und Leipzig sowie Carl Reinecke im Rheinland und später in Leipzig. Die Schumanns kamen aus Sachsen, arbeiteten aber seit September 1850 in Düsseldorf. Dies war für einen namenlosen Musikanten aus dem Norden ohne Kontakte in der Musikszene eine nahezu unüberwindliche Distanz, zu der sich noch persönliche und praktische Hindernisse gesellten. Johannes selbst war nicht aufdringlich. Er wurde immer wieder auf die Schumanns verwiesen und letztlich eher zu ihnen hingeleitet, als dass er den Berühmtheiten nachstellte. Zudem war das Reisen nicht nur mit hohen Kosten verbunden, sondern auch mit verkehrstechnischen und politischen Hindernissen. Johannes Brahms wurde schon in die Ära einer neuen Infrastruktur hineingeboren; hingegen hatten Robert und Clara Schumann den bisher größten Teil ihres Lebens in einer Epoche zugebracht, in der man selbst auf langen Strecken beschwerliche Kutschfahrten auf sich nehmen musste. In den Genuss der neuen Dampfeisenbahn kam man vorerst nur auf vereinzelten, kurzen Nebenstrecken wie etwa ab 1835 zwischen Nürnberg und Fürth, 1838 zwischen Potsdam und Berlin sowie 1844 zwischen Altona und Kiel. Bis das Grundkonzept eines deutschen Eisenbahnsystems, wie es dem Nationalökonomen Friedrich List vorschwebte, auch nur halbwegs Gestalt annehmen konnte, sollte mindestens eine weitere Dekade vergehen. Clara Schumann war seit ihrer Jugend mit Lists Töchtern befreundet und erlebte die Schwierigkeiten sowie die Versuche, sie zu bewältigen, unmittelbar mit. Eindringlich schilderte beispielsweise der spätere Gewandhauskapellmeister Carl Reinecke, wie er auf dem Weg zur Leipziger Ikone Mendelssohn von Grasbrook in Hamburg zunächst mit einem Dampfboot auf der Elbe stromaufwärts bis Magdeburg fahren musste, was von 8 Uhr morgens bis zum übernächsten Tag um 3 Uhr nachmittags dauerte. Erst von dort konnte er die 1840 fertiggestellte Zugverbindung nach Leipzig nehmen. Bei Geschwindigkeiten von bis zu 65 Stundenkilometern bei Dampfwagen wie »Adler« und seiner Schwestermaschine »Pfeil« sowie mehreren Haltestationen dauerte die Reise etliche Stunden; ab den 1890er-Jahren fuhren Lokomotiven im Personenverkehr in Deutschland und Österreich schneller als 100 Stundenkilometer. Reinecke erschien das Tempo, mit dem man auf den Schienen dahinrollte, »geradezu märchenhaft«.19 Bei der Einrichtung dieser Verbindung gab es ein grundsätzliches Problem, das für Clara Schumann und Johannes Brahms weit über die Hälfte ihres Lebens hinweg Alltag war: die Kleinstaaterei der deutschsprachigen Länder. Die Magdeburg-Leipziger Eisenbahn-Gesellschaft entwarf eine Strecke, die mehrere Hoheitsgebiete berührte, denn neben den Königreichen Preußen (Magdeburg, Halle) und Sachsen (Leipzig) durchquerte sie auch das Herzogtum Anhalt-Köthen. Jeder Grenzübertritt bedeutete Passkontrollen, andere Währungen, andere Preise, andere Mentalitäten und andere Uhrzeiten. Bis kurz vor ihrem Lebensende kannten Clara und Johannes deutschsprachige Gebiete nur mit unterschiedlichen Zeitzonen, denn bis 1893 änderte sich die Ortszeit von West nach Ost pro Längengrad um eine Minute. Signalisierte die Turmuhr in Düsseldorf 12 Uhr mittags, war es in Baden-Baden bereits 12:07 Uhr, in Hamburg 12:12 Uhr und in Berlin 12:27 Uhr. Um Missverständnisse bei Empfängen und Konzertbesuchen sowie Verspätungen und Zusammenstöße der öffentlichen Verkehrsmittel zu vermeiden, erschien eine einheitliche Zeitregelung dringend erforderlich. Eine Einigung lag trotz des Ausbaus der Fernverbindungen allerdings in weiter Ferne – noch viele Jahrzehnte musste man in Kauf nehmen, dass durch das Ortszeitensystem die kostbare Taschenuhr mitunter schon beim Überqueren der Stadtgrenze zwei Minuten falsch ging. Gegenüber Clara meinte Johannes einmal, er sei »ein etwas altmodischer Mensch« und »kein Kosmopolit«, sondern eher jemand, der »wie an einer Mutter« an seiner »Vaterstadt hänge«.20 Kein Wunder, dass es die Familie Brahms nicht in die Ferne zog.