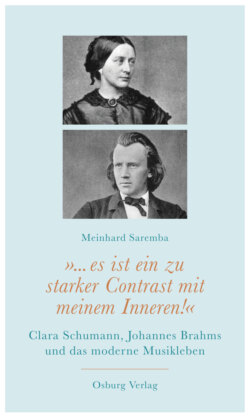Читать книгу "... es ist ein zu starker Contrast mit meinem Inneren!" - Meinhard Saremba - Страница 12
Ungarn an der Elbe
ОглавлениеFür Johannes Brahms begann die Fremde bereits vor der Haustür. Das vor den Toren der alten Hansestadt gelegene Altona wurde zwar ab 1815 Teil des Deutschen Bundes, stand aber bis 1864 unter dänischer Verwaltung. An einem anderen Ende des Ortes begann man kurz nach Brahms’ Geburt damit, die Hafenanlagen vor dem Hamburger Berg, dem heutigen St. Pauli, zu erweitern, denn durch die Industrialisierung wurden Elbe, Nordsee und Atlantik zu wesentlichen Transitlinien in alle Welt. In der damaligen Geschichtsschreibung sprach man über das »in seinen Handelsbeziehungen weltbürgerliche, in seinem innersten Wesen aber kerndeutsche Hamburg«.30 Die expandierende Stadt zog viele Auswanderer auf dem Weg in die USA an. Hamburg entwickelte sich im 19. Jahrhundert zum Umschlagplatz für Waren und Kulturen: Die gescheiterten mitteleuropäischen Revolutionen von 1848/49 und etliche Missernten trieben zahllose Menschen dazu, auf einem anderen Kontinent, der ausreichend Platz bot, einen Neuanfang zu wagen. Nachdem im August 1849 der Aufstand der Ungarn gegen die Habsburger fehlgeschlagen war, strömten zudem etliche der insgesamt etwa 4000 Exilanten aus Ungarn in die Hansestadt, um von dort nach jenseits des Atlantiks auszusiedeln.
In Hamburg bildete sich eine kleine ungarische Gemeinschaft, zu der auch Eduard Reményi gehörte. Er stammte aus Nordungarn, hieß aber eigentlich Eduard Hoffmann – kaum ein Name, mit dem man feurige Rhythmen aus der Region um den Balaton verbindet. Viel eher konnte er mit einem Pseudonym wie Ede Reményi den exotischen Geigenvirtuosen mimen. Er hatte eine traditionelle Ausbildung bei Joseph Böhm am Konservatorium der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien durchlaufen, glänzte in seinen Konzerten aber auch mit den Werken verstorbener Klassiker. Zu seinen Glanznummern zählten vor allem Stücke des magyarischen Typus »nach der Art der Zigeuner«. Durch ihn erhielt Brahms, schon lange bevor er das Land je bereiste, eine frühe Prägung und ein Faible für ungarische Melodien.
Claras berühmtester Gegenpart in der Klavierkunst kam ebenfalls aus Ungarn: Liszt Ferenc, oder wie man ihn in deutschsprachigen Gefilden nannte: Franz Liszt. Er konnte ein wenig Ungarisch, war durch seine Mutter deutschsprachig aufgewachsen und beherrschte auch fließend Französisch. Als Reményi den 19-jährigen Johannes Brahms Anfang 1853 überredete, ihn als Pianist auf einer Konzerttour zu begleiten, ahnte dieser noch nicht, dass er innerhalb von nur fünf Monaten seine Feinde und Freunde fürs Leben kennenlernen sollte.