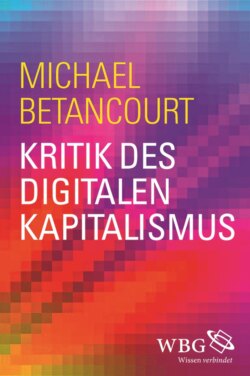Читать книгу Kritik des digitalen Kapitalismus - Michael Betancourt - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
§ 1.1
ОглавлениеDer Historiker T. J. Jackson Lears erörtert in seinem Buch No Place of Grace: Anti-Modernism and the Transformation of American Culture, wie sich die Ideologie der „protestantischen Arbeitsmoral“ im 19. Jahrhundert entwickelt hat. Seine Analyse stellt die Ursprünge der Auslagerung von Arbeit in andere Länder als Nebeneffekt der Ideologie der „autonomen Leistung“ dar: Im 19. Jahrhundert verwendeten die Oberschichten das Modell der „protestantischen Arbeitsmoral“, in Verbindung mit Thomas Robert Malthus’ Verknüpfung von wirtschaftlichem Gewinn mit moralischer Selbstbeschränkung in seinem Werk An Essay on the Principle of Population und Adam Smiths kapitalistischer Theorie „freier Märkte“ in seinem Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, zur Konstruktion eines liberalen ethischen Modells, in dem wirtschaftlicher Erfolg – der amerikanische „self-made man“ – zugleich als Beweis spirituellen und moralischen Erfolges galt. Das Erzielen dieses Erfolges war ein Akt des persönlichen Willens. Spirituell und moralisch höherstehende Individuen würden für die Befolgung ihrer höheren moralischen Maßstäbe ökonomisch belohnt. Diejenigen, die arm oder wirtschaftlich erfolglos waren, waren demnach auch moralisch minderwertig, und die Erfolgreichen rechtfertigten ihre Stellung in der Gesellschaft auf diese Weise gleich zweimal:
Jahrzehntelang fiel die Aufgabe [ein Ethos der autonomen Leistung zu rechtfertigen] dem Moralphilosophen zu […]. Das Gewissen eines Menschen unterrichtete ihn über das moralische Universum; da ethische Wahrheiten erkennbar waren, war das Problem der Moralität schlicht eine Frage des Willens: Man wählte seine Pflicht oder wich ihr aus. Und Pflicht involvierte, in jedem Fall, eigenständige Leistung. Das disziplinierte Verfolgen individuellen Eigeninteresses war ein moralischer Imperativ; Wohlstand hing von Tugend ab.4
„Autonome Leistung“ erlaubt eine Neudefinition von Bildung als eines privaten statt eines öffentlichen Guts. Die zentrale These dieser Ideologie lautet, dass das Individuum durch persönliche Arbeit, ohne Unterstützung durch die Regierung, Freunde, Familie, ererbte Stellung oder irgendwelche anderen äußeren Hilfen, Erfolg erzielt. Sie ignoriert viele der Vorteile, die diejenigen, denen sie nützte, bereits besaßen, bevor sie anfingen, und sie entschuldigt die Weise, auf die sie ihren Erfolg erzielten: durch die Ausbeutung der Arbeit anderer. Dieser Anschein rechtfertigt die Verlagerung sämtlicher Jobs ins Ausland, mit Ausnahme derjenigen auf der obersten Ebene des Managements – des Direktors und Vorstands –, die sämtlich Mitglieder der wirtschaftlich privilegierten Oberschichten sind. Die Parallelen zwischen der Verlagerung der physischen Produktion und der immateriellen Produktion (sowie von Dienstleistungen) ins Ausland könnten ein Anzeichen dafür sein, dass sich die Automatisierung immaterieller Aktivitäten, wie im früheren Fall der physischen Arbeit, in nächster Zeit vollziehen könnte.
Wie Dion Dennis hervorgehoben hat, waren die Wellen von Hochschulabsolventen zwischen 1950 und 1980 durch die unmittelbaren wirtschaftlichen Gewinne, die ihnen durch die von der Regierung der USA unterstützte, höhere Bildung ermöglicht wurden, in der Lage, ihren Lebensstandard dramatisch zu verbessern.5 Diese Veränderung der gesellschaftlichen Stellung nährt die Ideologie der „autonomen Leistung“ durch eine kurzsichtige Leugnung der Rolle, die die Regierung bei diesem sozialen Aufstieg spielte, und erzeugt so eine Situation, in der die Verschiebung von einem allgemeinen Gut zu einer persönlichen Vervollkommnung die eigennützige Ideologie widerspiegelt, die von der Oberschicht des 19. Jahrhunderts eingesetzt wurde: Sie inszeniert die Prämisse, dass Erfolg ohne Unterstützung durch individuelle Arbeit erzielt wird.
Das Abwälzen der Verantwortung für Bildung auf das Individuum zeigt, dass die Mittel- und Unterschichten, die bestrebt sind, ihre soziale Position zu verbessern, die Ideologie der „eigenständigen Leistung“ übernommen haben. Dennis hat diese Verschiebung mit der Vorherrschaft des neoliberalen Kapitalismus in Verbindung gebracht:
Der neoliberale Diskurs propagierte ein Marktsystem, in dem das Risiko vom Kollektiv auf das Individuum umverteilt wurde. Die Regierung sollte nicht mehr der Garant der Sicherheit sein. Sie wurde als ein Partner bei der Einschätzung und dem Management individueller Risiken neu definiert. In diesem ökonomischen Universum beruht der Erfolg oder Misserfolg von Personen allein auf ihrer Risikobewertung und dem Umfang ihrer persönlichen Verantwortung und Verdienste. Innerhalb dieser atomistischen Voraussetzungen und ihrer Leugnung übergreifender sozialer oder struktureller Phänomene beschränkten sich Aktionen zur Beeinflussung struktureller Veränderungen in nationalen und globalen Wirtschaften auf die Vergabe individualistischer Rezepte für lebenslanges Lernen und Umschulen. Konzepte kollektiver Aktion mit dem Ziel der Unterstützung von Gemeinschaftseigentum oder öffentlichen Gütern wurden stigmatisiert und als verlogene, mystifizierende Rhetorik, die von einer anti-amerikanischen, intellektuellen Elite verwendet wurden, in Verruf gebracht. Aufgrund ihres individualistischen Schwerpunkts ist dies eine atomistische Ideologie mit starker Affinität zur massenhaften Auslagerung von Jobs, der Steigerung der Gehälter von Firmenchefs sowie der kompletten Umschichtung des amerikanischen Klassensystems.6
Die Mittelklasse nahm, indem sie die Rolle der Regierung bei ihrem Aufstieg von sich wies, kollektiv am Abbau jener Faktoren teil, die sie vor der wirtschaftlichen und politischen Beseitigung durch die Oberschichten geschützt haben würden. Gleichzeitig ermöglichte die Überzeugung, jegliche Form der Regierungsbeteiligung sei notwendigerweise von Übel, die in den 1980er-Jahren (dem Zeitraum, in dem die Verlagerung von Arbeit in andere Länder einsetzte) beginnende Deregulierung der Aktivitäten von Unternehmen. Die Leugnung der Fähigkeit der Regierung zu regieren, ist ein Bestandteil der Ideologie der „autonomen Leistung“. Sie ist dasjenige, was die „autonome Leistung“ autonom macht. Privatisierung ist daher ein grundsätzliches Element dieser Ideologie. Sie enthält einen Glauben an die Überlegenheit der Märkte über alle anderen Werte. Der Aufstieg der Automatisierung ist seine konsequente Umsetzung als industrielles Verfahren; die Expansion zur immateriellen Produktion ist eine Folge des inhärenten Potenzials der digitalen Automation.
In einer Studie zur Privatisierung öffentlicher Kunstmuseen, der Kunstförderung und der kulturellen Institutionen in den USA und in Großbritannien merkt der Historiker Chin-Tao Wu an, dass die Steuerklassen im Zeitraum nach dem Zweiten Weltkrieg drastisch gesenkt wurden, wie aus Tabelle 1.1 hervorgeht (vgl. Seite 43). Die verstärkte Besteuerung der Mittelklassen als Ergebnis höherer Einkommensstufen war ein Faktor, der mit dazu beitrug, dass eine neoliberale, steuerfeindliche Politik bereitwillig übernommen wurde. Die steigende Zahl derer, die ein Mittelklasseeinkommen verdienten und plötzlich höhere Steuern zahlen mussten, obwohl sie es gewohnt waren, weniger Steuern zu zahlen (da sie bislang einer deutlich niedrigeren Steuerklasse angehörten), machte es möglich, die Steuern sämtlicher Einkommensstufen stetig zu senken. Auf diese Weise lässt sich das von Dennis beschriebene Aufkommen der Macht der Oberschicht und ihre Konsolidierung anhand der Besteuerung verfolgen. Wie aus Tabelle 1.2 (vgl. Seite 44)7 hervorgeht, besteht ein Zusammenhang zwischen dem Verlassen der Universität der Kinder der ersten Generation staatlich geförderter Hochschulabsolventen (d.h. der zweiten Generation von Hochschulabgängern, die 2003 zwischen 45 und 59 Jahre alt waren) und dem Beginn der Senkung der Steuersätze. Der stetige Rückgang der Steuersätze von ihrem Höchststand in den 1950er-Jahren setzte ein, als eine zunehmende Zahl von Arbeitskräften mit Hochschulausbildung besser bezahlte Positionen im mittleren Management übernahm und mehr verfügbares Einkommen hatte, weil ihre Kinder nunmehr die Universität verließen und in die Arbeitswelt eintraten. Obwohl die Besteuerung der Oberschichten nicht auf die Stufe zu Beginn des 20. Jahrhunderts gefallen ist, lässt sich erkennen, dass der Trend in diese Richtung geht. Tabelle 1.2 zeigt die vom statistischen Bundesamt der USA bereitgestellten Zahlen für die erreichten Bildungsabschlüsse. Dennis’ „Bildungs-Boom“ erreicht seinen Höhepunkt mit den Kindern der Veteranen des Zweiten Weltkrieges. (Diese Kinder wurden mehrheitlich zwischen 1949 und 1953 geboren.) Sie kamen zwischen 1967 und 1971 an die Hochschulen (wobei sie aufgrund der Freistellung für das Studium nicht für den Vietnamkrieg eingezogen wurden). Es war diese besondere Bevölkerungsgruppe, die in den 1970er-Jahren in die Berufswelt eintrat. Diese Gruppe, die als „Yuppies“8 bekannte Generation, ist diejenige, die die Ideologie der „autonomen Leistung“ weitestgehend übernahm.
Die Entwicklung in die Richtung, dass eine höhere Ausbildung Voraussetzung für eine Anstellung war, die von Dennis beobachtet wurde, ließe sich als Nebeneffekt eines „Willens zur Autonomie“ bezeichnen, den sich die Mittelklassen zu eigen gemacht hatten. Die stetige Verschiebung in Richtung niedrigerer Steuersätze beginnt 1964, genau zu dem Zeitpunkt, zu dem der steile Anstieg der Zahl der Hochschulabschlüsse einsetzt: Die 1942 geborenen Kinder treten in die Berufswelt ein. Hierbei handelte es sich hauptsächlich um die „Kriegsbabys“, die im Jahr nach der Einberufung ihres Vaters geboren wurden, während die Jahre 1949–1953 Höchstzahlen aufweisen, weil es sich hierbei um die Kinder handelt, die nach der Rückkehr des Vaters aus dem Krieg geboren wurden. Die erste Gruppe schloss 1962 oder 1963 ihr Hochschulstudium ab und trat anschließend in die Ränge der höheren Angestellten ein. Diese demografischen Zusammenhänge stimmen mit den Änderungen in der Besteuerung der Reichen und der Anhebung des Ausbildungsniveaus der Mittelschichten überein. Während die Steuersätze für die Oberschichten – den reichsten Teil der Bevölkerung der USA, der die Arbeit der anderen, sowohl die der höheren Angestellten als auch (infolgedessen) der Arbeiter, besitzt und steuert – im Laufe des 20. Jahrhunderts Schwankungen unterlagen, gibt es noch einen weiteren historischen Zusammenhang, der Aufmerksamkeit verdient: die historische Dominanz der Macht der Unternehmen über das wirtschaftliche und politische Leben und die niedrigsten Steuersätze für die reichsten Bürger. Seit Roosevelts aktiver Durchsetzung des Anti-Trust-Gesetzes von Sherman Anfang des 20. Jahrhunderts und seiner Ergänzung durch den Clayton Act von 1914 begann die Regierung der USA die wirtschaftlichen Aktivitäten der Oberschichten durch ihren Besitz großer Unternehmen indirekt zu reglementieren. Die Steuern stiegen in diesem Zeitraum stetig an. Innerhalb von vier Jahren nach der Schaffung der Bundeshandelskommission9 stieg der höchste Steuersatz von 7 % auf 77 %, was einerseits mit den im Einsatz befindlichen Streitkräften (Erster Weltkrieg) und andererseits mit der erhöhten Kontrolle und Überprüfung durch die neue Kommission zusammenhing. In den 1960er-Jahren kehrt sich die Tendenz in der Entwicklung der Steuern um. Zu einer drastischen Senkung der Steuern kam es im Zeitraum zwischen 1964 und 1988, in dem sie für die höchste Einkommensstufe von 77 % auf 33 % zurückgingen. Diese Änderung ist sowohl ein Gegenstück zum Aufkommen der „autonomen Leistung“ als wirksamer Ideologie der Mittelklasse als auch an die allmähliche Auslagerung körperlicher Arbeit in andere Länder gekoppelt, an die sich um die Jahrtausendwende die Verlagerung von Wissensarbeitern und die Informationswirtschaft unterstützender Arbeiten ins Ausland anschloss.