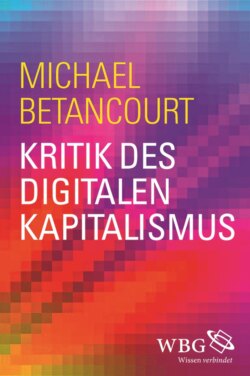Читать книгу Kritik des digitalen Kapitalismus - Michael Betancourt - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
§ 2.3
ОглавлениеDie der industriellen Revolution inhärenten Herausforderungen für die traditionellen sozialen Strukturen, die sich im Rückgang der Anforderungen in denjenigen Berufen zeigten, die durch die industrielle Produktion ersetzt wurden, hatten am Ende des 19. Jahrhunderts unter dem – über William Morris vermittelten – Einfluss von John Ruskin zur Folge, dass überall in Europa Design-Reformbewegungen auftauchten (Arts and Crafts in Großbritannien, Art Nouveau in Frankreich und Belgien sowie die Bewegungen Secession und Jugendstil in Deutschland und Österreich). Diese Bewegungen lieferten klassische Beispiele des Ressentiments – eine anti-industrielle Ästhetik der Arbeit mit den Händen.7 Das Fragment über Maschinen wurde in demselben Zeitraum verfasst und ging auf die gleichen Probleme der industriellen Produktion ein wie Ruskin; Marx’ Analyse ging aus einem ökonomischen Kontext hervor und betrachtete die Industrialisierung nicht als ästhetisches Problem.
Im Gegensatz zum Einfluss der mechanisierten Produktion auf die qualifizierten Berufe, wirkte sich die Automation anfänglich auf die intellektuelle (immaterielle) statt auf die physische (manuelle) Arbeit aus – vom 100 Jahre vor unserer Zeitrechnung hergestellten Mechanismus von Antikythera8 über die astronomische Uhr in der Altstadt von Prag aus dem Jahre 1410 bis zum Münchener Rathausglockenspiel von 1907. Der Automation und automatisierten Systemen ging es im Wesentlichen nicht um manuelle Herstellung, sondern vielmehr um die Eliminierung intellektueller Arbeit. Diese Trennung des intellektuellen Potenzials der Arbeit von ihrer Umsetzung wurde während des 19. Jahrhunderts in der Reglementierung der auf Maschinerie beschränkten, intellektuellen Aufgaben schnell offenbar. Während die Rolle der menschlichen Tätigkeit jedoch durch frühe Rechenmaschinen reduziert wurde, blieben sie im Bereich arbeitssparender Geräte. Sie führten komplexe Berechnungen von nur begrenztem Gebrauchswert durch, und ihre Produktion erforderte spezialisierte intellektuelle Arbeit: Dies sind Geräte außerhalb des Bereichs der materiellen Produktion. Marx, dem es um dieselbe Reihe von Fragen in Bezug auf mechanische Produktion wie Ruskin ging, geht nicht auf diese Geräte ein.
Die „neue Ästhetik“ taucht als Gegenstück zur Handarbeits-Ästhetik von Ruskin und Morris auf, als Parallele des „Maschinenstils“ des frühen 20. Jahrhunderts: als der modernistische Art Deco Stil, bei dem die Arbeit von Menschenhand zugunsten der glitzernden und glatten Chromoberflächen, die jetzt mit der industriellen Produktion im massenhaften Maßstab synonym waren, systematisch übergangen wurde. Diese modernistischen Designs blieben jedoch fraglos ein Ergebnis der menschlichen Tätigkeit – sowohl der intellektuellen als auch der materiellen. In der „neuen Ästhetik“ wird die Rolle der menschlichen Tätigkeit infrage gestellt: nicht nur die Notwendigkeit menschlicher Arbeit bei der Herstellung des Produkts, sondern die Unerlässlichkeit der menschlichen Tätigkeit (der Aura des Digitalen folgend) als eines produktiven und organisatorischen Prinzips. Die immaterielle Physikalität der „neuen Ästhetik“ stellt eine Konvergenz dieser maschinenbasierten, semiotischen und biologischen Produktionen dar und offenbart so einen grundsätzlichen Widerspruch, den die menschliche Tätigkeit im Verhältnis zur autonomen Produktion darstellt.
Die Unabhängigkeit von menschlicher Produktion und das Eleminieren menschlicher Tätigkeit tauchen auf, als die Aktion des Werkzeuges, das die geplante Arbeit exakt ausführt, zum Mittler zwischen dem Designer und Ingenieur und dem Endresultat wird. Die als die „neue Ästhetik“ zusammengefassten verschiedenen Artefakte sind nicht durch ihre Ausrichtung auf menschliche Beobachtung oder funktionale Nützlichkeit vereint, sondern stattdessen durch ihre Beschwörung produktiver Werte ohne menschliche Tätigkeit. Dies entspricht der Abtrennung des Produkts von allem, was zu seiner Produktion erforderlich ist, von Arbeit, Kapital und Ressourcen, durch die Aura des Digitalen. Dieser Übergang markiert eine Verschiebung von der Fragmentierung des Fließbands, an dem die Aufgaben um die immer gleichen Handlungen der massenhaften menschlichen Arbeit (die selbst eine Organisation darstellt, die eine semiotische Zerlegung und Standardisierung impliziert) organisiert sind, hin zur automatisierten Herstellung, bei der das Design auf digitalen Geräten erstellt und anschließend von anderen digitalen Geräten realisiert wird und die menschliche Arbeit keine Rolle mehr spielt. Die Notwendigkeit des Menschen-als-Designer wird so fraglich, da sie der einzige Aspekt nicht-maschineller Tätigkeit ist, der noch übrigbleibt, ein Element, das durch evolutionäre Algorithmen und automatisiertes Design herausgefordert wird.
Die neue Ästhetik wird dokumentiert durch die Verschiebung von früheren Betrachtungen der Maschinenarbeit, die sie als Erweiterung der Aktivität des Menschen verstanden – als die mechanische Verstärkung der menschlichen Arbeit –, zu ihrem Ersatz durch Modelle, in denen die Maschine den Menschen nicht mehr unterstützt, sondern ersetzt, und hierbei offenbar die menschliche Vermittlungsinstanz entfernt, die historisch zwischen der Arbeit der Entwicklungsingenieure und der zur Umsetzung ihrer Pläne erforderlichen, menschlichen Produktion liegt. Die „neue Ästhetik“ spielt in diesem Zyklus eine Rolle als ein Symptom der Umorientierung, die bereits im Gange ist, statt als ihr Ergebnis, während die menschliche Tätigkeit für diese Arten der Produktion bedeutungslos wird und die Automation ihren (der Tätigkeit) Platz im System als Ganzem verdrängt.
Die Verschiebung von immateriellen, durch Automation (Semiose) erzeugten Werten, zu durch Automation (Faktur) erzeugten materiellen Werten signalisiert eine grundsätzliche Verschiebung im Wesen der kapitalistischen Produktion, bei der menschliche Arbeit von geringerer Bedeutung ist als die Automation. Es ist diese Konvergenz, durch die die Probleme, die durch die autonome Produktion hervorgebracht werden, nachdem die Aura des Digitalen die physikalischen Erwägungen und Begrenzungen aus dem Bewusstsein entfernt hat, annulliert werden: das Aufkommen der Produktion ohne menschliche Arbeit, von Waren und Tauschwerten (materiellen und immateriellen), erzeugt ohne die Aktivität der menschlichen Tätigkeit. Die fundamentale Bedingung von Marx’ Kapitalismus (Arbeit als Ware) kehrt durch die Transformation der Arbeit in Automation und die inhärente Warennatur von Maschinen zu einer zentralen Position zurück: Die definitorische Bedingung des Kapitalismus wird wortwörtlich zur Bedingung der Produktion unter Bedingungen der Automation. In einer Autofabrik gibt es keine Rolle für Menschen. Im Gegensatz zur menschlichen Arbeit, die mit den minimalen Dimensionen der Gesellschaft (Agambens „bares Leben“) verwoben ist, ist die autonome Maschine reine Ware, Nicht-Leben. Große Teile der „Ressource Mensch“ verfallen so der Nutzlosigkeit, da ihre manuellen Funktionen in der Produktion nunmehr automatisiert sind. Für den produktiven Kapitalismus der Automation wird es überflüssig, dass sie ihre menschliche Arbeit selbst zu einer Ware machen – dies ist die Ideologie der Automation, die einem grundlegenden Gesetz folgt:
Alles, was automatisiert werden kann, wird automatisiert.
Die von Maschinen verrichtete autonome Arbeit – sei es durch automatisierte, von Algorithmen gesteuerte Prozesse (wie bei der Software für den Hochfrequenzhandel mit Aktien), durch generative Systeme oder physisch an einem Roboterfließband – ist eine Kristallisation der Arbeit-als-Ware, ohne dass die Kosten der gesellschaftlichen Reproduktion lebender Arbeit dafür anfallen. Die Automation erfordert keinen Lohn, stellt keine sozialen Forderungen an ihre Besitzer, und wenn sie aufgebraucht ist, kann sie verworfen werden, um durch neuere Technologie ersetzt zu werden.