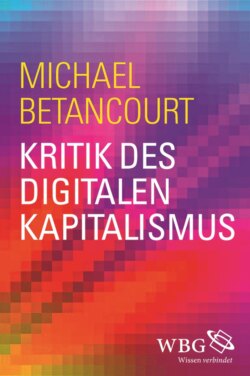Читать книгу Kritik des digitalen Kapitalismus - Michael Betancourt - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Einführung
ОглавлениеDieses Buch besteht aus einer überarbeiteten Sammlung von Aufsätzen, die – in etwa im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts – bereits in einer Reihe akademischer Zeitschriften veröffentlicht wurden. Sie haben gemeinsam, dass es in ihnen um die Ausarbeitung und Entwicklung einer Kritik des Kapitalismus geht, wie er sich durch die Erfindung digitaler Technologien verändert beziehungsweise daran angepasst hat. Insbesondere geht es um die neuen Formen der Produktion, die für die technisch möglich gewordenen, automatischen und sich selbst steuernden Systeme charakteristisch sind. Es ist eine Kritik, die mit einer materialistischen Untersuchung begann, der es darum ging, festzustellen, auf welche Weise die digitale Technologie über „magische“ Eigenschaften verfügt, die scheinbar eine Produktion ohne den Verbrauch von Ressourcen ermöglicht: Die Aura des Digitalen bot einen Einstiegspunkt für das, was zu einer Untersuchung der Bezugssysteme von Autorität, Produktion und Herrschaft anwuchs, die für die digitale Technik am Ende des 20. und zu Beginn des 21. Jahrhunderts charakteristisch sind.
Diese Aufsätze stellen – mit entsprechenden Revisionen und Ergänzungen – eine einzige zusammenhängende Kritik der Art und Weise dar, auf die die digitale Technologie die Horizonte des Möglichen dominiert. Zentral für diese Überlegung ist die durch digitale Technologie und Automatisierung ermöglichte Illusion einer Produktion ohne Konsumtion. Sie erlaubt eine Kolonisierung gesellschaftlicher Beziehungen – eine Aufwertung gesellschaftlicher Aktivität und menschlichen Verhaltens – sowie die Substitution auf materieller Herstellung basierender, produktiver Tätigkeit durch eine auf Semiose basierende immaterielle Produktion. An der Bruchlinie, die jetzt zwischen dem virtuellen Bereich des Digitalen und der Wirklichkeit des Physischen verläuft, tauchen die Ideologie der Automatisierung, die Aura des Digitalen, die Aura der Information, ein Streben nach einem Zustand umfassender Kenntnis und letztlich der digitale Kapitalismus selbst auf. Alle diese Entwicklungen haben eine gemeinsame Basis in einem grenzenlosen Immaterialismus, der abseits des Physischen besteht und ihm überlegen ist. Diese Lakune ist jedoch eine Illusion. Der Bereich des Digitalen ist nicht grenzenlos: Kapitalknappheit setzt der für den digitalen Kapitalismus charakteristischen, immateriellen Produktion Grenzen, einen Punkt der Expansion, jenseits dessen die politische Ökonomie unweigerlich zusammenbrechen muss.
Das den Medien und der digitalen Wirtschaft gemeinsame Phänomen der „Autorschaft“ ist ein Symptom dieser Kolonisierung der sozialen Beziehungen durch digitale Technik. In seinem Vollzug offenbart es ein Verlangen, ein vollständiges Bewusstsein sämtlicher Möglichkeiten der Informationsgewinnung (ein Verlangen nach dem „Zustand umfassender Kenntnis“) zu erlangen, und zwar durch eine spezifische Umwandlung bis dahin nichtkommerzieller Aktivitäten, die zu einer kommerziellen Handlung führen könnten (wie etwa das Stöbern in einem Geschäft), in wirtschaftliche Güter an sich. Es ist eine dramatische Veränderung, die eine ständige Kontrolle und einen perfekten Abruf von Daten zu einer neuen, immateriellen Ware zusammenfasst, die sich als Überwachung realisiert – die totalisierende Beschreibung menschlicher Aktivität. Diese Umwandlung von Aktivität in eine Ware hängt von der semiotischen, rekombinativen Kraft der digitalen Technologie ab. Die immaterielle Produktion ist für den digitalen Kapitalismus charakteristisch und präsentiert sich (auf ebenso charakteristische Weise) als etwas anderes denn eine Warenform: als Auswirkung der Aura der Information. Dieses Bestreben ist der Versuch des digitalen Kapitalismus, eine vollständige Beschreibung sämtlicher Informationen als Instrumentalität (Daten) zu erzeugen, in der die zerstreuten, kontextlosen Dimensionen sämtlicher in der digitalen Welt ausgeführter Aktivitäten zu auf gleiche Weise gültigen, wertvollen Waren für die immaterielle Produktion werden. Dieses „Material“ (Daten) ist der in sozialen Netzwerken enthaltene „Wert“ und der Grund dafür, dass diese Unternehmen als wertvoll angesehen werden, obwohl sie kein Einkommen erzeugen.
Immaterielle Waren ermöglichen über die digitale Aura den selbstwidersprüchlichen Anspruch einer manifesten Immaterialität – dass der Zustand des Informationsbesitzes in direkter, greifbarer Form realisiert wird – über eine digitale Instrumentalität. Der gegenwärtige Einsatz von digitalen Rechnern zur Sammlung, Speicherung und Verarbeitung von Informationen zwingt dazu, eine neue Erkenntnistheorie in Erwägung zu ziehen, die – durch Reifikation – als die Aura der Information Wirkungsmacht entfaltet. Sie ist den ineinandergreifenden Bedingungen, die den digitalen Kapitalismus ausmachen, wesensmäßig inhärent. Indem es das kapitalistische, gewinnsüchtige Verlangen nach ständigem Wachstum verkörpert, während es gleichzeitig ein imaginäres Ende des „Mangels“ ist, offenbart es einen utopischen Impuls, in dem die Aura des Digitalen als Beweis für eine immaterielle Ordnung steht, und sowohl den Triumph als auch die Auflösung des Kapitalismus selbst suggeriert. Diese Dualitäten sind paradox; als zentraler Teil seiner expansiven Entwicklung tauchen im digitalen Kapitalismus widersprüchliche Impulse auf: den allgemeinen Einsatz immaterieller, semiotischer Produktion als primärer Methode der Erzeugung von Reichtum zu verlangen und anschließend zu rechtfertigen.
Die Grundlagen der Aura der Information liegen, wie die digitale Aura, im Wesen der Computertechnologie selbst. Entscheidend für ihre Funktion ist die Fragmentierung der kontinuierlichen, physikalischen Welt in diskrete Datenblöcke – Exemplare –, deren Speicherung, Bearbeitung und Neukombination einem semiotischen Verfahren folgt, das von Regeln geleitet wird, die den Digitalrechner auf eine streng instrumentalistische Funktion einschränken, die von der Bedeutung und/oder dem historischen Kontext der Materialien, auf die zugegriffen wird beziehungsweise die sortiert und kombiniert werden, getrennt ist. Diese Verdinglichung wandelt die digitale Technologie in die Verkörperung eines immateriellen Bereichs um, in dem Produktion in einem Verfahren der Rekombination besteht – wobei es sich im Wesentlichen um eine semiotische Funktion handelt –, die ein immaterielles „Produkt“ schafft.
Die technischen Möglichkeiten dieser Computertechnologie verdecken den Zusammenhang von Kapital, menschlicher Aktivität, sozialer Reproduktion und physischer Produktion. Auf solche Weise ist die Leugnung der Physikalität, die für die Aura des Digitalen spezifisch und in der Evolution von der Handarbeit zu der für den „digitalen Kapitalismus“1 charakteristischen Automatisierung offensichtlich ist, wesentlich damit verbunden, wie diese Technologie eingesetzt worden ist. Die „protestantische Arbeitsmoral“ ist der begriffliche Ausgangspunkt für diese Entwicklung: Sie bringt die „Ideologie der autonomen Leistung“ mit der digitalen Technologie zusammen, um eine neue „Ideologie der Automatisierung“ zu schaffen. Sie kommt im sozialen Bereich durch die Fantasie der Autonomie – des „selbstgemachten Mannes“ – zum Vorschein, unabhängig von der sozialen Reproduktion, die ihren Erfolg und ihr Überleben ermöglichen. Diese imaginäre Autonomie unterschlägt die menschliche Arbeit als Teil der Produktion, indem sie die menschliche Tätigkeit in der Ökonomie digitaler Information scheinbar obsolet macht und die Aufwertung des sozialen Verhaltens autorisiert. Das aktive Prinzip für diese Transformationen ist die „Aura des Digitalen“, die die kapitalistische Ideologie verdinglicht, indem sie die Rolle und die Bedeutung einer zugrunde liegenden physischen Wirklichkeit verdeckt. An ihre Stelle tritt die zerstörerische Fantasie, dass die Digitalität einen neuen, magischen Bereich jenseits physischer Einschränkungen eröffnet hat, in dem die Dualität von Produktion und Konsum aufgelöst wird, um ein grenzenloses Wachstum – einen ständigen Zuwachs von Vermögen – über die Grenzen von Produktion, Materialität und Arbeit hinaus zu erlauben.
Aufgrund der stetigen Entwicklung und Ausweitung der digitalen Technologie im Laufe des 20. Jahrhunderts hat die Aufzeichnung exemplarischer Daten eine zentrale, sogar dominante Position erlangt, sowohl kulturell als auch technologisch. Sampling ist für die digitale Technologie ebenso notwendig wie für einen Zelluloidfilm – was es zur fundamentalen Technik der auf Medien gestützten Gegenwartskulturen macht. Sie ist jedoch in einem viel älteren historischen, als „Katzenorgel“ bezeichneten Apparat (der auch unter der spanischen Bezeichnung „katzenkavalier“, der deutschen „Katzenklavier“ oder als „cat piano“ bekannt ist) bereits deutlich sichtbar. Dieses Musikinstrument wird in dem Buch Juan Christóbal Calvetes von 1552 beschrieben, das eine Chronik der Europareisen von König Philipp II von Spanien enthält.2
Eine Betrachtung dieses frühen Beispiels semiotischer Rekombination erlaubt Einsichten in ethische Gegenwartsfragen, die man an den digitalen Kapitalismus richten könnte. Die Funktionsweise der Katzenorgel wurde von dem französischen Schriftsteller und Kritiker Jean-Baptiste Weckerlin 1877 in seinem Buch Musiciana, extraits d’ouvrages rare ou bizarre (Musiciana, Exzerpte aus seltenen oder bizarren Büchern) zusammengefasst:
Als der König von Spanien, Philipp II, 1549 in Brüssel war und seinen Vater Kaiser Karl V besuchte, sah einer den anderen sich an einem vollkommen einzigartigen Umzug ergötzen. Angeführt wurde er von einem riesigen Bullen, zwischen dessen Hörnern ein kleiner Teufel saß, der mit Feuer jonglierte. Vor dem Bullen paradierte ein kleiner Junge, der in ein Bärenfell eingenäht war und auf einem Pferd ritt, dem man die Ohren und den Schwanz abgeschnitten hatte. Daran schloss sich in heller Kleidung der Erzengel Michael an. In seiner Hand trug er eine Waage.
Der merkwürdigste Teil war ein Karren, auf dem das einzigartigste Musikinstrument transportiert wurde, das man sich vorstellen kann. Darauf befand sich ein Orgel spielender Bär: statt aus Pfeifen bestand sie aus etwa zwanzig Kästen, in deren jedem sich eine Katze befand, deren Schwanz unten heraushing und über eine Schnur mit der Tastatur verbunden war. Drückte man eine der Tasten, wurde der jeweilige Schwanz so kräftig gezogen, dass hieraus ein Mitleid erregendes Miauen resultierte. Der Historiker Juan Christoval Calvète merkte hierzu an, die Katzen seien in einer solchen Reihenfolge angeordnet gewesen, dass die Tonfolge einer Oktave zustande kam … (chromatisch, glaube ich).
Dieses abscheuliche Orchester stellte sich im Inneren eines Theaters auf, in dem Affen, Wölfe, Rehe und andere Tiere zu den Klängen dieser infernalischen Musik tanzten.3
Katzenfreunde würden sich wohl wünschen, die Katzenorgel sei ein fiktives Gräuel, ganz wie Arthur Ewings „Mausorgel“ in Monty Pythons Flying Circus.4 Sie produziert Katzenmusik durch das Quälen lebender Tiere als Produktionsmittel, indem sie diese bei Bedarf miauen lässt: ein „Schreikonzert“, das nicht nur aus den Schreien der Katzen, sondern aus noch mehr besteht – einer Form von Musik, die aus den von dem Apparat kontrollierten, distinkten Stimmen semiotisch zusammengefügt wird. Wie Weckerlins Beschreibung des Umzugs zeigt, erfüllt die Katzenorgel ihre Funktion auf symbolische Weise, basierend auf der Assoziation von Katzen mit Teufeln und einer immateriellen, übernatürlichen Ordnung, in der zueinander im Gegensatz stehende Tiere in einem friedlichen Königreich zusammenkommen: dem Vorboten eines immateriellen Bereichs.5
Die Katzenorgel bringt eine magische Umwandlung tierischer Geräusche in eine harmonische Ordnung zustande; und der Umzug verwandelt eine immaterialistische Theorie in ein Schauspiel. Er ist eine Demonstration von „göttlicher Macht und eines universellen Plans“ und zwingt auf diese Weise immaterielle Kräfte in eine immanente Gegenwart, dargestellt durch technische Instrumente: Der Erzengel Michael setzt eine himmlische Ordnung durch, die dämonische Kräfte vor sich hertreibt. Die Inszenierung dieser Ordnung verlangt eine systematische Leugnung der realen Physikalität ihrer Mittel: der im Katzenklavier eingepferchten, lebenden Tiere. Die von der Katzenorgel inszenierte, spezifische Unterordnung wird zugleich aus dem Bewusstsein verdrängt. Sie ist eine frühe Form derselben Blindheit, die die Aura des Digitalen darstellt, indem sie den Aspekt des Körperlichen aus der Betrachtung ausschließt. Die Trennung der Quelle (der materiellen Basis) von der Bedeutung spiegelt die Wirksamkeit eines semiotischen Prozesses wider.
Für Weckerlin und seine zeitgenössischen Leserkreise liegt der Schrecken dieser Apparatur in der Tatsache, dass einzelne Tiere für sie nur von Bedeutung sind, sofern sie für die spezifische Tonhöhe stehen, die sie produzieren – de facto sind es lebende Exemplare abstrakter musikalischer Töne. Diese Übertragung ist für das Verständnis der Relevanz des Apparats für die gegenwärtige Technologie von Bedeutung: Die Katzenorgel findet ihre Entsprechung in der Software-Anwendung AutoTune, mit der eine beliebige Stimme so angepasst werden kann, dass sie eine perfekte Lage hat, was einer Transsubstantiation gewöhnlicher Stimmen in reine Musikalität gleichkommt. Indem lebende Katzen so angeordnet werden, dass die Klangfarbe ihrer Stimmen zugleich zu den verschiedenen Tonhöhen einer musikalischen Komposition werden, verkörpert die Katzenorgel implizit ein Verständnis der physischen Wirklichkeit, das dem gegenwärtigen digitalen „Abtasten der Wirklichkeit“ und der digitalen Fragmentierung analog ist. Sie spiegelt eine spezifisch digitale Konzeption von Physikalität wider: Das operative Vorgehen ist semiotisch, die Ergebnisse hängen von der Neuanordnung einer Reihe exemplarischer Daten ab. Das Katzenklavier ist demnach ein früher Vorschein der digitalen Technologie, sowohl konzeptionell als auch bezüglich seiner Vorgehensweise: die Aufzeichnung exemplarischer Daten durch die Fragmentierung der physischen Realität in diskrete Pakete (die einzelnen Katzen) für ihre semiotische Zusammenfügung und Veränderung zu einem neuen Produkt: (Katzen-)Musik, eine immaterielle Form, deren Existenz nur durch einen mechanischen Apparat realisiert wird, der zu Aufführungszwecken quält, wobei diese Qual die semiotische Umwandlung des Miauens einer Katze in eine abstrakte musikalische Form zustande bringt.
Die Katzenorgel taucht (mehr oder weniger buchstäblich) in den 1990er-Jahren wieder auf: in Form von zwei Weihnachtsalben, die von der Gruppe Jingle Cats herausgebracht wurden. Sie waren eine beliebte Sensation. Ihr erstes Album, Meowy Christmas, wurde Weihnachten 1993 vollkommen ausverkauft. Ihm folgte 1994 Here Comes Santa Claws: Beide Alben enthalten Musik, die aus dem innerhalb einer Tonart „gesungenen“ Miauen von Katzen besteht. Wie auf der Webseite von Jingle Cats betont wird6 – in einer bestürzenden Wiedergabe der Grundlage der ursprünglichen Katzenorgel –, wurden zur Produktion der Musik echte Katzen verwendet. Diese Transformation-ohne-Qual wurde durch die digitale Synthesizer-Technologie möglich, durch die Beispiele echten Miauens von Katzen aufgenommen und dann so angepasst werden konnten, dass sie sich in der korrekten Tonhöhe befanden, wodurch echte Katzen in der Vorstellung eingesetzt werden konnten. Diese Alben nähern sich dem in der Katzenorgel eingebauten semiotischen Verfahren. Beide sind symptomatisch für die Möglichkeit, mithilfe der digitalen Technologie eine kontinuierliche physikalische Wirklichkeit zu fragmentieren und von ihrem Ursprung abzulösen. Diese Zerlegung in Teilelemente erlaubt ihre Zusammensetzung in eine neue Form – die von Daten. Semiose schafft Möglichkeiten und läuft autonom ab, ohne Rücksicht auf den physischen Aspekt des in digitale Form übersetzten Materials zu nehmen.
Selbst in der historischen Katzenorgel ist die Idee der „Aura des Digitalen“ offensichtlich. Diese in der Katzenorgel so deutlich sichtbaren, neutralen Gesetze sind auch kybernetische (maschinenhafte) Gesetze, welche das Lebende dem Nichtlebenden einverleiben: Katzen den Instrumenten ihrer in einer Folter bestehenden Vorführung. Diese kybernetische Dimension ist eine Entsprechung zur digitalen Übertragung der menschlichen Handlungsmacht auf den automatisierten und digitalen Computer beziehungsweise zu ihrer Unterwerfung unter ihn, in dem besondere menschliche Interessen zu Daten in der Rekonfiguration des sozialen Raumes werden, um die immaterielle Aufwertung des digitalen Kapitalismus widerzuspiegeln.
Im gegenwärtigen digitalen Kapitalismus isoliert dieser Prozess Belange der immanenten Physikalität (und der höchst realen Einschränkungen der physikalischen Welt) aus dem Bewusstsein und ersetzt sie durch einen illusionären Überfluss – durch die Vorstellung, die digitale Technologie „beseitige den Mangel“, und zwar durch den rein semiotischen Vorgang der digitalen Replikation (unintelligente, autonome Transfer- und Reproduktionsgesetze). Es ist diese scheinbare „Wahrheit“, dass sämtliche digitalen Kopien gleich gut sind, die die Beeinflussungen und die Auswirkungen der Aura des Digitalen unterstützt. Bei der Betrachtung der digitalen Aura treten sogleich mehrere Charakteristika in den Blick: die praktische Unsterblichkeit digitaler Medien, ihr Potenzial der endlosen, perfekten Replikation sowie die Arten, auf die das Immaterielle immer bereits durch die Knappheit des Kapitals begrenzt ist. Die moralische Dimension, die durch den Vorgang der Aufzeichnung exemplarischer Daten entsteht, ergibt sich aus dem besonderen Vorgehen der digitalen Technik (gemäß ihrem unintelligenten Wesen), Mittel und Bedeutung voneinander zu trennen.
Es ist der begrenzende Faktor, der durch die Knappheit des Kapitals erzwungen wird, der eine Kritik der politischen Ökonomie nicht lediglich zu einem potenziellen Aspekt von Untersuchungen der digitalen Technologie macht: Er ist auch eine Erklärung für die verschiedenen wirtschaftlichen Krisen, die sich in den USA und anderswo ereignet haben. Er stellt die Auffassung, dass „diese Zeit anders ist“ durch ein beständiges Zurückkommen auf die dis- und zugleich assoziative Methode der Produktion infrage: die Semiose, durch die eine fragmentierte Quelle für einen Zweck rekonfiguriert wird, der von ihrer materiellen Basis unabhängig ist. Menschliches Leben, Handeln und soziale Reproduktion sind nicht länger wesentliche Faktoren für die Beziehung von Produktion und Konsum, sondern werden zu Waren. Es ist dieses Problem – das durch den Immaterialismus gestellte, ethische Dilemma –, welches jeder dieser Essays verfolgt: Ein jeder konzentriert sich auf einen einzelnen begrifflichen Aspekt und untersucht ihn im Detail. Im Zuge dieser Untersuchungen werden diskrete Bereiche identifiziert, die als Hinweise auf die Kolonisation – als verkörperte kapitalistische Ideologie – von ehemals sozialen Aktivitäten durch die digitale Technologie dienen, als neue Formen der wirtschaftlichen Produktion. Gleichzeitig gewähren sie einen flüchtigen Einblick in einen digitalen Kapitalismus, der von der physischen Produktion und Konsumtion physischen Materials, von Arbeit und Kapital, abgeschnitten ist. Es ist diese scheinbare (und illusionäre) Produktion ex nihilo mithilfe von Technologien der Überwachung und automatisierter Semiose (wofür die Finanzialisierung mit Algorithmen für den Hochfrequenzaktienhandel das offensichtlichste Beispiel ist), die zur Definition der gegenwärtigen politischen Ökonomie geworden ist, in der die soziale Reproduktion der Arbeit den Kapitalismus nichts angeht.
Folter ist die Grundlage der Katzenorgel: Sie ist symptomatisch für die Dis- und Assoziation, die für die Aura des Digitalen typisch ist. Sich nicht um die physischen Konsequenzen zu sorgen, die durch die Verschiebung zum Immaterialismus geleugnet werden, bedeutet, die Möglichkeit von Missbräuchen dieses physischen Bereichs zu schaffen. Der Vorgang der Gewinnung exemplarischer Töne in der Katzenorgel – in dem die Tiere für ihre Bedeutung und ihren Zweck bedeutungslos werden, jedoch wesentlich für die ihr eigene Form – ist im Grundverfahren der digitalen Technologie wesentlich enthalten und spiegelt die gleiche Verdrängung der Physikalität aus der bewussten Aufmerksamkeit wider, in der die Aura des Digitalen wesensmäßig besteht. Diese Entwicklung ist eine ideologische Kraft, die in der sozialpolitischen Ökonomie der USA wirksam ist. Sie steuert die Implementierung sogenannter sozialer Medien und automatischer Produktion.
Die Transformation der sozialen Aktivität in eine Ware geht aus der Illusion hervor, dass die digitale Produktion Wert ohne Aufwand erzeugt – der Illusion der Produktion von Kapital ohne seine notwendige Konsumtion. Sie ist das Symptom der Struktur einer pathologischen, kapitalistischen Ideologie, die in der Fantasie digitaler Technologie realisiert wird. Gleichzeitig bedroht diese Aura des Digitalen den Status quo, da die Illusion von Profit ohne Aufwand die Möglichkeit nahelegt, die digitale Technologie könnte ein Ende des Kapitalismus selbst herbeiführen (bei Ignorierung der Realität begrenzter Ressourcen, Zeit, Kosten etc., die ansonsten jegliche Formen von Wert und Produktion beherrschen). Es ist dieser zweite Aspekt der digitalen Technologie, der ein utopisches Potenzial darstellt – das Überschreiten der durch die physische Realität gesetzten Grenzen.
Im semiotischen Prozess der Isolation, Fragmentierung und Reorganisation, der die technische Basis der digitalen Technologie darstellt, stößt man auf materielle Grenzen. Die immaterialistische Grundlage ist das explosionsartige Auftauchen einer Art von Technik, deren Grundlagen semiotisch sind. Durch die Fähigkeit der digitalen Technologie, die Realität zu fragmentieren und dabei nach eigenen Gesetzen vorzugehen, wird die kontinuierliche physische Wirklichkeit in diskrete Pakete relevanter Daten aufgesplittert, wodurch es ihr möglich wird, gegenüber dem, was sie übermittelt, neutral zu sein: Es besteht kein Interesse an der Physikalität des Materials, das in digitale Form übersetzt wird. Daher entspricht die Folter, die die Grundlage des technischen Apparats der Katzenorgel darstellt, wesensmäßig dem Verfahren der Erhebung exemplarischer Daten in der digitalen Technik, und sie spiegelt das gleiche Verdrängen der Physikalität aus der bewussten Aufmerksamkeit wider, das für die Aura des Digitalen wesentlich ist. Der durch die Erhebung exemplarischer Daten dargestellte Terror (offenbart durch das Katzenklavier) taucht in den Horrorfantasien von Science Fiction und in Form von künstlicher Intelligenz des Roboters, der intelligenten Maschine oder des Cyborgs auf, dem es um die Versklavung und Zerstörung der Menschheit geht.
Die Tatsache, dass es bezüglich der Verwendung isolierter exemplarischer Daten – der notwendigen Basis der digitalen Semiose – in diesem teuflischen, historischen Apparat moralische Bedenken gibt, schließt mit ein, dass sich eine ähnliche moralische Dimension und Kritik auch für die Verdrängung der Physikalität aus dem Bewusstsein, die durch die Aura des Digitalen erfolgt, ergeben könnte. Diese ethischen Fragen stellen sich allerdings nicht im Kontext der Manipulation von Tierstimmenexemplaren, sondern angesichts der Folgen der „Immobilienblase“ von 2008, wo die durch die Erhebung exemplarischer Daten gewonnenen und manipulierten Materialien (verbriefte Schulden) weniger greifbar und in Form enteigneter Menschen zugleich konkret sichtbar waren. Die in der digitalen Technologie verkörperte Ideologie suggeriert, dass die Finanzialisierung und der ökonomische Zusammenbruch der Dotcom-Blase, der Immobilienblase etc. nicht nur unvermeidbar waren, sondern eine strukturelle Folge des Übergangs zur immateriellen Produktion und der menschliche Kollateralschaden ein Zeichen für seine produktive Funktion. Diese ökonomischen Turbulenzen sind ein direkter Beweis für die Folgen der immateriellen Produktion durch die digitale Manipulation des Geldwesens als eines semiotischen Systems. Die Ursprünge dieses sozialen Dilemmas zu verstehen, ist das diese Untersuchung motivierende Ziel.