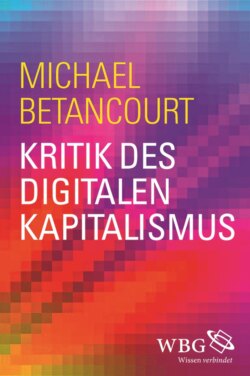Читать книгу Kritik des digitalen Kapitalismus - Michael Betancourt - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vorwort des Übersetzers
ОглавлениеAls Philipp II, der damals König von Spanien war, im Jahr 1549 seinen Vater Kaiser Karl V in Brüssel besuchte, verfolgten die beiden einen seltsamen Umzug, dessen merkwürdigster Teil ein Katzenklavier war, das von einem Bären gespielt wurde. In dieses Instrument waren Katzen eingepfercht, die durch das Drücken einer seiner Tasten zum Miauen gebracht wurden. Die Tiere waren in einer solchen Reihenfolge angeordnet, dass sich als Tonfolge eine Oktave ergab. Diese von Betancourt in der Einleitung zu seinem Buch angeführte Begebenheit analysiert er auf folgende Weise.
Für den Aufbau des Katzenklaviers ist die Leugnung der realen Wirklichkeit der lebenden Tiere wesentlich. Die einzelnen Katzen werden auf den Ton reduziert, den sie jeweils erzeugen. Gemeinsam werden sie zu einem neuen Produkt zusammengefügt, einer durch das Instrument realisierten Katzenmusik. Das Miauen der Katzen wird in eine abstrakte musikalische Form gebracht, während die leidenden Tiere aus dem Bewusstsein verdrängt werden. Das Katzenklavier ist für Betancourt in mehrfacher Hinsicht ein Vorschein der digitalen Technologie, denn in der Struktur dieses Instruments werden zentrale Aspekte dessen vorweggenommen, was er als digitalen Kapitalismus bezeichnet: (1) die Erhebung isolierter exemplarischer Daten, (2) die Fragmentierung der physischen Wirklichkeit in diskrete Teile sowie die (3) Rekombination der Töne zu einem neuen Produkt. Bevor diesem Vergleich weiter nachgegangen wird, soll die Thematik dieses Buches zunächst in ihren weiteren Kontext eingeordnet werden.
Die digitale Technologie hat, vor allem in Gestalt des Internets, in den letzten 30 Jahren die Welt revolutioniert. Sie bietet ungeahnte Möglichkeiten, birgt aber auch neue Gefahren. Es gibt keinen Bereich, der hiervon unberührt geblieben wäre, nicht einmal die Diplomatie: twitternde Präsidenten sind ein Novum, das für Unterhaltung – und zeitweilig auch für Bestürzung – sorgt. Charakteristisch für die in den letzten Jahrzehnten erfolgten Veränderungen ist besonders der Grad der durch die digitale Technologie möglich gewordenen Automatisierung. Durch den Einsatz von Computern hat sie vorher nicht vorstellbare Stufen erreicht, zum Beispiel in Form von Montagerobotern. Von digitalen Systemen gesteuerte Produktionsroboter haben in manchen Bereichen die menschliche Arbeit auf ein Minimum reduziert, in anderen vollständig eliminiert.
Dies kann dazu führen, dass nicht nur die manuelle Arbeit des Menschen, sondern auch seine intellektuelle Arbeit obsolet wird. Dies ist zum Beispiel durch Software für den Hochfrequenzhandel mit Aktien, die menschliche Entscheidungsprozesse für den Handel mit Aktien und Rohstoffen auf den Finanzmärkten übernimmt, bereits geschehen. Auf einem Markt, auf dem in Mikrosekunden ermittelte Preisschwankungen über den Unterschied zwischen Gewinn und Verlust entscheiden, können nur noch Maschinen mit einer entsprechend schnellen Reaktionszeit miteinander konkurrieren. War es früher noch möglich, die Arbeit von Maschinen als Erweiterung der Aktivität des Menschen zu verstehen, gibt es mittlerweile längst zahlreiche Fälle, in denen die Maschine den Menschen nicht mehr unterstützt, sondern ersetzt.
Der digitale Kapitalismus ist ein globales Phänomen: durch globale, digitale Datennetze, die eine Kontrolle aus der Ferne ermöglichen, ist es Unternehmen möglich geworden, bestimmte Arbeiten in Länder mit geringem Lohnniveau auszulagern. Ein Beispiel hierfür ist die die Programmierung von Software, ein weiteres sind Call Center zur Kundenbetreuung.
Durch den Siegeszug des Computers wurden sämtliche Lebensbereiche grundlegend verändert, darunter natürlich auch die Produktion und der Verkauf von Waren. Doch der Kapitalismus hat durch das Aufkommen digitaler Technik eine Wandlung erfahren, die über die bloße Erleichterung und Beschleunigung bereits vorhandener Abläufe hinausgeht. Es ist eine neue Ware entstanden: Informationen über das Verhalten der Menschen, insbesondere ihr Kaufverhalten. Dies ist es, was Betancourt in seinem Buch als „Kolonialisierung der gesellschaftlichen Beziehungen“ bezeichnet: Einkaufsverhalten wird selbst zu einer Ware. Wer weiß, wofür ich mich interessiere und was ich kaufe, kann mir gezielt Produkte anbieten. Diese Information ist ein Beispiel für einen immateriellen Vermögenswert, der durch die digitale Technologie möglich geworden ist, denn diese erlaubt das Abspeichern und Analysieren riesiger Datenmengen. Diese Entwicklung stützt Betancourts These, dass im digitalen Kapitalismus virtualisierte, digital produzierte Werte die materielle Warenform sowie immaterielle Arbeit die physische Produktion zunehmend ersetzen.
Durch die digitale Technologie ist ein Bereich entstanden, in dem die in einem Produkt präsente Bedeutung von ihrer physischen Darstellungsform getrennt zu sein scheint. Dies beruht auf der Eigentümlichkeit der Beziehung zwischen einer digitalen „Kopie“ und ihrem „Original“: beide sind identisch. Sie sind nicht nur äquivalent, sondern dasselbe. Sofern sie auf der Realisierung eines Codes basieren, unterliegen sie, wenn sie kopiert, verwendet oder reproduziert werden, keiner Abnutzung. Hierdurch ist es möglich, ein digitales Werk zu verkaufen und zugleich weiter zu besitzen. Wenn man ein Computerprogramm kauft, erwirbt man daher lediglich ein Recht auf seine Nutzung. Man kauft also kein Produkt, sondern eine Lizenz. Das Produkt wird nicht konsumiert, sondern nur genutzt. Diese Tatsache leistet nach Betancourt zwei Phänomenen Vorschub: (1) einer Akkumulation von Wert ohne Produktion sowie (2) einer Produktion ohne Konsumtion, die nach ihm für den digitalen Kapitalismus symptomatisch sind. Aus ihnen erwächst die Illusion eines grenzenlosen Bereichs, in dem scheinbar ohne Aufwand Wert erzeugt werden kann, verbunden mit einer Leugnung materieller Kosten und der Begrenztheit von Ressourcen.
Ein Paradebeispiel für die von Betancourt analysierte Verwandlung des Kapitalismus in seine digitale Form, d.h. zum Vorrang der immateriellen Produktion vor der materiellen Herstellung, ist die virtuelle Währung Bitcoin. Bitcoin und andere kryptographische Währungen wurden als elektronisches Gegenstück zu Bargeld konzipiert. Sie werden dadurch erworben (oder „geschürft“, wie man sagt), dass man unter hohem Rechenaufwand mathematische Aufgaben löst, was mit der Überprüfung früherer Bitcoin-Transaktionen eng verbunden ist. Ähnlich wie auf Waren basierende Währungen versucht haben, Arbeit in einer tauschbaren Form zu bewahren, stellt dies den Versuch dar, immaterielle Arbeit in einer digitalen Form zu bewahren. Bitcoins scheinen von der physischen Wirklichkeit völlig getrennt, ohne jegliches materielle Gegenstück zu existieren. Für ihren Besitz muss man über E-Wallets, elektronische Brieftaschen, verfügen. Doch die Existenz dieser und anderer virtueller, krytographischer Währungen, die von der Funktion unzähliger, weltweit verteilter Computer abhängt, verschlingt ungeheure Energiemengen. Anders als die scheinbare Ablösung der immateriellen Produktion von materiellen Gegebenheiten suggeriert, kann von einer Unabhängigkeit von konkreten physischen Zwängen folglich nicht die Rede sein. Dieser Immaterialismus ist eine Illusion, die nach Betancourt für den digitalen Kapitalismus insgesamt allerdings charakteristisch ist.
Kehren wir zurück zur eingangs angeführten Behauptung Betancourts, dass im beschriebenen Katzenklavier wesentliche Aspekte des digitalen Kapitalismus präfiguriert sind. Er führt im neunten Kapitel seines Buches ein bekanntes Fallbeispiel an, anhand dessen sich die behauptete Parallele weiter verdeutlichen lässt: das Platzen der Immobilienblase in den USA im Jahr 2008.
Diese Immobilienblase war entstanden, weil man mit Vermögenswerten gehandelt hatte, die auf Hypothekenschulden basierten. Dabei schenkte man der Wirklichkeit der zugrunde liegenden, materiellen Werte und der Arbeit, die nötig war, um jene Schulden zu bezahlen, keinerlei Beachtung. Die Bedeutung der materiellen Vermögenswerte wurde völlig übersehen oder sogar geleugnet. Durch die Manipulation von auf Hypotheken basierenden Wertpapieren wurden neue Werte erzeugt, nur nebenbei auch durch den Verkauf von realen Immobilien. Diesen kam nur insofern eine Bedeutung zu, als durch sie finanzielle Verbindlichkeiten geschaffen werden konnten, damit diese Schulden dann zum Weiterverkauf auf Derivatenmärkten in Wertpapiere übertragbar waren. Als sich im Jahr 2008 die Rückzahlungen der Hypothekenschulden aufgrund variabler Zinssätze so sehr erhöhten, dass die Hypothekennehmer sie nicht mehr aufbringen konnten, platzte die Immobilienblase. Als Ergebnis einer den Gesamtzusammenhang der ökonomischen Wirklichkeit fragmentierenden Betrachtung, die ausschließlich an isolierten exemplarischen Einzelaspekten interessiert ist, waren die zu abgeleiteten Vermögenswerten rekombinierten ursprünglichen Hypotheken und die Menschen, die sie aufgenommen hatten, im Vergleich zum Handel mit den abgeleiteten Wertpapieren aus dem Blick geraten. Sie waren verdeckt und übersehen, wie die im Katzenklavier eingepferchten Katzen aus dem Bewusstsein verdrängt. (In diesem Zusammenhang weist Betancourt auch darauf hin, dass nach dem ökonomischen Zusammenbruch im Zentrum der staatlichen Hilfsprogramme nicht etwa die Hypotheken mit Zahlungsverzug, sondern die aus ihnen abgeleiteten virtuellen Investitionspapiere standen.)
Eine Bedingung dafür, dass der digitale Kapitalismus und die für ihn typischen immateriellen Vermögenswerte entstehen konnten, war die Einführung einer Fiat-Währung, d.h. die Abtrennung der Währung von einem materiellen Vermögenswert. Bei einer Fiat-Währung handelt es sich um eine Währung, die nicht mehr durch Goldreserven garantiert ist, wie dies vor der Einführung dieser Währungsform üblich war. Die Menge der sich in Umlauf befindenden Währung kann so exponentiell erhöht werden, da sie von den Einschränkungen durch eine materielle Warenbasis befreit ist. Da es keine materielle Warenform gibt, deren materielle Einschränkung den Wert begrenzt, kann sie trotzdem scheinbar ihren Wert behalten. Der einzige in der Währung als ihr Tauschwert verdinglichte Wert, d.h. ihre gesellschaftliche Basis als Währung, ist ihre Anerkennung als universales Äquivalent. Diese Virtualisierung ist charakteristisch für eine Wandlung von einem Tauschsystem, das auf physischer Arbeit und Produktion beruht, zu einem solchen, das immer stärker auf immateriellen Werten basiert.
Auch der digitale Kapitalismus funktioniert durch die Zusicherung zukünftiger Renditen auf investiertes Kapital. Dieses Versprechen ist jedoch nicht mehr einlösbar, wenn die geschuldete Arbeit die Summe der möglichen materiellen, automatisierten und immateriellen Produktion übersteigt, wie dies nach Betancourt im digitalen Kapitalismus der Fall ist: Da es immer eine größere offene Schuld gibt, als Geld zu ihrer Abzahlung vorhanden ist, zeichnet sich der digitale Kapitalismus durch eine ständige Knappheit von Kapital aus. Wenn Betancourts Analyse zutrifft, sind daher weitere Finanzkrisen unvermeidbar.
Es würde die dem Umfang eines Vorworts gesetzte Grenze überschritten haben, wenn ich hier versucht hätte, eine vollständige Übersicht über die zahlreichen in diesem Buch behandelten Themen zu geben. Stattdessen habe ich seinen Kerngedanken vorgestellt: dass die von der „Aura des Digitalen“ suggerierte Immaterialität eine Illusion darstellt und dass sich die durch die physische Realität gesetzten Grenzen auf Dauer nicht überschreiten lassen. Nach Betancourt ist es die Vorherrschaft dieser immateriellen Ideologie, nicht eine reale Trennung von materiellen Bedingungen, die den digitalen Kapitalismus hervorbringt.
Im Zentrum der Untersuchungen der 10 Kapitel dieses Buches, die ursprünglich als eigenständige Aufsätze verfasst wurden, steht – auch wenn sie sich streckenweise davon zu entfernen scheinen – letztlich immer wieder dieselbe Frage: Wie hat das Aufkommen der digitalen Technik den Kapitalismus und damit auch das Leben unter seinen Bedingungen verändert? In den verschiedenen Kapiteln setzt sich Betancourt immer wieder mit andere Autoren (Foucault, Derrida, Wittgenstein und natürlich Marx, um nur die bekanntesten zu nennen) auseinander bzw. nimmt auf sie Bezug. Seine Auseinandersetzung mit diesen Autoren ist eine lohnende Lektüre und bereichert durch wertvolle Einsichten.
Um abschließend zum Vergleich des digitalen Kapitalismus mit dem zu Beginn beschriebenen makabren Umzug zurückzukehren: Das Spektakel des digitalen Kapitalismus ist in voller Länge noch nicht an uns vorübergezogen. Seine Entwicklung wird sich fortsetzen und weitere Automatisierungen stehen vor der Markteinführung, wie zum Beispiel selbstfahrende Autos oder im Haushalt einsetzbare Roboter, die nicht nur Staub saugen, sondern sich auch auf die Suche nach verlorenen Gegenständen begeben können. Es sollte hierbei in jedem einzelnen Fall gefragt werden, welche Gefahren diese und weitere Neuerungen mit sich bringen und ob sie wirklich im Interesse des Menschen sind. Wenn das Internet es Ärzten ermöglicht, in Echtzeit die allerneuesten, für den Erfolg einer Therapie ausschlaggebenden Forschungsergebnisse abzurufen, wird man dies nur begrüßen können. Bei anderen Formen digitaler Technologie wird die Antwort wohl eher negativ ausfallen, zum Beispiel, wenn Roboter in der Pflege alter Menschen eingesetzt werden, um ihnen „Gesellschaft zu leisten“. Denn wo sich der Mensch durch Roboter nicht unterstützen und dienen, sondern vertreten und ersetzen lässt, schafft er sich selbst ab.