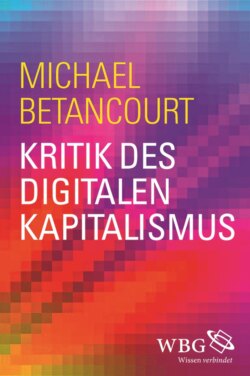Читать книгу Kritik des digitalen Kapitalismus - Michael Betancourt - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
§ 1.3
ОглавлениеUnternehmen, die immaterielle Arbeit in andere Länder auslagern, veranschaulichen einen Paradigmenwechsel in der Konzeption immaterieller Arbeit – von menschlicher Aktivität zu einer modularen Ware. Dieser Transfer basiert auf einem Paradigma der Digitalität, d.h. – speziell auf einer technischen Ebene – einer Verdinglichung des modernistischen Rasters; diese Verbindung zwischen Modularität und Rasterkonstruktionen ist nicht zufällig oder trivial. Er gibt einen fundamentalen Prozess der Segmentierung wieder, der für die „produktive“ Metapher wesentlich ist. Seine Inhalte sind wesentlich identisch, getrennt von der physischen Variabilität, die anderen materiellen Konstrukten inhärent ist, durch die unnachgiebigen Oppositionen des binären Codes, dessen Bedeutung getrennt von der Form der Arbeit besteht, sobald er in eine instabile, menschenlesbare Form übertragen wurde. Denn damit Silizium – das Ausgangsmaterial sowohl für Quarzkristalle als auch von Glas – digital werden kann, muss es im wahrsten Sinne opak werden: Der Prozess des Sehens ist nicht mehr eine Sache des „Sehens-durch“, sondern des „Sehens-in“: Einsicht, transzendente Vision, ein ideologischer Transfer, der sowohl eine Internalisierung des Verstehens/der Produktion, als auch eine Befreiung von physischen Einschränkungen impliziert; dieser Übergang ist die Aura des Digitalen. Die Ideologie, die sie schafft, nimmt die Beobachtung des Science-Fiction-Autors Arthur C. Clark, dass fortschrittliche Technologie mit Zauberei identisch ist, und wendet sie von einer imaginären Zukunft in gelebte Erfahrung der Gegenwart und füllt dabei den Raum des Digitalen mit imaginären, instrumentellen Formen des „Lebens“ (von Computerviren über Würmer, Spinnen, Bots und Spyware), deren Funktion parasitär ist. Gleichzeitig wird die Welt des Lebens maschinenhaft: „Life-hacking“ und DNA als eine Variante des digitalen Codes, manipuliert und modelliert innerhalb der digitalen Technologie, die ihre Transformation in eine Fertigungsanlage ermöglicht – die „produktive“ Metapher als lebende Instrumentalität. Die Bedrohung „menschlicher Ressourcen“ wird verdinglicht, während die biologische Welt in ein wertbesetztes Feld von Produkten (Genen) übersetzt wird, das seiner kommerziellen Entwicklung harrt, basierend auf ihrer Auffassung als „semiotischer Code“, verwandt mit den digitalen Codes von Computern selbst.
Diese Konvergenz des Maschinenhaften, Semiotischen und Biologischen ist der Grund, aus dem sich das Paradigma des Digitalen mit der politischen Ökonomie und denjenigen Problemen überschneidet, die sich durch das menschliche Handeln bezüglich der autonomen Aspekte des digitalen Bereichs ergeben. Die politische Ökonomie wird nicht nur zu einer Angelegenheit der wirtschaftlichen oder der Klassenstruktur, sondern auch der auf Maschinen basierenden Beziehungen innerhalb des Bereiches größerer oder geringerer Kontrolle, der dadurch, wie der digitale Kapitalismus und die Ideologie des Digitalen sich durch die Technik gegenseitig verstärken, produziert, erhalten und verdinglicht wird.
Innerhalb dieses Raumes liegt das modernistische Raster als das ermöglichende Paradigma für die Struktur und Organisation der Elemente, die auf diese und keine andere Weise in Einklang gebracht, gesteuert und valorisiert werden können. In dieser Zerstückelung wird das Potenzial für Quantifizierung und Wertextraktion beziehungsweise -austausch überhaupt erst möglich. Die Zerlegung in und Bearbeitung von Teilaspekten ist ebenso ein fundamentales Merkmal des kapitalistischen Produktionsverfahrens (des Fließbands) wie es ein immanenter Aspekt des semiotischen Prozesses der immateriellen Produktion ist. Die digitale Technologie zwingt alle Dinge notwendigerweise in die Gleichförmigkeit des Rasters (und dabei in das „Exemplarische“) und produziert so die Erweiterung des digitalen Kapitalismus. Jene vorher nicht mit Wert versehenen „Arten zu sein“ wurden die neue Domäne der Aufwertung: Indizes des Glücks, die auf einzelne Individuen zugeschnittene Demografie – die affektiven Domänen –, deren Aktion darin besteht, von der Anpassung des Lebens an die Forderungen abzulenken, die von einem ständig extensiveren, umfassenderen Datenraster gestellt werden, dessen Ziel eine umfassende Darstellung der Lebenswelt ist (das Streben nach dem Zustand umfassender Kenntnis). Die Behauptung, dieses digitale Raster sei in der Lage, das zu erreichen, was die Mathematik „Vollständigkeit“ nennt – eine logische Beschreibung sämtlicher Möglichkeiten –, ist die Aura der Information in Aktion. Douglas Hofstadter, ein Professor für Kognitions- und Computerwissenschaft an der Universität von Indiana, erklärt Vollständigkeit in seinem Buch Gödel, Escher, Bach, in dem es um die Grenzen des Wissens geht, die das Phänomen des Paradoxen ihm auferlegt, als eine logische Konsequenz der Idee mathematischer Konsistenz:
Während Konsistenz die Eigenschaft ist, dass „alles vom System Produzierte […] wahr“ ist, ist es bei der Vollständigkeit umgekehrt: „Jede wahre Aussage ist vom System produziert.“13
Während Hofstadter so vorsichtig ist, darauf hinzuweisen, dass sich mathematische Vollständigkeit nur auf diejenigen Theoreme bezieht, die in einem logischen System hervorgebracht werden, und nicht in jedem System der Welt, bedeutet das digitale Streben in der Aura der Information, Information im wahrsten Sinne des Wortes als Instrumentalität zu verwirklichen, genau dies: ein System zum Speichern und Abrufen von Informationen zu konstruieren, das alles enthält, was in der Welt ist (sei es wahr oder falsch) – dieses Bestreben ist die Aura des Digitalen in Aktion. Es wird durch das Potenzial der digitalen Automation, ohne menschliche Intervention zu handeln, ermöglicht – und beteiligt sich auf diese Weise an derselben Gemütsverfassung, die in der „neutralen Beobachtung“ oder der „Objektivität“ von Fotografien sichtbar wird. Die digitale Aura bewirkt, dass die immanenten Vorurteile und Anliegen der autonomen Produktion vom Bewusstsein abgespalten werden, und trennt damit Arbeit und Produktion vom menschlichen Handeln ab. Der berühmte Aphorismus der Kunst- und Handwerksbewegung des 19. Jahrhunderts, „Durch Hammer und Hand kommen alle Ding zustand’“14 – mit seiner impliziten Anerkennung der Tatsache, dass die Wirksamkeit des Menschen für jegliche Art von Produktion benötigt wurde –, hört auf, wahr zu sein.