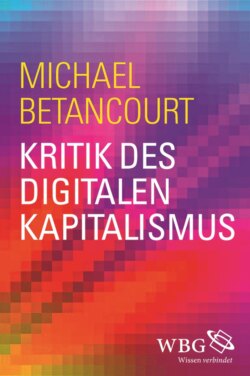Читать книгу Kritik des digitalen Kapitalismus - Michael Betancourt - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
§ 2.2
ОглавлениеKapitalismus ist die Umwandlung der Arbeit in eine Ware – dass die Arbeiter sich ihrer Produktivkraft als etwas entäußern, das ein Gegenstand des Tausches ist. Die historische Maschine ist die Kristallisation dieser entäußerten Arbeitsware als einer physischen Produktivkraft, zwar selbst wertvoll, aber gleichzeitig abhängig von der menschlichen Arbeit, deren Wesen sie in nuce enthält. Die von Marx vorgeschlagenen kategorischen Unterteilungen – Material der Arbeit: jene physischen Güter, die durch den Arbeitsprozess umgewandelt werden, einschließlich von, aber nicht beschränkt auf Rohmaterialien; Arbeitsmittel: die Werkzeuge, Maschinen und für die Arbeit genutzten Gebäude; und schließlich dasjenige, was er als lebendige Arbeit bezeichnet: die Arbeiter, die die Maschinen bedienen und den Produktionsprozess ermöglichen – offenbaren, wie das automatisierte System als logische Erweiterung der Arbeitsmittel verstanden werden kann, welche die lebendige menschliche Arbeit letztlich zu etwas macht, das zur Vervollständigung der Produktion nicht mehr erforderlich ist.
Der Verlauf dieser Entwicklung ist der Maschine selbst inhärent, als einem Apparat, der die menschliche Tätigkeit potenziert und ersetzt. Die Entwicklung der technischen Anforderungen für das Bedrucken eines einzelnen Blattes auf einer Druckpresse ist ein Beispiel für diesen Prozess. Die erste europäische Druckpresse mit beweglichen Lettern wurde um 1439 von Johannes Gutenberg gebaut. Das Setzen der Schriftzeichen, das Auftragen der Tinte auf die Druckplatten, das Positionieren des Papiers und das Entfernen der einzelnen bedruckten Blätter erforderte menschliche Arbeit. Ein modernes Druckgerät führt alle diese Arbeitsschritte automatisch, schneller und mit wesentlich größerer Präzision aus – und verwandelt auf diese Weise die ehemalige Druckpresse in eine Maschine, für deren Funktion Eingriffe des Menschen nur eingeschränkt erforderlich sind (das Papierfach muss von Hand nachgefüllt werden). Sämtliche Herstellungsfunktionen, für die 1439 mehrere Personen und mehr Zeit und Arbeit benötigt wurden, laufen heute vollkommen automatisch ab.
Als Marx das Fragment über Maschinen verfasste, stand die Rolle der menschlichen Tätigkeit bei der industriellen Produktion allerdings außer Zweifel. In der Reihe seiner theoretischen Aussagen ging es um die Beziehung zwischen Kapital, festem Kapital (die Investitionen in die Maschinen und die Gebäude, in denen sie untergebracht waren) und Arbeit (die zur Bedienung dieser Maschinen erforderlich war). Die Entwicklung der Mechanisierung hatte den Punkt, bis zu dem sie eine Steigerung der menschlichen Produktivkraft war, noch nicht überschritten: Am Anfang stand die Entwicklung von Handwerkszeugen, die eine absolute Unterscheidung zwischen derjenigen Arbeit ermöglichten, die manuelle Fähigkeiten erforderte, und derjenigen, bei der es sich um geistige Arbeit handelte. Dies wird sichtbar in dem Unterschied zwischen dem Stilus, der für die Keilschrift verwendet, und dem Pflug, der zur Kultivierung von Nutzpflanzen eingesetzt wurde. Das Auftauchen von mechanischen Werkzeugen und von Werkzeugmaschinen vor und in der industriellen Revolution diente zwar in jedem Fall zur Verstärkung der menschlichen Tätigkeit und zur Verbesserung der produktiven Fähigkeiten, blieb aber auf die Fähigkeiten der Person beschränkt, die die Maschine bediente. Die Produktion blieb im 19. Jahrhundert, selbst bei Einsatz der Mechanisierung, von der Tätigkeit des menschlichen Arbeiters abhängig, der den fortgesetzten Betrieb der Maschinen gewährleistete und ihre Verwendung im Herstellungsprozess selbst steuerte: Für diese Maschinen war – wie sehr sie den Herstellungsprozess auch optimierten – menschliche Arbeit unerlässlich. Die Annahme, dass Maschinen für ihre produktive Funktion menschlicher Mitwirkung bedürften – was für die physische Herstellung noch zutraf –, ist im Bereich der immateriellen Produktion vollkommen falsch. Marx’ minimale Erörterung der Rolle von Maschinen in der Produktion trifft die Feststellung, dass die Mechanisierung (und Automation) für ihre Wirksamkeit Arbeit erfordern. Im folgenden Zitat geht es um die Umwandlung der Arbeitskraft in die Macht des fixen und zirkulierenden Kapitals sowie um die Frage, in welchem Maße fixes Kapital (in Form von Maschinen) Wert erzeugt:
Als solches Produktionsmittel kann sein Gebrauchswert darin bestehen, daß es nur technologische Bedingung für das Vorsichgehn des Prozesses ist (die Stätte, worin der Produktionsprozeß vorgeht), wie bei den Baulichkeiten etc., oder daß es eine unmittelbare Bedingung für das Wirken des eigentlichen Produktionsmittels [ist], wie alle matières instrumentales. Beide sind nur wieder stoffliche Voraussetzungen für das Vorsichgehn des Produktionsprozesses überhaupt oder für die Anwendung und Erhaltung des Arbeitsmittels.5
Die Rolle der industriellen Maschinerie innerhalb dieses theoretischen Rahmens ist marginal, da die Umwandlung von Arbeit in eine Ware implizit die Einsicht bewahrt, dass die Produktion menschliche Tätigkeit erfordert, eine „Masse der Arbeiter“; und selbst der Ausdruck „Manufaktur“ nimmt wortwörtlich Bezug auf den handwerklichen Aspekt der Produktion. Auf diese Weise erscheint die Maschinerie als Anhang zu den Produktionskosten als eines Aufwands – des Erwerbs von in der Herstellung verwendeten „Werkzeugen“ –, aber sie ist weder ein Ersatz für Arbeit noch vertritt sie sie. Innerhalb dieser Konstruktion fungiert die Maschine als Kristallisation des Kapitalaufwands in einer Form, die zugleich eine Ware – die Maschinerie – und ein Erzeuger von Wert ist, da sie von menschlicher Arbeit, die selbst durch die Regeln der Mechanisierung entfremdet ist, in Bewegung gesetzt wird:
Solange das Arbeitsmittel im eigentlichen Sinn des Wortes Arbeitsmittel bleibt, so wie es unmittelbar, historisch, vom Kapital in seinen Verwertungsprozeß hereingenommen ist, erleidet es nur eine formelle Veränderung dadurch, daß es jetzt nicht nur seiner stofflichen Seite nach als Mittel der Arbeit erscheint, sondern zugleich als eine durch den Gesamtprozeß des Kapitals bestimmte besondere Daseinsweise desselben – als Capital fixe. In den Produktionsprozeß des Kapitals aufgenommen, durchläuft das Arbeitsmittel aber verschiedene Metamorphosen, deren letzte die Maschine ist oder vielmehr ein automatisches System der Maschinerie (System der Maschinerie; das automatische ist nur die vollendetste adäquateste Form derselben und verwandelt die Maschinerie erst in ein System), in Bewegung gesetzt durch einen Automaten, bewegende Kraft, die sich selbst bewegt; dieser Automat, bestehend aus zahlreichen mechanischen und intellektuellen Organen, so daß die Arbeiter selbst nur als bewußte Glieder desselben bestimmt sind.6
Während Marx’ Beschreibung ein zeitgenössisches, kybernetisches Verständnis ins Feld zu führen scheint, nach dem menschliche Arbeit mit mechanischen Verfahrensweisen verschmilzt, ist diese „Automation“ nicht die Automation des digitalen Systems. Während die Tätigkeit dieser menschlichen Arbeiter durch die Maschinentechnologie stark eingeschränkt ist, ist die bewusste Tätigkeit der menschlichen Arbeit (was er als „intellektuelle Organe“ bezeichnet) dasjenige, was die Produktion ermöglicht. Arbeit war die grundlegende „Komponente“ dieser technologischen Innovationen, die den Aufstieg der industriellen Produktion bewirkte. Sie nahm aufgrund der Anforderungen, die die Produktion an die Arbeit als eines intelligenten, höchst komplexen „Rades“ im Getriebe einer ansonsten reglementierten Aktivität – Marx’ „intelligente Organe“ (Tätigkeit) – stellte, eine entfremdete Form an: Die in der mechanisierten Fabrik zulässigen Handlungen sind auf die Erfordernisse einer Maschine beschränkt und dadurch vorgegeben.
Die Annahme, dass Maschinen menschliches Handeln erfordern, taucht erst auf, als die Komplexität dieser Maschinen einen Übergangspunkt erreicht und Teile ihres menschliche Funktionen (aber nicht menschliche Tätigkeit) erfordernden Betriebes durch automatische Funktionen ersetzt werden. Diese notwendige Arbeit, bei der die Rolle der Maschine darin besteht, die menschliche Produktion zu intensivieren und zu unterstützen, war ein faktischer Teil der gängigen Maschinerie des 19. Jahrhunderts, zu Lebzeiten von Marx. Das Aufkommen des Fabrikroboters und der computergesteuerten autonomen Fließbandproduktion lag noch mehr als ein Jahrhundert in der Zukunft. Fabriken übernahmen die „arbeitssparende“ Effizienz der Mechanisierung repetitiver Abläufe – jener Verfahren, die keine intelligente Lenkung (Tätigkeit) erfordern, sondern stattdessen Funktionen fragmentierter und kompartmentalisierter Verfahren, wie etwa die von einem Uhrwerkmechanismus ausgeführten, dem Rathausglockenspiel in München sehr ähnlich, bei dem der Mechanismus durch eine ausgeklügelte Verzahnung und Organisation des Mechanismus selbst einer komplizierten Reihe automatisierter Aktionen folgt. Menschliche Tätigkeit bleibt ein wesentlicher, steuernder Aspekt der Maschine, gleichzeitig gibt es jedoch einen absoluten Unterschied zwischen dem Mechanischen und dem Menschlichen. Eine Unterteilung, die vom Wesen des technischen Apparates selbst vorgeschrieben wird, selbst dann – und besonders wenn – die Orchestrierung dieser Geräte so angelegt ist, dass dadurch der Anschein einer Selbstwahrnehmung entsteht. Es sind diese zunehmend komplexeren, durch Dampf und Strom angetriebenen Maschinen der industriellen Revolution, die Berechnungen und andere präzise, hochspezialisierte Arten intellektueller Aktivität ausführen, welche die Rolle des menschlichen Handelns in Zweifel ziehen.
Das Wesen der mechanisierten Produktion des 19. Jahrhunderts ist fundamental verschieden von autonomer, immaterieller Produktion: Digitale Systeme haben Maschinen möglich gemacht, durch die menschliche Arbeit auf ein Minimum reduziert oder vollständig eliminiert worden ist und die Produktion ohne menschliche Kontrolle, Leitung oder Interaktion vor sich geht. Der Hochfrequenzhandel mit Aktien ist ein typisches Beispiel für diese Automation des Entscheidungsprozesses durch algorithmische Vorgaben. Die bei Druckmaschinen offensichtlichen Veränderungen sind allgemeine Merkmale dafür, wie die automatisierte Produktion notwendigerweise dehumanisierte Arbeit ersetzt. Autonome Produktion, die als „arbeitssparendes“ Verfahren begann, spart nun sämtliche menschliche Arbeit in der produktiven Maschinerie beziehungsweise als Produktivkraft ein: Es ist diese spezifische, digitale Technologie verwendende Dimension der automatisierten (immateriellen) Arbeit, welche eine Ideologie der Produktion-ohne-Konsumtion widerspiegelt.
Die digital ermöglichte Automation macht die menschliche Arbeit, die innerhalb des produktiven Systems vorher der Dienstbarkeit unterworfen war, selbst prekär und stellt damit für den historisch durch die Transformation menschlicher Arbeit in eine Ware definierten Kapitalismus – für den Einsatz menschlicher Intelligenz, Geschicklichkeit und Arbeitszeit als einer spezifischen Form produktiven Werts – eine grundlegende Herausforderung dar. Das Potenzial für vollständige Automatisierung taucht mit der Entwicklung digitaler Automation auf: einer Automation, bei der menschliche Arbeit – menschliches Tätigsein – zu einem vergeudeten Wert wird, wie die „neue Ästhetik“ dokumentiert.