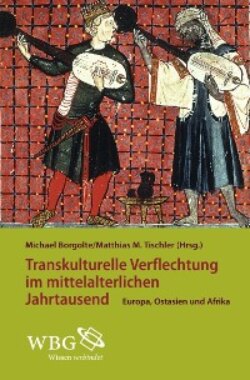Читать книгу Transkulturelle Verflechtungen im mittelalterlichen Jahrtausend - Michael Borgolte - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Einleitung Was sich über mediävistische Migrationsforschung sagen lässt
Оглавление„Migration ist ein Konstituens der Conditio humana wie Geburt, Vermehrung, Krankheit und Tod. Die Geschichte der Wanderungen ist so alt wie die Menschheitsgeschichte; denn der Homo sapiens hat sich als Homo migrans über die Welt ausgebreitet.“1 Mit diesen starken Worten hat der in Deutschland führende Experte kürzlich das soziale Phänomen der Migration zu einer universalhistorischen, ja anthropologischen Konstante aufgewertet. Den Beweis für die Bedeutung der Wanderungen von Gruppen, die zu langfristigen Verlagerungen ihres Lebensmittelpunktes oder Wohnortes führten, hat er zusammen mit einigen Kollegen in einer umfangreichen ‚Enzyklopädie Migration in Europa‘ anzutreten versucht; hier werden immerhin mehr als zweihundert Gruppenwanderungen vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart monographisch behandelt – angefangen von Waldensern in Mitteleuropa, muslimischen Bruderschaften in Südosteuropa und orthodoxen Mönchen auf dem Berg Athos, jeweils in der Frühen Neuzeit, bis hin zu britischen Wohlstandsmigranten an der Costa del Sol oder Kriegsflüchtlingen aus dem ehemaligen Jugoslawien in Europa seit 1991.2 Natürlich konnte das Lexikon nicht vollständig sein, zumal es mit einem dezidiert sozialhistorischen Zugriff Einzel- und Massenmigranten unberücksichtigt ließ und sich auch auf die letzten Jahrhunderte beschränkte. Wiederholt erwies sich das 17. Jahrhundert als fragwürdige Zäsur. Das mittelalterliche Jahrtausend einbeziehen wird aber die in New York vorbereitete ‚Encylopedia of Global Human Migration‘, die ab 2012 in vier Bänden erscheinen soll.3
Ein breites Forschungsinteresse für Migrationen muss unter Mediävisten, abgesehen von der englischen Geschichtswissenschaft4, aber wohl erst noch geweckt werden. Deren Annäherungen an die sozialwissenschaftliche beziehungsweise neuhistorische Migrationsforschung sind in der Vergangenheit wenig erfolgreich gewesen. Deutsche Historiker betonten zwar, dass „Mobilität zur Vitalsituation des mittelalterlichen Menschen“ gehörte, und traten somit der Vorstellung von einer unbeweglichen Ständegesellschaft entgegen, sie standen aber den Analyseinstrumenten der Migrationssoziologie lange skeptisch bis ablehnend gegenüber.5 Erst im letzten Jahrzehnt dringen der Begriff „Migration“ und mit ihm Fragestellungen, Untersuchungsmethoden und Thesen langsam in die Mittelalterforschung ein6; das gilt zum Beispiel für die Geschichte der Völkerwanderung7. Nur ein amerikanischer Mediävist hatte aber den Mut zu konstatieren, dass „Massenbewegungen in der europäischen Geschichte eher die Regel als die Ausnahme“ waren; zum Beleg führte er zahlreiche Migrationswellen von den Indoeuropäern über Kelten, Germanen und Slawen, Magyaren und Normannen bis zu den türkischen Eroberern in Griechenland und auf dem Balkan während des 13. bis 16. Jahrhunderts an. Die mittelalterliche „Wanderungsepoche“ habe Europa bis in die Gegenwart geprägt, so dass die Vorstellung ethnisch reiner Völker unhistorisch sei, aber jetzt, am Beginn des dritten Jahrtausends, fürchte sich Europa wieder vor einer neuen Migrationsperiode.8
Lange schon hätten der allgemeine Gang der Forschung und Erfahrungen mit unserer eigenen Zeit die Mediävisten zu größeren Anstrengungen auf dem Feld der weitläufigen Wanderungen veranlassen sollen; aber auch der Historikertag in Halle 2002 konnte mit seiner Sektion „Migration in der europäischen Geschichte seit dem späten Mittelalter“ dafür keine Impulse freisetzen.9 Wenn wir jetzt, fast zehn Jahre später, einen neuen Anlauf nehmen, tun wir dies selbstverständlich schon wieder mit etwas anderen Akzenten als unsere Vorgänger. Zum einen müssen wir nicht mehr einen strukturgeschichtlichen gegen einen individualhistorischen Zugriff verteidigen.10 Zwar interessieren wir uns nach wie vor für die Eingliederungsprozesse der Zugewanderten, die „von Diasporasituationen oder Minderheitenbildungen bis zum Erlöschen von Gruppenidentitäten“ durch Assimilationen reichen11; dankbar berücksichtigen wir auch die noch gar nicht alten Einsichten, dass Integrationen weder einseitig noch linear oder unumkehrbar waren und oftmals abgebrochen werden mussten, so dass es nützlich ist, den Blick auf mindestens zwei, wenn nicht vier Generationen seit der Einwanderung auszudehnen.12 Allerdings richtet sich das heutige Interesse nicht einseitig an der Anzahl der Immigranten aus, da auch Einzelne spezifische Sinngebungen der Welt und ihres eigenen Handelns mit sich führen können13, die die Lebensweise und Werte der Einheimischen verändern, wie diese auch umgekehrt auf ihn einwirken mögen. Mit anderen Worten geht es in der Migrationsforschung heute, auch wenn die alten Fragen nicht obsolet sind, weniger um soziale Arrangements als um interkulturelle Begegnungen und transkulturelle Verflechtungen.14 Anders und vielleicht überspitzt gesagt, zielt eine kulturwissenschaftlich ausgerichtete Migrationsforschung weniger auf Personen, Gruppen und Völker auf der Wanderung und bei der Neuansiedlung, als auf jene Denkformen, geistigen Güter und symbolischen Praktiken, die dabei ausgetauscht oder auch abgelehnt wurden und so in jedem Fall Kultur in ihren ständigen Mutationen erfahrbar machen. ‚Cross-cultural interaction‘ ist ein Stichwort, das amerikanische Historiker in diesem Zusammenhang ins Spiel gebracht haben.15
Damit hängt eine zweite Leitidee für die neue Migrationsforschung zusammen. Diese muss nämlich als ein wesentlicher Bestandteil der Globalgeschichte begriffen werden.16 Globalgeschichte reagiert ja nicht nur als neues Feld historischer Forschung auf die zeitgenössische Erfahrung universal verdichteter und beschleunigter Kommunikation17, sondern sie will vornehmlich die Kontakte und Interaktionen zwischen Zivilisationen oder „Großkulturen“ erfassen und ergründen18. Migrationen, die fast notwendig mit einem Austausch von Kulturen einhergehen, sind zweifellos ein Schwerpunkt, wenn nicht der Königsweg der kulturalistischen Globalgeschichte, und zwar noch vor den Reisen von Diplomaten und Händlern, Gelehrten, Pilgern und Missionaren.
Die mittelalterlichen Migrationen globalhistorisch zu erforschen, bedeutet nicht, sie universalhistorisch in eine Langzeitperspektive zu rücken; dies haben frühere Autoren gelegentlich getan, wenn sie, wie in einem Buch von 1932, unter dem Titel „Kriegs- und Wanderzüge“ die „Weltgeschichte als Völkerbewegung“ darstellten und dabei Migrationen des 7. bis 10. mit denen des 16./17. und des 19./20. Jahrhunderts verglichen19. Vielmehr muss mittelalterliche Migrationsgeschichte dem Anspruch von Globalgeschichte Rechnung tragen, „Interaktionsgeschichte innerhalb weltumspannender Systeme“ zu sein20. In jener Zeit, die wir im Westen Europas als Mittelalter zu bezeichnen gewohnt sind, gab es aber noch kein Kommunikationsnetz über dem gesamten Globus.21 Ein Weltsystem im Sinne von Wallerstein hat allenfalls zwischen 1200 und 1350 existiert und reichte vom Westen Europas bis ans Gelbe Meer.22 Ansonsten waren die Wirtschaftszonen, „kulturellen Inseln“ oder „geschlossenen Universen“ begrenzt23 und hatten keinen oder wenig Kontakt miteinander. Unterschieden werden gern eine westeuropäische, eine arabisch-islamische und eine ostasiatische Kulturregion24; in jedem Fall ohne Verbindung mit der übrigen Ökumene verharrten noch die beiden Amerikas, Sibirien und Afrika südlich der Savanne. Es gab im mittelalterlichen Jahrtausend also mehrere „Welten“. Transkontinentale Geschichte als Globalgeschichte von Kommunikation und Kulturaustausch beschränkte sich im Allgemeinen nur auf jene Teile der Erde, die an Mittelmeer und Nil aneinanderstießen: Europa, Nordafrika und Südwestasien.
Nicht der diachrone Vergleich wie bei der alten Universalgeschichte, sondern ein synchroner Vergleich kann hier die beziehungsgeschichtlich orientierte Globalhistorie ergänzen und bereichern. Wenn es richtig ist, dass Migrationen ein ständiger Begleiter des Menschengeschlechtes waren und sind, dann darf man sie in allen Teilen der Welt suchen; ein diachroner Vergleich zwischen Migrationen in voneinander geschiedenen Weltregionen ist besonders reizvoll, weil sie sich unabhängig voneinander entfaltet haben.25 Lassen sich beim Vergleich von Motiven und Wegen, Zielen und Ergebnissen solcher Wanderungen Gemeinsamkeiten und Unterschiede ermitteln, dann stellen sich tatsächlich Fragen nach Konstanten des menschlichen Verhaltens, die bis zur ursprünglichen Verbreitung des homo sapiens26 oder doch zu alten Kontaktgeschichten menschlicher Populationen zurückreichen müssten27.
Mit diesen Bemerkungen sei angedeutet, welche Perspektiven dieser Sammelband in seinem ersten Teil eröffnen kann und soll. Glücklicher Weise ist es gelungen, die beziehungshistorische Frage der Globalgeschichte mit dem komparativen Ansatz zu vereinen, da sich Vertreter und Vertreterinnen verschiedener Fächer auf dieses Wagnis mit der Mediävistik eingelassen haben. Wenn Mediävisten mit Afrikanisten, Sinologen, Japanologen und Islamwissenschaftlern ins Gespräch kommen, eröffnen sich allen beteiligten Fächern und nicht zuletzt der Geschichtswissenschaft ganz neue Horizonte.