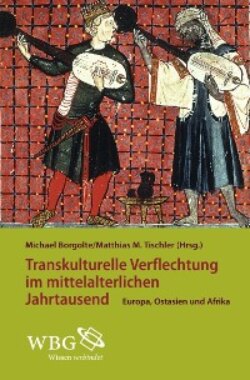Читать книгу Transkulturelle Verflechtungen im mittelalterlichen Jahrtausend - Michael Borgolte - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Zu ‚Passagen‘ als neuem Paradigma der transkulturellen Mediävistik
ОглавлениеIm Gegensatz zu ‚Migration‘ ist die ‚Passage‘ als ein neues Paradigma der transkulturellen Mediävistik überhaupt noch nicht in den Wissenschaftsdiskurs eingeführt, obwohl sie einen prominenten Vordenker einer grenzüberschreitenden Geschichtsbetrachtung hat – den in der Nacht vom 26. zum 27. September 1940 auf der Flucht vor den Nationalsozialisten im katalanischen Portbou freiwillig aus dem Leben geschiedenen deutsch-jüdischen Gelehrten und Philosophen Walter Benjamin. Geradezu symbolhaft liegt der End- oder Fluchtpunkt seines permanenten Grenzgängerdaseins zwischen den verschiedenen kulturellen Identitäten, zwischen den Sprachen und den akademischen Disziplinen in einem Grenzraum, der Ausgangspunkt unserer Überlegungen sein soll. Walter Benjamins Existenz ist nämlich ein einziges Durchschreiten von Schwellen- und Erfahrungsräumen. Nicht von ungefähr ist in seinem Passagenwerk, einer Geschichtsphilosophie und Erkenntnislehre, das ganze Potenzial des benjaminschen Denkens gespeichert.28 Gerade wegen ihrer überragenden Rolle in der Modernitätsdebatte besitzt sie aktuelle Bedeutung für die tatsächlichen und scheinbaren Alteritäten des mittelalterlichen Denkens und Handelns sowie für ihre transkulturelle und transdisziplinäre Erforschung.29 Im Kontrast mit den Passagen-Bildern aus dem Paris des 19. Jahrhunderts, seiner Metropole der Moderne, schärft Benjamin unseren Blick für die kulturellen und religiösen Passagen der Vormoderne. Exemplarisch für solche ‚Übergänge‘ soll hier nur auf die Rolle der Juden als maßgeblichen „hommes de passage“ des europäischen Mittelalters verwiesen werden.30
Passage, lat. „passaticum“, „passagium“ u.ä., bedeutet im Mittelalter zunächst Fährgeld oder Zoll, aber auch Zollstation und bezeichnet im übertragenen Sinn sowohl die Bedingung und die Schwelle einer Grenz(raum)überschreitung wie auch den Akt einer solchen Traverse. Aus der Handelssprache übernommen, meint der Begriff dann jegliche Überfahrt oder Seereise und somit das „passagium generale“ bzw. „particulare“ den allgemeinen Kreuzzug bzw. die punktuelle kreuzzugsähnliche Expedition.31
Unsere terminologische Annäherung an ‚Passagen‘ stülpt Altbekanntem nicht einfach eine neue Metapher von Grenze und Raum über, fallen doch Quellenbegriff und wissenschaftliche Erkenntniskategorie zusammen. Unsere Frage aber soll lauten, ob es im Mittelalter nicht zahlreiche weitere Passagen im Sinne einer kulturelle und religiöse Grenzen und Räume schaffenden und überwindenden Sozialpraktik gegeben hat, die Gegenstand und Mittel historischer Erkenntnis sein können, ohne selbst als ‚Passagen‘ bezeichnet worden zu sein.32 Dazu müssen wir unsere Vorstellung von ‚Passage‘ erweitern, indem wir zunächst den Begriff der ‚Grenze‘ reflektieren.33 Nach den Einsichten der modernen Philosophie enden die Konstruktion und Überwindung von Grenzen in einer erkenntnistheoretischen Aporie,34 weshalb die Suche nach einer neuen Deutungskategorie, die zugleich Ereignis, Struktur und Erkenntnismittel ist, diesem permanenten Wechselspiel von Einhegung und Erweiterung der Einsicht in das Eigene, Fremde und Andere am ehesten gerecht wird. ‚Passagen‘ ermöglichen überhaupt erst das Erkennen und Überschreiten von mentalen und realen Grenzen und Grenzräumen zwischen wenigstens zwei Seiten und konstituieren auf diese Weise verschiedene kulturelle, religiöse und soziale Entitäten und Räume. Das Denken in ‚Passagen‘ vermeidet somit die epistemologisch ohnehin unmögliche essentialistische Inbezugsetzung von fixen, monolithischen und homogenen Größen (‚Kultur‘, ‚Religion‘ …). Und es beugt einem dichotomischen bzw. konfrontativen Denken in Wortpaaren wie ‚lateinisch/arabisch‘, ‚christlich/muslimisch‘ usw. vor. Die Untersuchung der Prozesse von Passagen und ihrer Wirkungen auf das Eigene und das Andere gibt Aufschluss über die Ausbildung und das Aussehen korrespondierender Partner, die zunächst undefiniert bleiben.
‚Passage‘ ist also ein offener Bewegungsbegriff ohne teleologische Dimension. Wie ‚Migration‘35 ist sie ein dynamisches Konzept, das eine adäquate Vorstellung von Kultur und Religion als ‚unaufhörlichem Prozess des Wandels‘ entwickelt. Doch hinsichtlich der hinter ihr stehenden Formen der Mobilität ist ‚Passage‘ von ‚Migration‘ verschieden: Sprechen wir von Passanten, so richtet sich unser Blick eher auf Einzelpersonen oder allenfalls auf kleine Gruppen von Passanten als Kultur- oder Religionsträgern36 ohne Zwang zu einer dauerhaft beabsichtigten Verlagerung des Lebensmittelpunktes oder Wohnortes, um einem politischen Machtgefälle oder sozialen Ungleichheiten auszuweichen. In dieser Perspektive können auch die religiöse und kulturelle Konversion einer Einzelperson und die Neugestaltung eines religiösen und kulturellen Raumes durch Gruppen als ‚Passagen‘ verstanden werden. In jedem Fall ist hier die Tendenz zu Mikrostudien unverkennbar.
Reden wir von ‚Passanten‘, so haben wir zumeist eher eine schmale soziale oder geistige Elite denn eine breite Gesellschaftsschicht im Blick. Die Tendenz geht also mehr zur sozial verfassten Geistes- denn zur reinen Sozialgeschichte. Indem uns vornehmlich das Schicksal Einzelner oder kleinerer Gruppen interessiert, beteiligen wir uns an der ‚biographischen Wende‘ weg vom a-personalen Strukturalismus der Geschichtswissenschaft französischer Prägung. Insofern sind von der Erforschung von ‚Passagen‘ auch neue Beiträge zur stets virulenten Frage nach der Entdeckung der ‚Individualität‘ bzw. ‚Personalität‘ im Mittelalter zu erwarten. Mit Blick auf ‚Passagen‘ arbeiten wir zudem mit mindestens drei etablierten Forschungsparadigmen: mit der Beziehungsgeschichte von Personen und Gruppen in ihren kulturellen und religiösen Ausdrucksformen, ferner mit dem Kulturtransfer und der Kulturtransformation sowie mit dem historischen Vergleich. Aber als Raumkonzept, das nicht mehr wie der ‚Transfer‘37 eine einseitige und monoperspektivische Beziehung zwischen Ausgangsund Zielpunkt von Prozessen der ‚Transformation‘, sondern wenigstens zwei miteinander kommunizierende Pole bzw. Seiten in ihrer wechselseitigen Beziehung beschreibt und dabei nicht so sehr auf absichtliche Übertragungs- und Überformungsvorgänge abhebt, reichern ‚Passagen‘ die drei eben genannten Wissenschaftskonzepte auch insofern an, als sie ein offenes, möglichst wertfreies Konzept anbieten, das ‚Grenzen‘ als sich wechselseitig herausbildende mentale Übergangszonen (zones médianes) und nicht mehr als gegebene geographische Größen begreift.38 Im Sinne der benjaminschen Schwellenkunde sprechen wir daher von ‚Passagenräumen‘. Und da ‚Passage‘ keine Einbahnstraße, sondern ein Konzept von Korrespondenzen und wechselseitigen Perspektiven ist, erweist sich das Denken und Sprechen von ‚Passagen‘ auch als eine Form des wissenschaftlichen Vergleichs.
Der Betrachtungsraum der hier vorgelegten Beiträge zu ‚Passagen über Grenzen‘ ist die gesamte Welt des Mittelmeers, die als ein durch ‚Passagen‘ konstituierter Raum von Traversen und den hiermit verbundenen Prozessen der Begegnung, Wahrnehmung und Deutung von Fremdem bzw. Anderem verstanden wird und an der mehr oder weniger alle historischen Anrainer teilhatten. ‚Mittelmeer‘ wird so zur Chiffre für das Prinzip der ‚Konnektivität‘ und steht im vollen Wortsinn für ein ‚mittleres Meer‘. Die Beiträge kombinieren hierzu Fragestellungen der europäischen Geschichtswissenschaft mit nicht-europäischen philologischen und kulturwissenschaftlichen Disziplinen wie der Hebraistik und der Arabistik sowie der Judaistik und den Islamwissenschaften. Sie umspannen den gesamten Zeitraum des Mittelalters und nehmen das Phänomen der ‚Passage‘ in den Bereichen ‚Kultur‘, ‚Religion‘ und ‚Wissen‘ in den Blick. Zugleich treffen sich die an den Mittelmeerstudien partizipierenden Wissenschaftstraditionen Englands, Frankreichs, Italiens, Spaniens und Deutschlands sowie Israels.