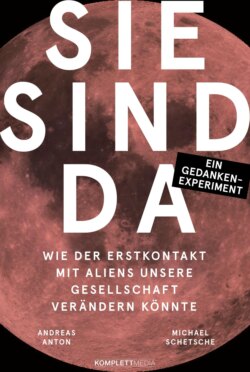Читать книгу Sie sind da - Michael Schetsche - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Rolle der Exosoziologie Die Idee einer Exosoziologie
ОглавлениеZum wohl ersten Mal taucht der Begriff »Exosoziologie« in der wissenschaftlichen Literatur in einem von dem russischen Radioastronomen Samuil A. Kaplan herausgegebenen Sammelband aus dem Jahr 1969 auf.12 Er trägt den Titel »Außerirdische Zivilisationen. Probleme der interstellaren Kommunikation«. Dessen Kapitel wurden alle von Naturwissenschaftlern geschrieben. Mit dem Begriff »Exosoziologie« benennt Kaplan alle Bemühungen einer Suche nach den Signalen außerirdischer Zivilisationen – was für ihn drei wichtige Punkte umfasst: zum einen eine Theorie der Entwicklung von Zivilisationen, die fortgeschrittener als die über menschliche Gesellschaften sind. Dann die Entwicklung von Strategien für die Suche nach außerirdischen Zivilisationen. Und schließlich erwähnt Kaplan »sprachliche Probleme der Entschlüsselung außerirdischer Botschaften«.
Alles Aufgaben für eine neue Subdisziplin, die es so bisher noch nicht gab. Einiges davon fand sich im Westen bereits unter dem Begriff SETI, das Programm der Exosoziologie wurde von Kaplan jedoch deutlich weiter gefasst. Er lehnt sich dabei an den damals in der sowjetischen Forschung verwendeten Begriff »Exobiologie« an. Diese kümmerte sich um die Frage, wie Leben außerhalb der Erde entstand und wie es sich verbreitete. Die Exosoziologie dagegen fragt nach der Entstehung und Verbreitung von intelligentem Leben. Und nach der Möglichkeit oder auch Unmöglichkeit, mit Außerirdischen zu kommunizieren.
Ohne diese rein sowjetische Debatte zu kennen, wurde der Begriff Exosoziologie mehr als zehn Jahre später wieder erwähnt: Im November 1983 erschien in einer kleinen englischsprachigen Fachzeitschrift ein Aufsatz13 des seinerzeit auf Hawaii lehrenden Soziologen Jan H. Mejer. Er wollte ein neues Teilgebiet der Soziologie etablieren, das sich vor allem mit der Frage beschäftigen sollte, wie Fremdheit gesellschaftlich konstruiert wurde und wird. Und was man daraus für unser Verständnis außerirdischer Zivilisationen ableiten kann. Insbesondere wollte Mejer das kulturelle Wissen über Mensch-Alien-Kontakte untersuchen. Jenes Wissen, das man vor allem in der Science-Fiction findet.
Er fragte sich, wie die Menschen, die Soziologen, etwas über den Zustand außerirdischer Gesellschaften erfahren können, falls diese entdeckt werden sollten. Mejer versprach sich davon Impulse für das sozial- und kulturwissenschaftliche Denken – ganz egal, ob dann irgendwann wirklich Außerirdische entdeckt werden sollten. Aber Mejers Idee hat sich nie durchgesetzt. Das von ihm formulierte Programm gibt es bis heute nicht. Seine Fragen fanden die meisten Forscher damals bedeutungslos und unergiebig. Und seine Grundidee war wohl auch zu Beginn der 1980er-Jahre gesellschaftspolitisch sehr unerwünscht, da auf der Erde ein neuer kalter Krieg bevorstand, der zum ersten Mal auch den Weltraum als mögliches Schlachtfeld erwog. Angesichts dieses drohenden Konflikts in der Erdumlaufbahn wollte sich niemand mit der Frage nach Außerirdischen beschäftigen, weder die Massenmedien noch die Wissenschaften. So wurden Mejer und seine Vorschläge weitgehend vergessen.
Einer der wenigen Nachfolger, zumindest was das soziologische Nachdenken über den Weltraum betrifft, ist der US-amerikanische Soziologe Jim Pass. Sein »Astrosociology Research Institute« wendet sich allerdings deutlich irdischeren Fragen zu. Pass hat offensichtlich aus dem Scheitern seines ideellen Vorgängers gelernt: Er widmet sich der gesellschaftlichen Organisation der Weltraumforschung, vor allem der bemannten Raumfahrt. Der Kontakt mit außerirdischen Zivilisationen ist für ihn nur ein Randthema. Mejers visionärer Blick wurde durch ein traditionelles soziologisches Programm ersetzt – im deutschsprachigen Raum als »Raumfahrtsoziologie« bekannt. In deren Mittelpunkt steht die historische Entwicklung der irdischen Raumfahrt: Wie kamen welche Programme zustande? Welche Interessen lagen ihnen zugrunde? Und wer traf warum bestimmte Entscheidungen. Gerade wenn man auf aktuelle Raumfahrtprojekte blickt, scheint dabei aber nur die nähere Zukunft der Menschheit im Weltall zu interessieren. Die fernere Zukunft oder gar der Kontakt mit einer anderen Zivilisation bleibt weitgehend ausgespart.
Die eigentliche Aufgabe einer Exosoziologie, wie sie von Jan Mejer und den sowjetischen Forschern um Kaplan verstanden wurde, scheint unwichtig geworden zu sein – nämlich außerirdische Zivilisationen zu suchen und zu erforschen. Unwichtig angesichts all der irdischen Probleme, vor denen wir heute stehen. Trotzdem wollen wir, dass die Idee einer Exosoziologie nicht vergessen wird. Wir denken, es gibt viele gute Gründe – für die Soziologie, für die Wissenschaft, aber auch für die Gesellschaft insgesamt –, sich nicht zu schnell von dem zu verabschieden, was Kaplan und Mejer aufbrachten. Möglicherweise scheiterten die Autoren nicht, weil ihre Ideen unsinnig waren, sondern weil sie einfach viel zu früh dran waren. Wie man gut am Beispiel der Initiative von Jan H. Mejer sehen kann.
Denn Mejers Aufsatz erschien in der Hochzeit der sogenannten »neuen sozialen Bewegungen«, bei denen in allen westlichen Gesellschaften bisher ausgeblendete Themen öffentliche Aufmerksamkeit bekamen. Seien es ökologische Gefahren oder die in vielen Staaten herrschende strukturelle Gewalt. Es war gleichzeitig das Ende der friedlichen Erkundung des Weltraums. Im März 1983, ein halbes Jahr bevor Mejers Artikel erschien, hatte der damalige US-Präsident Ronald Reagan seine Pläne zur Militarisierung des Weltraums verkündet, die später als »Krieg-der-Sterne-Programm« bekannt werden sollten. Die Idee von Erforschung und einem möglichen friedlichen Kontakt zu Außerirdischen war kriegerischem Denken gewichen. Zumindest in den USA. Heute wissen wir, dass aus Reagans Plänen nichts werden konnte. Schon allein aus technologischen Gründen. Trotzdem vergifteten sie lange die gesamte Weltraumforschung.
Aber in den letzten zehn Jahren hat sich viel getan. Die Frage nach außerirdischen Zivilisationen wird nicht mehr nur in der Science-Fiction behandelt, sondern auch immer mehr in der Wissenschaft. Die Astrowissenschaftler entdeckten in den letzten drei Jahrzehnten so einiges, was für außerirdisches Leben spricht: viele neue Planeten außerhalb unseres Sonnensystems, das Wissen, dass die Lebensbausteine im All weitverbreitet sind, oder dass irdische Organismen extrem widerstandsfähig sein können. Und so ist die Idee vom Leben außerhalb der Erde im wissenschaftlichen Mainstream angekommen. In den USA hat sich gar mit der Astrobiologie ein neuer Forschungszweig etabliert, der mit vielen innovativen Projekten die Öffentlichkeit wie auch private und staatliche Geldgeber auf sich aufmerksam macht. Und der auch auf andere Disziplinen wie die Molekularbiologie oder die Geologie einwirkt.
In den Naturwissenschaften geht man heute davon aus, dass es im Universum wahrscheinlich nicht nur viele belebte Planeten gibt, sondern dass man bald auch Beweise finden könnte, dass es intelligente außerirdische Gesellschaften gibt. Wenn man denn nur richtig danach suchen würde. Und so haben sich unter dem Stichwort SETI einige Forschungsprogramme etabliert, die ein Ziel haben: Sie wollen künstliche Signale aus dem Universum empfangen und so beweisen, dass es noch andere intelligente Zivilisationen gibt.
Die SETI-Forscher sind dabei vom »kosmischen Kontakt-Paradigma« überzeugt. Darin soll begründet werden, warum die Suche nach außerirdischen Intelligenzen wissenschaftlich sinnvoll ist. Und obwohl alle Annahmen darunter »leiden«, dass bislang nur ein einziger Fall der Entwicklung von Leben bekannt ist (nämlich der auf der Erde), so stimmen ihnen nicht nur Astrowissenschaftler zu, sondern auch viele in der Scientific Community generell. Zumindest aber werden sie mit einem gewissen Wohlwollen betrachtet. Auch wenn nicht alle so optimistisch sind wie die SETI-Forscher, was den schnellen Erfolg der Suche angeht.