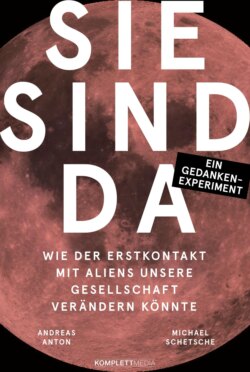Читать книгу Sie sind da - Michael Schetsche - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Wissenschaftliche Zukunftsforschung
ОглавлениеDie Exosoziologie ist eine futurologische Disziplin. Ganz einfach deshalb, weil wir bisher noch keine außerirdische Zivilisation entdeckt haben, bei der wir nachfragen können: Wie sind sie organisiert, wie können wir mit ihnen ins »Gespräch« kommen, und was bedeutet diese Entdeckung für unsere Zivilisation? Vor dem Erstkontakt ist vor allem letztgenannter Punkt der wichtigste für einen Exosoziologen.
Was den Menschen von Tieren wie Hasen, Heuschrecken und Hummern unterscheidet: Er kann sich ein Bild von der Zukunft machen und entsprechend handeln. Deshalb hat er den tiefen Wunsch, so viel wie möglich über die Zukunft wissen zu wollen. Das führte schon vor Jahrtausenden in fast allen Kulturen zu allerlei Techniken von Weissagungen. Sei es mit den Eingeweiden von Ziegen, durch allerlei Drogen oder mit Runensteinen.16
Aber auch in moderneren Zeiten versuchten und versuchen Philosophen oder Wissenschaftler, die Zukunft mit ihren Methoden vorherzusagen. Dies beginnt mit den Utopien der Renaissance, die noch Voraussage und Wunschbild vermischen. Oft blieb damals unklar: Wird die Zukunft so aussehen oder soll sie so werden? Eine solche Verknüpfung findet sich ebenso in der marxistischen Theorie seit Mitte des 19. Jahrhunderts: Der Sozialismus kommt, das ist die sichere Prognose, aber er »kommt nicht wie das Morgenrot nach durchschlafener Nacht«, wie Bertolt Brecht anmerkte. Mit anderen Worten: Er ist erstrebenswert, damit er aber kommt, müsse man etwas tun. Das geht deutlicher in Richtung der Zukunftsforschung, wie wir sie heute kennen.
Die wissenschaftliche Zukunftsforschung entstand Mitte des 20. Jahrhunderts. Vor allem in den USA wurden hierzu Methoden wie Spieltheorie, Simulationstechnik oder Szenariotechnik entwickelt. Wichtig dabei waren und sind in den USA die »Think Tanks« im Umfeld von Militär, Industrie und Politik.17 Aber es gibt auch eine völlig andere Zukunftsforschung: Bereits in den 1940er-Jahren wollte der von den Nazis aus Deutschland vertriebene Politikwissenschaftler Ossip K. Flechtheim als überzeugter Pazifist durch eine systematische Prognose mögliche gesellschaftliche, politische und militärische Konflikte vorhersehen und durch rechtzeitiges Handeln abwenden. Also Zukunftsforschung, um Kriege zu vermeiden, nicht, um sie zu führen.
Flechtheim prägte den Begriff der Futurologie als der Lehre von den möglichen Zukünften. Diese erlebte ihre Blüte in den 1970er- Jahren. In dieser Zeit erschienen drei Klassiker dieses Stranges der Zukunftsforschung. Es begann mit Ossip K. Flechtheims »Futurologie« aus dem Jahr 1970. Der Untertitel »Der Kampf um die Zukunft« macht bereits die wesentliche Stoßrichtung deutlich: Es geht nicht nur darum zu prognostizieren, was die Zukunft bringen könnte, sondern auch darum, sich für eine der möglichen Zukünfte zu entscheiden – und dann dafür zu kämpfen.18
Drei Jahre später erschien »Der Jahrtausendmensch« von Robert Jungk. Der Autor, ein studierter Philosoph, musste wie Flechtheim Mitte der 1930er-Jahre aus Deutschland fliehen. In der Schweiz arbeitete er während der Kriegsjahre als Journalist, war dann als Auslandskorrespondent in aller Welt tätig und siedelte schließlich nach Österreich über. Dort begann er, sich Ende der 1950er-Jahre mit Prognose und Planung des Zukünftigen zu beschäftigen. Insbesondere damit, wie man eine menschenwürdige Zukunft für alle schaffen könnte.19 Jungk war auch einer der Vordenker der Friedens- und Ökobewegung.
Fast genau zwischen diesen beiden Werken erschien Anfang 1972 das Buch, von dem letztlich die stärksten Impulse für die Zukunftsforschung, aber auch für das ökologische Denken ausgingen: Dennis Meadows »Die Grenzen des Wachstums«. Der Autor vertrat dabei den 1968 von Intellektuellen, Wissenschaftlern und Humanisten gegründeten »Club of Rome«, dessen Ziel es war, die ökologischen Probleme der Menschheit zu ergründen und Vorschläge für deren Lösung zu machen. Die Sprengkraft dieses Buchs, das zu einem Auslöser der ökologischen Revolution wurde, war vor allem die Kritik am zügellosen Wachstum.20
Das will auch die Exosoziologie als Teilbereich der Futurologie: durch ihre Prognosen Schaden von der Menschheit abwenden. Für die Zukunftsforschung hat die Arbeit des Club of Rome einen Schub gebracht. Praktisch alle computergestützten »Weltmodelle« gehen bis heute auf die hier entwickelten Methoden zurück. Darüber hinaus wird in den »Grenzen des Wachstums« deutlich, wie wichtig es ist, verschiedene Szenarien zu analysieren. Seit den 1970er-Jahren prognostiziert die Zukunftsforschung regelmäßig mehrere mögliche Zukünfte. Und versucht herauszufinden, unter welchen Bedingungen die eine oder die andere Möglichkeit Wirklichkeit werden könnte.
Die wichtigste aktuelle Leitfrage der Exosoziologie lautet: »Was würde sich für unsere Gesellschaften ändern, wenn wir wüssten, dass wir nicht allein im Universum sind?« Dies ist bis heute eine hypothetische Frage – und damit eine, wie sie in der Zukunftsforschung immer wieder gestellt wird. Ein Erstkontakt wäre ein sogenanntes »Wild Card«-Ereignis (siehe auch Seite 108 ff.). Solche Ereignisse sind zwar extrem unwahrscheinlich, wenn sie aber eintreten, haben sie erhebliche Auswirkungen, die die Gesellschaft massiv betreffen. Die Exosoziologie kann hier helfen, mit der Szenarioanalyse, die eine der wichtigsten Methoden der Futurologie ist.