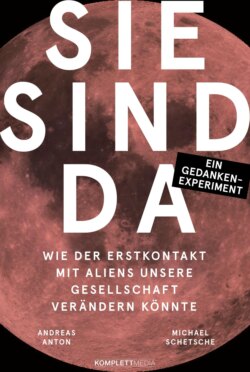Читать книгу Sie sind da - Michael Schetsche - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Soziologie der Fremdheit
ОглавлениеDas zweite Bein der Exosoziologie ist die Soziologie der Fremdheit und das Konzept des »maximal Fremden«. Der Fremde im sozialen Sinne ist derjenige, der mir persönlich nicht bekannt ist oder nicht zu meiner Gruppe gehört. Der Fremde im kulturellen Sinne aber ist derjenige, mit dem ich die Gewissheiten nicht teile, die mein Weltbild bestimmen. In seiner Untersuchung des Fremden führt der deutsche Philosoph Bernhard Waldenfels eine weitere Stufe ein: die »radikale Fremdheit«. Dabei meint er aber nicht ein greifbares Gegenüber, sondern Grenzphänomene der menschlichen Existenz, etwa »Eros, Rausch, Schlaf oder Tod«. Waldenfels meint Erlebnisse, die zwar den alltäglichen Horizont des Menschen überschreiten, dabei aber doch zum Bereich menschlicher Erfahrungen gehören. Wenn wir den Bereich der menschlichen Lebenswelt verlassen, haben wir es laut Waldenfels mit dem »schlechthin Fremden« zu tun, das nicht untersucht werden kann.21
Auch der deutsche Philosoph und Soziologe Georg Simmel (1858–1918) stellt in einem Text über den Fremden aus dem Jahre 1908 recht deutlich fest: »Die Bewohner des Sirius sind uns nicht eigentlich fremd – dies wenigstens nicht in dem soziologisch in Betracht kommenden Sinne des Wortes –, sondern sie existieren überhaupt nicht für uns, sie stehen jenseits von Fern und Nah.«22 Die hypothetischen Bewohner des Sirius, der ja ein Stern ist und deshalb mit Sicherheit unbewohnbar sein dürfte, führt Simmel hier lediglich als kurzes Gedankenspiel ein – gleichsam eine Metapher für Wesen, die uns so fern sind, dass wir uns eigentlich gar nicht erst mit ihnen zu beschäftigen brauchen.
Dass man sich derart auf den Menschen beschränkt und alle Typen von »Nichtmenschen« aus der Analyse ausschließt, ist bis heute beispielhaft für die Kultur- und Sozialwissenschaften. Der deutsche Philosoph Wilhelm Vossenkuhl erkennt die Grenzen dieses Konzepts: »Wenn ich das Fremde an mir selbst erkenne, werde ich der Fremdheit des anderen gegenüber wohl offener sein. Aber diese Offenheit und die Achtung vor dem Fremden sind nicht hinreichend für das Verstehen des Fremden.«23 Zumal wenn es sich um ein nichtmenschliches Gegenüber handelt – das, was die Soziologie einen »maximal Fremden« nennt.
Der »maximal Fremde« ist also ein Gegenüber, das wir als nichtmenschlich definieren, das aber trotzdem als zumindest gleichwertiger Interaktionspartner gesehen wird. »Maximal Fremde« wären demnach Wesen, die über folgende Eigenschaften verfügen:
Ihre Sinnes- und Kommunikationskanäle sind mit den unseren kompatibel.
Sie können denken und entscheiden, zumindest in Ansätzen.
Sie haben ein Selbstbewusstsein.
Sie können zielgerichtet handeln.
Sie wollen grundsätzlich kommunizieren.
Dabei kann es stark schwanken, wie intensiv der Mensch tatsächlich mit dem »maximal Fremden« interagiert. Außerdem können die Qualitäten des Gegenübers zunächst oder sogar dauerhaft ungewiss bleiben. Genau genommen gehören zu jenen »maximal Fremden« all jene nichtmenschlichen Wesen, mit denen wir zumindest theoretisch interagieren können: Haus-, Nutz- und Wildtiere, Götter, Engel und Dämonen (falls es sie gibt), Künstliche Intelligenzen jeglicher Art, die zu erschaffen wir gerade beginnen – und eben jene außerirdischen Intelligenzen, um die es uns in diesem Buch geht.
Mit der Kategorie des maximal Fremden ist der äußerste Bereich dessen markiert, was in sozialen Situationen als Gegenüber zur Interaktion denkbar ist. Ein Treffen mit einem oder mehreren maximal Fremden wäre eine kommunikative Grenzsituation, in der das meiste, das wir bei allen Interaktionen unter Menschen zugrunde legen, entfallen würde. Die folgende Liste zählt die Grundbedingungen menschlicher Interaktion auf. Das macht gleichzeitig die Probleme einer Interaktion mit dem maximal Fremden deutlich. Deshalb müssten wir sie kritisch hinterfragen, falls wir jemals auf eine außerirdische Intelligenz treffen:
Ein verletzbarer biologischer Körper mit einem an die Umwelt angepassten Wahrnehmungsapparat.
Lebensnotwendige Bedürfnisse wie Essen, Trinken oder Schlafen.
Die Sinnes- und Kommunikationskanäle sind kompatibel; die Umwelt wird ähnlich wahrgenommen.
Wir können uns sofort wechselseitig als Menschen wahrnehmen.
Das Wissen um unsere Sterblichkeit.
Eine »soziale Natur«, also die Abhängigkeit von anderen Wesen der gleichen Art und der Kommunikation mit diesen.
Eine Weltoffenheit, denn als Menschen handeln wir ja nicht instinktgeleitet, sondern entwickeln unsere Verhaltensweisen während der Sozialisation – mal mehr, mal weniger individuell.
Ein Wissen über die Grenze zwischen mir und dem anderen; ein »Ichgefühl«.
Die Fähigkeit, über uns selbst nachzudenken.
Außerirdische sind also maximal Fremde, bei denen viele der genannten Faktoren zutreffen könnten – jedoch nicht müssen. Wir dürfen also diese Faktoren nicht einfach unterstellen, falls wir sie treffen. Wir müssen vielmehr Schritt für Schritt prüfen: Wo ähneln die Fremden uns, wo sind sie ganz anders? Falls die Unterschiede zu groß sind, könnte das dazu führen, dass wir das Gegenüber schlicht nicht verstehen. Im besten Fall. Wenn es schlecht für uns läuft, können Missverständnisse entstehen, die höchst verhängnisvoll sein könnten.