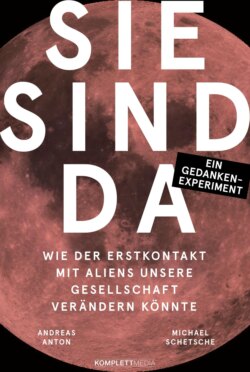Читать книгу Sie sind da - Michael Schetsche - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Umbruch durch Galilei & Co.
ОглавлениеIm Mittelalter spielte das Nachdenken über außerirdisches Leben kaum eine Rolle. In dem von Aristoteles (384–322 v. Chr.) und Ptolemäus (geb. um 100 n. Chr.) geprägten Weltbild des Mittelalters befand sich die Erde in der Mitte des Universums. Um sie herum waren verschiedene Sphären angeordnet, die auch die Planeten trugen. In der äußersten, nicht mehr sichtbaren Sphäre wurde der Sitz Gottes angenommen. Diese Kosmologie war eine festgefügte Ordnung, in der alles seinen Platz hatte. Außerirdische kamen in ihr nicht vor. Über Jahrhunderte gab es kaum Bemühungen, sie zu hinterfragen, zu ergänzen oder durch Beobachtungen zu relativieren. Die Astronomie galt als abgeschlossene Wissenschaft, in der es nichts Neues zu entdecken gab.
Erst mit den geistigen Umbrüchen zu Beginn der Renaissance um das Jahr 1500 wurden die Gedanken an außerirdisches Leben wieder aktuell. Man kam in jener Zeit langsam dahinter, dass das geozentrische Weltbild, also dass die Erde im Mittelpunkt des Universums steht und sich alles um sie dreht, nicht korrekt sein kann. Es begann die Zeit von Wissenschaftlern und Philosophen wie Nikolaus Kopernikus (1473–1543), Galileo Galilei (1564–1642) oder Johannes Kepler (1571–1630). Es erschienen erste utopische Romane von Francis Godwin (1562–1633) oder John Wilkins (1614–1672), die außerirdische Welten und ihre Bewohnbarkeit thematisierten.
Nikolaus von Kues (1401–1464) schreibt in seinem Werk »De docta ignorantia« (»Die belehrte Unwissenheit«) aus dem Jahr 1440, dass die Erde nicht im Mittelpunkt des Universums steht und sich entgegen der sinnlichen Wahrnehmung nicht in Ruhe, sondern in Bewegung befindet.
Von Kues war außerdem davon überzeugt, dass unsere Erde nicht die einzige, sondern nur eine von unzähligen Welten in einem unbegrenzten Universum sei. Daraus schloss er, dass auch Leben anderswo möglich sein müsse, vielleicht sogar höher entwickeltes als auf der Erde. Wenngleich das bei ihm dann aus heutiger Sicht doch recht drollig klingt, wenn er etwa schreibt, dass es »in der Sonnenregion mehr sonnenhafte, klarsichtige und erleuchtete geistbegabte Bewohner« gebe, in jedem Fall »geistiger auch als auf dem Mond, wo sie mehr mondhaft sind«, das Leben auf der Erde hingegen eher »materiebehaftet und dumpf«2 sei. Nun, was die Erdenbewohner betrifft, so könnte man so böse sein und sagen, er habe sie für damals wie für heute zutreffend analysiert, die Existenz von Sonnenbewohnern mutet aus heutiger Sicht aber natürlich kurios an. Aber ansonsten hatte bereits Nikolaus von Kues erstaunlich klarsichtige und richtige Gedanken.
Über 100 Jahre später, in seiner Schrift »De immenso« (»Das Unermessliche und Unzählbare«) von 1591, schloss sich der italienische Philosoph und Astronom Giordano Bruno (1548–1600) dem Gedanken an, dass es im Universum unzählige bewohnte Welten geben müsse. Auch er war seiner Zeit weit voraus, was er schließlich mit dem Leben bezahlen musste. Bruno vermutete ebenso ein unendliches Universum mit unzähligen Welten. Raum und Naturgesetze waren für ihn universell, also überall gleich, woraus er folgerte, dass es auch auf anderen Planeten Leben geben müsse. Schließlich hatten ja alle die gleichen Grundbedingungen. Je nach den Umständen würden sich diese Grundstoffe aber immer anders zusammensetzen und damit für unterschiedlichste Ausprägungen und Formen sorgen.
Damit war Bruno schon recht nah an den Gedanken und Theorien der heutigen Astrobiologie, allerdings nicht an denen der damals allzu mächtigen Kirche. Viele Lebensformen in unzähligen Welten – das war nicht mit dem Bild vom gottgemachten Menschen zu vereinbaren. Ein Jahr, nachdem er seine Theorien veröffentlicht hatte, wurde er von der Inquisition verhaftet, zum Widerruf aufgefordert, den er verweigerte, und nach acht Jahren Kerkerhaft schließlich am 17. Februar 1600 auf dem Campo de’ Fiori in Rom wegen Ketzerei auf dem Scheiterhaufen verbrannt.
Galileo Galilei war ein Zeitgenosse Brunos und bekanntermaßen ebenfalls im Konflikt mit der Kirche. Der Universalgelehrte betrachtete den Mond durch Fernrohre und erkannte dabei dessen raue Strukturen, Ebenen und Vertiefungen, was ihn an die Erdoberfläche erinnerte und darüber spekulieren ließ, ob dort Leben existieren könne. Klar war für ihn, dass sich das Leben auf dem Mond, sofern vorhanden, wegen der völlig anderen Umweltbedingungen stark vom Leben auf der Erde unterscheiden müsse.
Auch der in Weil der Stadt am Rhein geborene Astronom Johannes Kepler war dieser Ansicht, ging aber noch weiter. Zwar mischte er in seiner Erzählung »Somnium – seu opus posthumum de astronomia lunari« (1634 posthum erschienen) rein astronomische Überlegungen mit Gesellschaftsutopien und auch magischen Elementen. Dennoch gilt sie als erstes wissenschaftliches Werk über vergleichende Himmelskörperkunde. Kepler interpretierte die Strukturen auf der Oberfläche des Mondes als gigantische Bauwerke, die von den Mondbewohnern errichtet worden waren, um sich vor den Sonnenstrahlen, aber auch vor Feinden zu schützen. Und weil die Bauwerke so groß seien, schloss er, müsse der durchschnittliche Mondbewohner auch wesentlich größer sein als der Erdenmensch. In jedem Fall aber schlangenförmig, wie er schrieb.
Auch bei der Beschreibung des Alltags eines Mondwesens war Kepler recht fantasievoll. Ähnlich wie Eidechsen würden sie nämlich »zu ihrem Vergnügen« in der Sonne liegen, ganz in der Nähe ihrer Höhlen, um sich schnell verkriechen zu können. Kepler weiter: »Scharenweise durchqueren die Mondgeschöpfe während eines einzigen ihrer Tage ihre ganze Welt, indem sie theils zu Fuss, mit Beinen ausgerüstet, die länger sind als unsere Kameele, theils mit Flügeln, theils zu Schiff den zurückweichenden Wassern folgen.«3
Was sowohl Kepler wie auch von Kues, Bruno und Galileo trotz mehr oder weniger ausgeprägter Fantasie und trotz der Widerstände seitens der Kirche gelang: Sie lenkten den Blick von der Erde weg ins Universum, schufen ein neues Bewusstsein und weiteten den geistigen Horizont der damaligen Menschheit aus. Sie bereiteten damit den Weg für die moderne Astronomie. Und sie inspirierten Schriftsteller zu einem neuen literarischen Genre: der Science-Fiction. Die bereits angesprochenen Schriften von Godwin und Wilkens waren nur die ersten bekannteren Werke dieses neuen Genres, denen noch viele weitere folgen sollten. Bis hin zu Jules Verne (1828–1905), dessen »Reise zum Mond« von 1870 wesentlich von den Gedanken der Gelehrten aus der Renaissance beeinflusst war. Jules Verne wiederum prägte frühe Raumfahrtpioniere wie Hermann Oberth, Rudolf Nebel oder Wernher von Braun, die die uralte menschliche Fantasie einer Reise zum Mond schließlich wahr werden ließen.