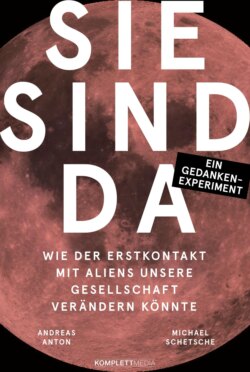Читать книгу Sie sind da - Michael Schetsche - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die moderne Science-Fiction
ОглавлениеAb Ende des 19. Jahrhunderts beeinflusste die immer rasantere technische Entwicklung auch das Nachdenken über Außerirdische. Der Glaube an Fortschritt und Wissenschaft war immens, technologische Entwicklungen wie die Elektrizität, das Automobil oder das Telefon wurden von vielen als Wunder aufgefasst und schraubten Erwartungen und Hoffnungen der Menschen im wahrsten Wortsinne in den Himmel.
Andererseits gab es berechtigte und auch irrationale Ängste vor einer Welt, in der sich der Mensch immer mehr zum Sklaven der Technik macht. Der modernen Technik wurde zugetraut, dass mit ihr utopische Gesellschaften verwirklicht, aber auf der anderen Seite auch die gesamte Menschheit vernichtet werden könnte. Dieses ambivalente Verhältnis zum technischen Fortschritt war und ist ein zentrales Motiv der Literaturgattung Science-Fiction, wo all diese Hoffnungen und Ängste auch auf fiktionale Außerirdische projiziert werden. Die Gattung erlebte in dieser Zeit ihren ersten Boom, nicht allein wegen des schon erwähnten Jules Verne.
Besonders beliebt ist das Motiv von technisch überlegenen Außerirdischen, die sich kriegerisch gegen die Erde und die Menschheit richten. Allen voran ist hier »Krieg der Welten« von H. G. Wells (1866–1946) aus dem Jahr 1898 zu nennen. Die Geschichte sorgte schon bei ihrer ersten Veröffentlichung für reichlich Aufsehen (1901 erschien auch eine deutsche Übersetzung), und dann noch einmal, als der Filmregisseur Orson Welles, inspiriert durch H. G. Wells’ Romanvorlage, am 30. Oktober 1938 ein Hörspiel für das Radio produzierte. Es war so realistisch gemacht, dass nicht wenige Radiohörer es für die Nachrichtensendung zu einer tatsächlichen Invasion von Marsianern hielten.
Der Stoff wurde außerdem einige Male verfilmt, zum Beispiel im Jahr 2005 von Regisseur Steven Spielberg mit Tom Cruise in der Hauptrolle. Die Story ist einfach: Die deutlich höher entwickelten Marsianer überfallen die Erde, um deren Rohstoffe auszubeuten. Sie tun das mit mitgebrachten dreibeinigen Kampfmaschinen, sogenannten Tripods, die auf die Menschen monströs und unheimlich wirken. Kaum auf der Erde gelandet, zerstören die Marsianer Städte, Straßen und Kommunikationsnetze. Die Menschen sind in allen Belangen unterlegen. Sie rettet schließlich der Zufall und ein sehr, sehr kleiner Verbündeter: Irdische Bakterien befallen die außerirdischen Invasoren und töten sie.
Dass die Invasoren vom Mars kommen, ist kein Zufall. Um die Jahrhundertwerde gab es in der Science-Fiction-Literatur, aber auch in der Wissenschaft, einen regelrechten »Marsboom« und die westliche Welt war fasziniert von der Vorstellung, dass der Mars Leben – vielleicht sogar intelligentes Leben – beherbergen könnte.
Angestoßen hatte den Boom der italienische Astronom Giovanni Schiaparelli (1835–1910), der 1877 die sogenannten Marskanäle entdeckte. Also geologische Strukturen, Canyons oder Abstufungen im Gelände auf der Oberfläche des Planeten. Schiaparellis französischer Kollege Nicolas Camille Flammarion (1842–1925) entwickelte daraufhin eine beachtliche Fantasie und verfasste 1892 das Buch »La Planète Mars«, in dem er schrieb, diese Kanäle seien von einer hoch entwickelten Kultur erbaut worden. Die Bücher – 1909 erschien sogar noch ein zweiter Teil – fanden reißenden Absatz. Auch wenn die meisten der Kanäle mittlerweile als natürliche Strukturen und optische Täuschungen entlarvt waren. Die Begeisterung für das (und der Grusel vor dem) Leben auf dem Mars war nicht mehr aufzuhalten.
Dass die vom US-amerikanischen Sender CBS ausgestrahlte Radiosendung »Krieg der Welten« von Orson Welles für so große Furore sorgte, hat auch mit der Machart zu tun. Welles ließ einen Reporter die Einzelheiten und Vorgänge der Invasion schildern, es wirkte wie die Berichterstattung von einem realen Ereignis. Andere aktuelle Informationsmöglichkeiten gab es damals nicht, was die Sache so brisant machte. Zwar gab es vor und während der Sendung entsprechende Hinweise, die aber offensichtlich viele Hörer nicht mitbekamen. Viele hielten die Alien-Invasion für echt und gerieten in Panik. Es gab keine Massenpanik, wie später mitunter kolportiert wurde, aber es war doch einiges los: Bei manchen Polizeistationen brachen in jener Nacht die Telefonleitungen zusammen, verängstigte Menschen liefen auf den Straßen herum und schützten sich mit feuchten Tüchern im Gesicht vor dem Giftgas der Marsianer. Einige besonders eifrige Männer erkundigten sich danach, wie und wo man sich dem bewaffneten Widerstand anschließen könne.8
Sowohl H. G. Wells’ Romanvorlage als auch die Radiosendung zu »Krieg der Welten« aus dem Jahr 1938 verweisen auf bemerkenswerte Entwicklungen im Hinblick auf das Verhältnis zwischen Menschen und Außerirdischen: Der Roman steht für die Tendenz in der Science-Fiction-Literatur, die Außerirdischen immer mehr als handelnde Akteure zu beschreiben, die mit den Menschen kommunizieren und interagieren. Sie haben Ziele und Motive, verfolgen ihre Interessen. Das macht sie zur Projektionsfläche für allerlei menschliche Sehnsüchte, Hoffnungen und Ängste. Und zum idealen Erzählrahmen für menschliche Erfahrungen und Emotionen, aber auch für Gesellschaftsentwürfe sowie für philosophische und politische Überlegungen. Und für Utopien und Dystopien. Die Reaktionen auf die Radiosendung geben ebenfalls wichtige Hinweise: Offensichtlich glaubte man in den USA im Jahr 1938 so stark an die Existenz außerirdischer Zivilisationen, dass ein Angriff von Invasoren aus dem All zumindest von einigen Hörern der CBS-Radiosendung für eine reale Möglichkeit gehalten wurde. So drangen die imaginierten Außerirdischen plötzlich als reale Bedrohung in das Alltagsleben dieser Menschen ein – wenn auch nur für wenige Stunden.
Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurden Außerirdische ein immer wichtigeres (und bisweilen auch überaus profitables) Element von Science-Fiction-Erzählungen – heute sind sie aus dem Genre gar nicht mehr wegzudenken. Das Thema ist bis heute so reizvoll, weil die Figur des Außerirdischen das »maximal Fremde« darstellt. Das eröffnet dem Menschen einen grenzenlosen Raum für kreative Schöpfungen. In die Außerirdischen lässt sich eben beliebig viel (oder eben wenig) hineinprojizieren: Aussehen, Interessen, Motive, Emotionen und so weiter. Sie könnten für die Menschheit Retter, Erlöser, Heilsbringer, aber auch gnadenlose Eroberer, kaltblütige Zerstörer und erbarmungslose Herrscher sein. Alles ist möglich.
Besonders wirkungsvoll tritt uns in unseren Fantasien über außerirdische Wesen die Ambivalenz der Begegnung mit Fremden entgegen, wie sie von dem Soziologen Zygmunt Bauman beschrieben wurde: »Fremde bedeuten das Fehlen von Klarheit, man kann nicht sicher sein, was sie tun werden, wie sie auf die eigenen Handlungen reagieren würden; man kann nicht sagen, ob sie Freunde oder Feinde sind – und daher kann man nicht umhin, sie mit Argwohn zu betrachten«.9 Diese Unsicherheit wird umso größer, je fremder uns ein Gegenüber ist. Oder umgekehrt: Mit zunehmender Fremdheit eines Gegenübers steigt die Zahl potenzieller (positiver wie negativer) Verhaltensmöglichkeiten.
Für Außerirdische gilt dies in besonderer Weise. Sie sind uns derart fremd, dass ihr Verhalten uns gegenüber zunächst in keiner Weise vorhergesagt werden und dann, im konkreten Fall, die unterschiedlichsten Formen annehmen kann. Und so erzeugt der Außerirdische im Roman oder im Spielfilm ein enormes Spannungsfeld: zwischen Neugierde, Hoffnung und Sehnsucht einerseits, aber auch Angst, Panik und Verzweiflung andererseits. Der »maximal Fremde« sorgt für das maximal mögliche Spannungsfeld in Bezug auf potenzielle Verhaltensweisen.
Die Darstellungen der Außerirdischen wie auch ihr jeweiliges Verhalten uns Menschen gegenüber sind im Genre Science-Fiction deswegen höchst unterschiedlich. Wir kennen aus Büchern, Serien und Filmen sowohl bösartige, hinterhältige und mörderische als auch sympathische, gutmütige und hilfsbereite Aliens. Man denke nur an den freundlichen, liebenswerten Außerirdischen »E. T.« aus dem gleichnamigen Film von Steven Spielberg, der ein Millionenpublikum zu Tränen rührte. Und auf der anderen Seite des Spektrums etwa an die gruseligen insektenartigen Kreaturen aus den »Alien«-Filmen. Diese fiktionalen Figuren aus dem All konfrontieren die Menschheit »mit positiven wie auch negativen Gegenentwürfen zur menschlichen Natur und Zivilisation«10, wie der Literatur- und Filmwissenschaftler Matthias Hurst schreibt. Das Verhältnis von Gut zu Böse ist dabei laut Hurst in der Fiktion sehr unausgeglichen. Einem Außerirdischen mit guten Absichten stehen gleich neun gegenüber, die sich feindselig verhalten.
Im Film »Stargate« von 1994 herrscht ein Außerirdischer wie ein ägyptischer Gott über menschliche Sklaven, während die Aliens in »Starship Troopers« (1997) als aggressive, heimtückische Rieseninsekten Krieg gegen die Menschen führen. In der Serie »Star Trek« begegnen uns Hunderte verschiedene außerirdische Spezies. Da gibt es Lebensformen, die aus Gas oder lediglich aus Energie bestehen. Es gibt katzen-, vogel- oder reptilienartige Außerirdische bis hin zu transdimensionalen Wesen. Es gibt die »Borg«, eine unheimliche, technisch weit entwickelte, halb organische, halb kybernetische Spezies, die über ein kollektives Bewusstsein verfügt und jede Individualität auslöscht. Auch in der Reihe »Star Wars«, einem der kommerziell erfolgreichsten Filmprojekte aller Zeiten, gibt es zahlreiche unterschiedliche außerirdische Völker, die sich, eingebettet in die Handlung eines klassischen Heldenepos, in einem andauernden Kampf zwischen Gut und Böse befinden.