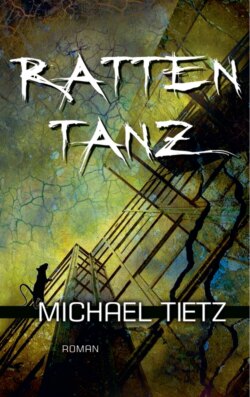Читать книгу Rattentanz - Michael Tietz - Страница 16
11
Оглавление10:21 Uhr, Krankenhaus Donaueschingen, Haupteingang
Der geräumige Eingangsbereich der Klinik hatte sich währenddessen in eine Hexenküche verwandelt. Immer mehr Leicht- und Schwerverletzte kamen aus der Stadt und der nahen Umgebung. Es kamen Patienten, die sich bei dem Versuch, die offensichtlich defekten Wasser- und Stromanschlüsse zu reparieren, verletzt hatten, Menschen, denen der abrupte Verlust ihrer gewohnten Lebensumstände (kein Radio, kein Fernsehen, keine Telefon- und Internetverbindungen, keine funktionierende Kaffeemaschine, keine Mikrowelle, kein Licht) der maßen zusetzte, dass sie von Angehörigen mit Herzrasen oder Atemnot eingeliefert wurden. Bei der Mehrzahl der Kranken handelte es sich allerdings um Unfallopfer.
Ausgefallene Ampelanlagen waren zwar die einzige direkte Auswirkung des nunmehr schon dreistündigen Stromausfalls, jedoch führten Verunsicherung und Angst dazu, dass Verkehrsregeln plötzlich nicht mehr anerkannt wurden, die Autofahrer unkonzentriert fuh ren oder aber ein Verhalten zeigten, das ihnen im Normalfall völlig fremd gewesen wäre. Die sich schnell herumsprechende Nachricht von den abgestürzten Flugzeugen tat ein Übriges, um aus Ordnung Chaos und aus dem antrainierten Miteinander einer funktionierenden Gesellschaft ein egoistisches Gegeneinander zu machen.
Der große Wartebereich am Haupteingang hatte sich mit Leichtverletzten, vor allem aber mit Angehörigen gefüllt, die sich aus Sorge um ihre Kranken und abgeschnitten von jeder Kommunikationsmöglichkeit auf den Weg gemacht hatten, in der Klinik nach ihrem Mann, der Frau, einem Elternteil oder Kind zu sehen. Erschienen zuerst nur wenige Menschen, so strömten jetzt immer mehr in das Haus, wie von einem unsichtbaren Magneten angezogen. Als nun das Stimmen gewirr immer lauter und ungeduldiger wurde, sah sich der Klinikleiter genötigt einzugreifen. Verwaltungsleiter Tröndle stieg auf einen niedrigen Tisch, von dem man eilig die Blumenkübel geräumt hatte, und versuchte Ordnung in das zunehmende Chaos zu bringen. Obwohl er nach mittlerweile fünfzehn Jahren in verschiedenen leitenden Positionen gewohnt war, vor größeren Menschenansammlungen zu sprechen, kam er sich doch seltsam vor. Er war mittelgroß, schlank und die grauen Haare, die der Endvierziger vermehrt bei sich entdeckte, hatte er letztens tönen lassen. Wie immer trug Tröndle einen tadellos sitzenden dunklen Anzug. Nur die grellgelbe Krawatte, von seiner Frau ausgesucht, wirkte dem Ernst der Lage nicht angemessen.
»Hören Sie!«, probierte er, sich Aufmerksamkeit zu verschaffen. »Hören Sie bitte! Wir haben alles im Griff!« Die Gespräche verstummten. »Ihren Angehörigen geht es gut. Der Klinikbetrieb läuft dank unserer Notstromaggregate reibungslos weiter. Auch die Versorgung unserer Kranken ist gesichert.« Das Pochen in seinen Schläfen ließ nach. Allmählich fühlte er sich wieder Herr der Lage. »Im Haus befinden sich Medikamente und Nahrung, die, sollte nicht bald alles wieder beim Alten sein, mehrere Tage reichen werden. Bitte«, er zeigte auf vier im Hintergrund stehende Krankenschwestern, »bitte, wenn Sie Angehörige besuchen wollen, wenden Sie sich an die Schwes tern. Kranke oder Verletzte warten bitte hier. Wie Sie sehen«, Tröndles Blick wanderte durch den Raum, dann hatte er gefunden, wonach er suchte, »wie Sie sehen, kümmern sich hier zwei unserer erfahrenen Ärzte um die leichter Verletzten und sorgen für eine schnelle Aufnahme Schwerverletzter.« Aus den Reihen der Wartenden antwortete unzufriedenes Murmeln.
»Haben Sie auch Wasser?«, wollte eine junge Frau wissen, die mit ihrer kleinen Tochter an der Hand darauf wartete, dass man sie zu ih rem gestern am Blinddarm operierten Mann ließ.
Wasser – das bedeutete, dessen war sich der Klinikleiter bewusst, das wirkliche Problem in der momentanen Situation. Im Wirtschaftshof der Klinik befand sich zwar noch ein Vorrat von etwa fünfhundert Flaschen Mineralwasser, womit man die etwa einhundertachtzig Patienten des Hauses sicher zwei, drei Tage mit dem notwendigen Minimum an Flüssigkeit versorgen konnte. Aber was war mit den Toiletten? Diese waren jetzt schon ein Problem, da die Patienten sie zwar weiterhin benutzten, aber nicht mehr spülen konnten. Aus dem zweiten Stock wurden bisher vier, aus dem ersten zwei verstopfte Toiletten gemeldet und überall ekelten sich Patienten davor, den Exkremen ten des vorigen Benutzers die eigenen Ausscheidungen hinzuzufügen.
»Die Versorgung unserer Patienten mit ausreichend Flüssigkeit ist kein Problem!«, antwortete Tröndle. »Fließend Wasser haben zwar auch wir nicht, aber ich denke, dass sich die Situation bald wieder normalisieren wird und …«
»Wissen Sie, was überhaupt los ist?«, wurde er unterbrochen. Er war dem Fragesteller fast dankbar. »Wissen Sie, warum nichts mehr funktioniert? Und stimmt das, was man erzählt – das mit den Flugzeugen?« Die Fragen kamen von einem älteren Mann mit verbundener Hand. Seine tiefe Schnittwunde am linken Zeigefinger, die er sich gegen acht Uhr bei dem vergeblichen Versuch zugezogen hatte, nach Großvätersitte eine Scheibe Brot abzuschneiden, hatte man gerade genäht.
»Ja«, antwortete Tröndle »das mit den Flugzeugen scheint wahr zu sein. Es sind inzwischen zwei Überlebende schwer verletzt eingeliefert worden, deren Maschine bei Blumberg zerschellte. Sie werden gerade operiert. Und auf Ihre andere Frage: nein, wir wissen nicht, was los ist. Wir wissen leider auch nicht mehr als Sie. Es tut mir leid.« Er klang hilflos.
In diesem Moment hörten alle einen gellenden Schrei. Das Gemur mel der vielen erstarb schlagartig und man hätte eine Stecknadel zu Boden fallen hören können.
Dann ein zweiter Schrei, länger anhaltend, der in haltloses Schluchzen überging und schnell näher kam.
Tröndle, noch immer auf seiner erhöhten Position, sah fragend zu einem Mann aus der Finanzabteilung seiner Klinik, der am Ausgang zum Treppenhaus stand. Der zuckte nur die Schultern, als von den Las tenaufzügen her Schreie schnell näher kamen. Eine Frau stürzte in den Wartebereich und fiel einem der Ärzte in den Arm.
»Da, da«, schluchzte sie und zitterte wie ein Blatt im Wind, »da hinten!«
»Ganz ruhig«, sagte der Arzt. »Ganz ruhig. Atmen Sie tief und langsam und beruhigen Sie sich.«
Die Umstehenden vergaßen für einen Moment ihre Sorgen und warum sie hier waren und rückten näher. Der hinzugekommene Tröndle, die weinende Frau und der Arzt waren bald von einem dichten Ring neugieriger Gesichter umschlossen.
10:36 Uhr, Krankenhaus Donaueschingen, Aufzug 2
Der Schrei einer Frau sprang ihn völlig unvermittelt und aus heiterem Himmel an. Thomas Bachmann hatte den Worten seiner Nummer eins geglaubt (Es ist vorbei, Thomas! Das Böse ist weg!) und die vermeintliche Sicherheit der kalten Aufzugecke verlassen. Es hatte ihn unsägliche Mühe und Überwindung gekostet, die Fäuste von den Ohren zu nehmen und sich zur Tür der Kabine vorzutasten, wo seine schwarze Aktentasche auf ihn wartete. Er hatte Durst, so großen Durst und in seiner Tasche lag die silberne Thermoskanne, ohne die er niemals irgendwohin ging. Die Kanne war gefüllt mit heißem Melissentee. »Trinken Sie regelmäßig Melissentee«, hatten sie ihm in der Psychiatrie geraten. »Der wird Ihnen Ruhe geben.«
Gerade berührten seine Finger die vertraute Oberfläche der Tasche. Sie fühlte sich schwarz an, also war es seine Tasche, denn Nummer zwei war der Meinung, dass in der Dunkelheit der Kabine die Tasche vielleicht ausgetauscht worden sei.
Thomas’ Fingerspitzen wanderten über das weiche Leder. Es erschien ihm warm und etwas rau, genau so, wie sich schwarz anfühlt.
Dann gellte ohne jegliche Vorwarnung der Schrei. Von weiter oben, aber nicht sehr weit entfernt schrie eine Stimme voller Entsetzen. Dann schnelle Schritte und noch ein Schrei!
Thomas’ Finger zuckten von der Aktentasche zurück als hätten sie sich verbrannt. Er presste seine beiden Fäuste wieder gegen die Ohren und krabbelte in seine Ecke zurück. Mit dem Gesicht zur Wand und angezogenen Knien versteckte er sich.
Schließlich verfiel er in jammerndes, leises Stöhnen und bewegte dazu den Oberkörper vor und zurück, vor und zurück, wie in Trance. Vor und zurück.
Die Frau war im Treppenhaus einmal falsch abgebogen und so vor der halb offenen Aufzugtür gelandet, von wo aus sie einen vollkommen unvorbereiteten Blick in die etwas tiefer stehende Kabine werfen konnte. Dort saß Anton Banholzer tot in seinem Bett. Die Techniker hatten vor die gewaltsam zur Hälfte geöffnete Tür ein Band geklebt und den Hinweis »Außer Betrieb« angebracht. Auch hatte man die Leiche mit einem Bettlaken abgedeckt. Da keiner wusste, wie man mit dem Toten weiter verfahren sollte, die aufgelöst weinende Krankenschwes ter beruhigt werden musste sowie ein weiterer stecken gebliebe ner Aufzug und immer mehr Kranke und Besucher nach den Techni kern und dem Arzt verlangten, hatte man Anton Banholzers herun terhängende Beine unter die Decke gesteckt, ein Laken über ihm ausgebreitet und besagten Hinweis angebracht.
Das Laken war vom Gesicht des aufrecht im Bett Sitzenden herabgerutscht. Seine Gesichtszüge hatten sich entspannt, aber aus den weit aufgerissenen Augen sprachen noch immer Todesangst und Entsetzen und sprangen, als die Frau in die halb offene Tür trat, in ihre Augen über. Sein Kopf war nach rechts auf seine Schulter gerutscht, sodass eine dünne Speichelspur aus seinem Mundwinkel auf die Brust getropft war und dort langsam trocknete. Seine Zunge, ebenfalls nach rechts verrutscht, sah inzwischen trocken und aufgequollen aus.
»Da liegt ein Toter im Aufzug!« Sie wirkte verwirrt, als sie mit dem Arzt sprach. Die Umstehenden saugten jedes Wort begierig auf. »Er sitzt im Aufzug in einem Bett und seine Augen …« Die Frau schluchz te hemmungslos. »Die Augen haben mich angesehen!«