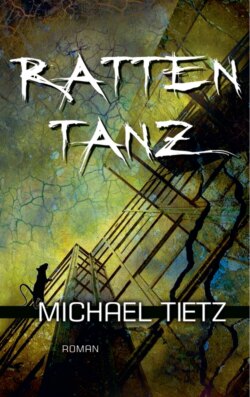Читать книгу Rattentanz - Michael Tietz - Страница 17
12
Оглавление11:23 Uhr, Donaueschingen, Polizeirevier
Viel schneller, als pessimistischste Soziologen wohl jemals vermutet hätten, brachen die gesellschaftlichen Klammern, die das tägliche Leben ordneten. Dass alles so schnell ging, war mit einiger Sicherheit den diversen Flugzeugabstürzen zuzuschreiben.
Das Zusammentreffen des totalen Strom- und Wasserausfalls, verbunden mit dem Verlust sämtlicher Kommunikationsmöglichkeiten allein wäre wohl nicht in der Lage gewesen, innerhalb weniger Stunden dieses Bild vollkommener Anarchie zu malen. Die vom Himmel stürzenden Maschinen aber, die hautnah erlebten Katastrophen, bei denen Hunderte Menschen in gleißenden Feuerbällen verbrannten, das Gefühl der Ohnmacht beim Versuch, Hilfe zu rufen oder selbst zu leisten, all das führte selbst unverbesserlichen Optimisten und obrigkeitstreuen Befehlsempfängern (im Normalfall die Letzten, die ein Desaster zugaben) vor Augen, um was es sich handelte: um eine Katastrophe unvorstellbaren Ausmaßes!
Polizeihauptmeister Joachim Beck stolperte kurz nach halb elf mit gebrochener Nase ins Polizeirevier der Stadt. Sein Atem ging laut und rasselte wie eine zum Angriff bereite Klapperschlange. Er verriegelte die Tür, lehnte sich mit dem trügerischen Gefühl der Sicherheit gegen sie und schloss endlich die Augen. Becks Nase saß, im Gegenteil zu heute morgen, als alles noch seine anatomische Richtigkeit hatte, etwas schief im Gesicht des Achtundzwanzigjährigen. Und sie nahm langsam die Form einer blutigen Kartoffel an. Das rechte Auge war rot unterlaufen und halb zugeschwollen.
Joachim Becks Motivation, in den Polizeidienst einzutreten, war profaner Art, familiärer Natur kann man sagen. Als jüngstes von drei Kindern war er für seinen älteren Bruder kaum existent. Elf Jahre lagen zwischen ihnen und das einzige gemeinsame Spiel, an das Beck sich noch erinnern konnte, war »Cowboy und Indianer«. Natürlich waren sein Bruder und dessen Freunde die siegreichen Eroberer. Ihm steckten sie ein paar Hühnerfedern ins Haar, malten mit Schlamm braune Streifen auf seine Wangen, banden ihm die Hände auf den Rücken und zerrten ihn nackt bis auf die Windeln, die er damals noch immer trug, zu einem Kirschbaum. Hier sollte der kleine Wilde hängen. Noch heute spürte er das derbe Seil, das sie ihm um den Hals legten und hätte ihn damals jemand gefragt, er hätte Stein und Bein geschworen, dass es das schon wieder war mit dem Leben. Aber sie hatten ihn nicht aufgeknüpft, nur gemeinsam über seine randvolle Windel gelacht.
Ganz anders Manuela, seine Schwester. Vor ihr hatte er Angst und sie war der eigentliche Grund für Becks Polizistenkarriere. Manuela war bei seiner Geburt acht Jahre alt gewesen. Der kleine Bruder kam einem Mädchen, welchem die abgeliebten Babypuppen bereits zu kindisch und ein eigenes Baby noch versagt waren, wie gerufen. Manuela nahm ihn mit der Selbstverständlichkeit einer Frühreifen in Besitz. Er hatte ihre Mutterinstinkte geweckt und fortan kaum mehr Gelegenheit, diesen zu entkommen. Sie schob ihn spazieren und präsentierte ihn stolz ihren Freundinnen. Jede durfte ihn anfassen und später auch seine Windeln wechseln. Manuela degradierte ihren kleinen Bruder zu einem Spielzeug; einem besonderen Spielzeug, einem lebenden Spielzeug.
Mit dreizehn, vierzehn begann sie sich langsam zu verformen. Sie bekam Brüste, groß wie Melonen, und ihre Hüften wurden breit und immer breiter. Es war, als habe sich der Körper des Mädchens den Vorgaben ihres Charakters entsprechend verändert und zu einer mütterlichen Glucke wie ihr gehörten die Rundungen einer reifen Matrone. Sie klemmte sich den kleinen Bruder zwischen die wogenden Brüste und liebkoste ihn ohne Rücksicht auf die drohende Erstickung. Mit sechzehn war er immer noch ihr Baby, ihr Kleiner, ihr Süßer. Tatsächlich war sie fast einen halben Kopf größer als er – keine Kunst, wenn man selbst nicht einmal einssiebzig misst.
Joachim Beck bewarb sich gegen den Willen seiner großen Schwester zum Polizeidienst. In seinen Augen war dies der einzige Weg, sich von ihr zu lösen, sie von sich zu lösen. Weder Recht noch Ordnung, weder Demokratie oder Waffen oder, wie viele seiner Kameraden damals vermuteten, Autoritätsgier waren maßgebend. Der einzige Grund war Manuela, seine viel zu große Schwester.
Heute hörte er nur noch selten von ihr. Sie hatte, nachdem er das Elternhaus endgültig verlassen hatte, geheiratet und schnell hintereinander drei Kinder in ihre Welt gesetzt. Diese durften jetzt ihre Mütterlichkeit genießen.
Bei seinen Kollegen war er angesehen. Die anfänglichen Witze über den abgebrochenen Riesen mit dem dünnen Bärtchen, der wie ein halb fertiger Rahmen den Mund einschloss, waren verstummt. Alle akzeptierten ihn. Er hatte sich freigeschwommen.
Von der Straße her drangen wütende Rufe in das Gebäude.
»Mein Gott, was ist mit dir passiert? Wo sind di Sario, Wegmann und Meinhoff?« Kommissar Storm, durchtrainierter Endvierziger mit kahlgeschorenem Schädel, betrachtete entsetzt das Gesicht seines Untergebenen. Sein Blick wanderte über die zerrissene Uniform zu den Füßen Becks, an denen ein Schuh fehlte. Die Mütze des Polizisten konnte er ebenfalls nicht entdecken.
»Wo ist deine Waffe?« Das dunkelbraune Lederhalfter unter Becks linker Achsel war leer. Beck schüttelte stumm den Kopf, was er aber sofort bereute. Er erstarrte mitten in der Bewegung, hoffte, so die durch seinen Schädel polternden Schmerzen zu beruhigen.
»Haben wir noch irgendwo Eis?«, fragte er zurück und zeigte auf seinen Kopf.
Storm, Kommissar und an diesem Vormittag Dienstgruppenleiter des Donaueschinger Reviers, brachte aus dem kleinen Kühlschrank im Aufenthaltsraum eine letzte Handvoll schmelzender Eiswürfel, eingewickelt in einen Plastikbeutel. In der Pfütze vor dem Kühlschrank rutschte er aus und konnte seinen Sturz nur dadurch verhindern, dass er sich an einem Regal festhielt, das daraufhin bedrohlich schwankte, sich neugierig nach vorn beugte, es sich letztendlich dann aber doch anders überlegte und in seine alte Position zurückkehrte. Dabei schüttelte es die alte Kaffeemaschine ab, deren Kanne zerplatzte wie ein überreifer Pickel.
»Mist!«, fluchte der Kommissar.
In diesem Moment, Beck lehnte weiter mit dem Rücken an der Tür und streckte gerade die Hand nach dem Eisbeutel aus, den ihm der Revierleiter entgegenhielt, zerbarst eine der vergitterten Fensterscheiben. Scherben tanzten über den Boden und reflektierten das Sonnenlicht. Ein faustgroßer quadratischer Pflasterstein rollte aus und blieb in der Mitte des Raumes liegen. Fast im selben Augenblick wurde ge gen die Tür des Reviers gehämmert und getreten. Die Tür zitterte und bebte und Beck sprang von ihr weg, als habe er sich den Rücken verbrannt.
»Ist hinten alles zu?« Beck meinte den zweiten Eingang ins Gebäu de, eine Doppeltür, die vom Hinterhof, auf dem die meisten hier ihre Autos und Fahrräder abstellten, durch einen schmalen Flur mit dem Revier verbunden war.
Storm drehte sich ohne eine Antwort zu geben um und rannte zum Hintereingang. Als er den kühlen Flur betrat, der zum Hintereingang führte, sah er aus dem Augenwinkel eine Bewegung. Durch die seltsamerweise weit offen stehende Tür zum Hinterhof fielen Sonnenstrahlen. Staub tanzte in dem aufgefächerten Lichtkegel und am Boden lag eine Eisenstange. Storms Hand ging automatisch zum Halfter. Er versuchte zu erkennen, was die Bewegung verursacht hatte und wich einen Schritt zurück, aber die kühle Hauswand hielt ihn auf. Aus dem Dunkeln traf ein Faustschlag den Kommissar präzise am Kinn. Storms Kopf knallte mit einem hohlen Geräusch gegen die Wand. Augenblicklich wurde es dunkel um ihn, seine Knie gaben nach und langsam rutschte er auf den kalten Boden. Sein Hinterkopf hinterließ eine dünne Blutspur.
Drei Stunden vorher
Nach dem konzertierten Strom-, Telefon- und Computerausfall hatte Revierleiter Frederik Salm, seines Zeichens Erster Polizeihauptkommissar, seine Mitarbeiter am Morgen zusammengerufen. Als Erstes hatte er seine Sekretärin angebrüllt, die wohl einen Tick zu lange gebraucht hatte, die Unterlagen herauszusuchen, welche Anweisungen für Stromausfallsituationen gaben. Den gewichtigen Aktenordner mit den Instruktionen hatte er ihr aus der Hand gerissen und vor sich auf den Tisch geknallt.
Insgesamt arbeiteten achtundfünfzig Polizisten in fünf Schichten im Streifendienst. Von den zwölf Frauen und Männern, die an diesem Morgen Dienst taten, befanden sich noch acht im Revier, der Rest war bereits auf Streife, bei Verkehrskontrollen und einem Einsatz in Hüfingen, wo kurz vor sieben die Haushälterin des Pfarrers die Ordnungs hüter angerufen hatte, da die Kirche nun schon zum dritten Mal in diesem Frühjahr mit riesigen Graffiti verunstaltet worden war. Die acht Polizisten, fünf Schreibkräfte und vier weitere Innendienstmitarbeiter waren dem unüberhörbaren Ruf ihres cholerischen Chefs gefolgt und hatten sich im Besprechungsraum versammelt. Mit hochrotem Kopf hatte der übergewichtige und permanent schwitzende Salm in den Unterlagen gewühlt und schließlich eine seitenlange Anweisung hervorgekramt, die die Verkehrslenkung als oberste Priorität in solchen Fällen vorschrieb.
»Storm«, hatte er den Dienstgruppenleiter angefahren und dabei, wie immer, wenn er unter Stress stand, den Dienstgrad unterschlagen, »holen Sie einen Stadtplan. An allen großen Ampelkreuzungen will ich zwei Leute haben.«
»Was ist mit den Leuten, die schon draußen sind? Funktionieren die Handys inzwischen wieder?«
Die Sekretärin, Fräulein Meyer, hatte den Kopf geschüttelt.
»Sie bleiben hier im Revier, Storm, und teilen die, die zurückkommen, neu ein. Außerdem will ich«, er hatte sich den Innendienstmitarbeitern zugewandt, »dass Sie sich zum Rathaus, zur Feuerwehr, ins Krankenhaus und zum Bahnhof aufmachen. Wenn jemand etwas über dieses Chaos heute Morgen rausbekommt oder irgendwo Hilfe benötigt wird: herkommen! Fräulein Meyer, Sie setzen sich in Ihren Wagen und klappern alle Kollegen ab, die heute frei haben. Auch die, die erst zur Spät- oder Nachtschicht erscheinen müssten. Jeder, der nicht gerade tot im Bett liegt, soll sofort hier aufkreuzen. Verstanden?«
Die Sekretärin hatte genickt und wollte sich schon auf den Weg machen.
»Vergessen Sie Ihre Adressliste nicht oder wissen Sie aus dem Kopf, wo jeder wohnt?«
»Was ist mit Streife?« Kommissar Storm hatte die Anweisungen seines Chefs auf einem Zettel notiert und sah ihn dann fragend an.
»Sollten wir nicht wenigstens eine Streife rausschicken, die die Geschäfte der Innenstadt und die Banken kontrolliert?«
»Sehr gut, Storm. Aber ihr fahrt heute zu viert. Zwei Leute sind zu wenig, wenn man nicht in der Lage ist, Unterstützung zu rufen.«
So hatte jeder eine Aufgabe erhalten und machte sich mit dem Gefühl auf den Weg, noch immer Herr der Lage zu sein oder wenigstens bald wieder werden zu können.
Hauptmeister Joachim Beck wurde zusammen mit Sarah di Sario, Werner Meinhoff und Christian Wegmann zur Streife eingeteilt. Als sie den Hof des Reviers verlassen hatten, war es bereits kurz vor neun gewesen und die meisten Hauptausfallstraßen der Stadt schon heillos verstopft. Richtung Innenstadt ging es ebenfalls nur langsam voran. Menschen standen in kleineren und größeren Gruppen zusammen. In haber größerer Geschäfte oder solcher mit besonders wertvollen Auslagen hatte die Sorge um ihren Besitz schon früh in die nun ungesicherten Läden getrieben. Nach und nach waren Mitarbeiter und Passanten eingetroffen, aber keiner wusste das Warum der Katastrophe, keiner, wie es weitergehen sollte.
Der Streifenwagen wurde schon von der ersten Menschengruppe angehalten, auf die er traf. Es waren Anwohner und zwei, drei Ladenbesitzer. Beim Anblick der Uniformierten schöpften sie Hoffnung. Als ihnen aber klar wurde, dass die Gesetzeshüter genauso unwissend waren wie sie selbst, schlug die erwartungsvolle Freundlichkeit schnell in Zorn um, der sich in Beschimpfungen entlud: »Was fahrt ihr denn hier spazieren, wenn ihr von nichts Ahnung habt? Kümmert euch lieber um die Stromversorgung und die Telefone! Oder seht zu, dass die Straßen wieder frei werden, man kommt ja kaum noch irgendwohin!«
Beck und seine Kollegen fuhren weiter. Aber schon nach der nächsten Straßenbiegung wiederholte sich das Spiel. Sie wurden angehalten, zuckten bedauernd die Schultern und mussten erneut als Blitzableiter für die Angst und Wut der Menschen herhalten.
In Sichtweite wartete bereits die nächste Gruppe und aus einem der drei- und vierstöckigen Häuser, die am Ende des neunzehnten Jahrhunderts errichtet worden waren und die Straßen der Innenstadt nahtlos säumten, hatte ihnen eine alte Frau zugewunken. »Hilfe!«, schrie sie. »Ich bin überfallen worden!« und dabei wedelte sie mit beiden Armen aus einem Fenster unterm Dach und lehnte sich weit vor.
»Wenn die so weitermacht, flattert sie gleich los«, hatte Meinhoff leise gespottet. Dann, lauter und gut hörbar, hatte er der verständnislos blickenden Frau erklärt, dass sie einen anderen Auftrag hätten, dass aber, sobald alles wieder funktionieren würde, jemand vom Revier vorbeikäme.
Verfolgt von den Hilferufen und den Verwünschungen der alten Frau waren sie weitergefahren und vor der Filiale der Deutschen Bank ausgestiegen. Vor dem Haupteingang hatten sich gut zwei Dutzend Männer und Frauen versammelt, die vergebens versuchten, eingelassen zu werden. Hinter einer abgeschlossenen Glastür standen zwei Män ner im Anzug und hatten nur mit dem Kopf geschüttelt.
»Die lassen uns nicht rein!«, schimpfte ein älterer Herr und drohte mit seiner knorrigen Faust Richtung Eingang. »Nicht mal an den Geld automaten lassen die uns ran.«
Obermeister Werner Meinhoff, Leiter der Streife, hatte an die Glastür geklopft, während Beck, di Sario und Wegmann die Leute vorsichtig von der Tür abgedrängt und dabei beruhigend auf sie eingeredet hatten. So hatten sie es im Deeskalationsseminar gelernt. Mein hoff war inzwischen von den beiden Bankern eingelassen worden.
»Wir können die Bank nicht öffnen«, erklärten die Männer. »Abgesehen davon, dass wir ganz allein hier sind, können wir keinerlei Buchungen vornehmen. Die Computer streiken und wir haben keine Möglichkeit, den Saldo irgendeines Kontos abzufragen. Woher sollen wir wissen, ob die Leute überhaupt was abzuheben haben?«
»Davon ganz abgesehen kommen wir an keinen einzigen Euro ran. Im Kellertresorn liegt zwar reichlich Bargeld, aber die elektronischen Schlösser blockieren die Verriegelung. Ohne Strom und funktionierenden Computer können wir hier gar nichts unternehmen, selbst wenn wir wollten.«
Den Polizisten leuchteten die Argumente der Banker ein, nicht aber den Passanten auf der Straße. Den vielen Älteren unter ihnen, die während des Zweiten Weltkrieges und in den Hungerjahren danach aufgewachsen waren, steckte diese Kindheitserfahrung zu tief in den Knochen. Sie konnten nicht einfach nur dastehen und ruhig und im Vertrauen auf das Funktionieren der gewohnten Ordnung die weitere Entwicklung abwarten. Ihre erste Intuition war, das Eigentum zu sichern und die Vorräte zu kontrollieren. In einem Land, in dem alles zu jeder Zeit käuflich erwerbbar war, beschränkten sich die Vorräte zu Hause im Allgemeinen auf den Bedarf der kommenden zwei, drei Tage.
»Ich habe fünfunddreißigtausend Euro auf dieser Bank liegen und jetzt«, eine Frau kramte ihren Geldbeutel aus der Handtasche und hielt den Polizisten die fast leeren Fächer unter die Nasen, »jetzt habe ich nicht mal Geld, um ein Brot und Butter zu kaufen, so lange es noch etwas gibt.«
Vor der Volksbank war das Problem das gleiche, ebenso bei der kleinen Innenstadtfiliale der Sparkasse. Hier allerdings war die Lage beim Eintreffen der vier Beamten ein klein wenig anders. Eine Menschentraube von vielleicht vierzig Personen drängte gegen den Eingang, der im Gegensatz zu den anderen Banken weit offen stand. Als am Morgen der Strom ausgefallen war, hatten sich zwei Angestellte der Filiale im Tresorraum befunden. Eine der Frauen wollte, als das Licht ausging und ein leises Zischen der offen stehenden Tür das automatische Schließen ankündigte, schnell noch den Tresor verlassen. Sie war im Dunkeln Richtung Tür gerannt und hätte es fast geschafft, als sie über die Geldkassette stolperte, die sie selbst vor wenigen Minuten, zum Abtransport bereit, vor die Tür gestellt hatte. Sie rutschte über den glatten Steinboden wie eine gefallene Eiskunstläuferin und blieb genau im Türrahmen liegen. Ein leises Zischen der sich schließenden Tür, dann wurde ihr Brustkorb eingeklemmt. Das Knacken der brechenden Rippen ging in den gellenden Schreien der Frau unter, die von den eisernen kalten Wänden des Tresorraumes zurückgeworfen wurden. Sie schrie hoch und unvorstellbar laut, schrie in Todesangst und von niemals erwarteten Schmerzen gepeinigt. Rippen durch spießten die Lungen, die Tür drückte weiter. Die Schreie wurden schwächer, dann löste sie verzweifeltes Japsen ab.
Ihre Kollegin hatte noch versucht, die Frau zu retten. Sie stemmte sich gegen die Stahltür, aber umsonst – die am Boden Liegende wurde langsam zerquetscht, so aber auch das völlige Schließen des schweren stählernen Monstrums verhindert. Die Blutungen in ihrem Brustkorb und die unvorstellbaren Schmerzen ließen sie nach wenigen Minuten bewusstlos werden. Zwanzig nach sieben, in dem Moment, als der Leiter dieser kleinen Filiale das Gebäude betrat, war sie tot.
Der Filialleiter, vom verzweifelten Rufen der eingeschlossenen Mitarbeiterin in den Keller gelockt, mühte sich einige Minuten vergeblich, die Tür zu öffnen. Außer Atem und mit Schweißperlen auf der Stirn versuchte er telefonisch, Hilfe zu rufen. Schließlich wusste er sich nicht anders zu helfen, als die Kunden, die bereits vor der Bank warteten und an die Glastüren klopften, um Hilfe zu bitten. Er erwartete zwar noch einen weiteren Mitarbeiter, war sich aber sicher, dass sie ge meinsam immer noch zu schwach wären, die schwere Tür zu öffnen und die Frauen zu befreien. Was der Filialleiter nicht wusste war, dass sein verspäteter Mitarbeiter mit seinem Wagen einen kleinen Unfall hatte und deshalb diesen Tag gedachte, mit seinem Überstundenkonto zu verrechnen.
Zu siebt hatten sie es bis halb neun endlich geschafft, die Tür so weit aufzuhebeln, dass die Eingeschlossene den Tresorraum verlassen und die Leiche herausgezogen werden konnte. Danach überschlugen sich die Ereignisse in der kleinen Filiale.
Während der Filialleiter das Gesicht der Toten mit seinem Jackett zudeckte, war den Kunden der Inhalt des kleinen Raumes hinter der Stahltür aufgefallen. Im Lichtkegel der Taschenlampe, die der Leiter mit in den Keller gebracht hatte, sahen sie Geldpakete, Hartgeldrollen und einige kleine Goldbarren.
»Danke für Ihre Hilfe.« Der Filialleiter wollte die Menschen, die unruhig vor der Tresortür standen, nach oben schicken. »Könnte einer von Ihnen bitte zur Polizei gehen?«, hatte er gefragt.
»Wozu denn? Der ist nicht mehr zu helfen«, hatte ein Mann geantwortet, der nach Alkohol roch und sich gerade eine Zigarette ange zündet hatte. »Ich würde aber gern die dreihundertvierundzwanzig Euro abheben, die noch auf meinem Konto sind.«
»Tut mir leid, aber solange die Computer nicht funktionieren, kann ich nichts auszahlen. Außerdem«, fügte er mit einem Blick auf die Leiche der Frau hinzu, »weiß ich nicht, ob die Bank heute überhaupt noch öffnet. Wäre doch ziemlich pietätlos.«
»Pietät hin oder Pietät her«, hatte der mit der Zigarette herumgefuchtelt und war einen Schritt auf den Filialleiter zugegangen, »ich will jetzt mein Geld. Sofort!«
»Genau, ich will auch alles abheben!«
»Ich auch!«
»Und ich!«
Alle sieben – der Sozialhilfeempfänger, der nach Alkohol roch, ein Ehepaar Ende sechzig mit goldener Kette um den Hals (sie) und Mercedesschlüssel in der Hand (er), ein etwas verschlafen wirkender Teen, eine spindeldürre Ökotante, spätgebärend, mit dem Zwillingskinderwagen vor dem Filialeingang sowie zwei Männer einer Baufirma, die, nachdem ihnen ihr Chef heute frei gegeben hatte, auf dem Weg zurück nach Hause waren und gerade zufällig an der Bank vorbeikamen, als der Filialleiter um Hilfe rief – sie alle waren sich in ihrer Forderung nach sofortiger Auszahlung ihrer Guthaben erstaunlich einig.
»Bitte, versuchen Sie es doch in unserer Hauptniederlassung. Es sind doch nur ein paar Minuten von hier!« Doch sein Rat fiel auf unfruchtbaren Boden.
»Also, wenn Sie mir nichts geben wollen, hebe ich meine Kohle halt selbst ab.« Der Mann, der nach Alkohol roch, hatte seine Zigarette ausgetreten und wollte sich durch die schmale Öffnung in den Tresorraum zwängen. Der Filialleiter griff nach dem Stemmeisen, das die beiden Maurer in ihrem Auto gehabt hatten und welches beim Öffnen der Tür wertvolle Hilfe geleistet hatte. Jetzt klemmte es so zwischen Türrahmen und Tür, dass diese etwa dreißig Zentimeter weit offen ge halten wurde. Er zerrte, versuchte das Eisen zu entfernen. Das immense Gewicht aber, mit dem die Tür diesen Keil eingeklemmt hatte, machte sein Unterfangen aussichtslos.
So war es gekommen, dass der Sozialhilfeempfänger Hermann Fuchs, dreiundfünfzig, der erste Kunde dieses Morgens wurde. Dass er mit dem, was er abhob, sein Konto allerdings um fast zwanzigtausend Euro überzog, war ihm egal. Der Herr mit dem Mercedesschlüssel begnügte sich mit dreitausend Euro. Im Kundenbereich nahm er sich noch ein Blatt Papier und hinterließ dieses als Quittung auf einem der Schreibtische, ausgefüllt mit seinem Namen und Anschrift, dem abgehobenen Betrag und seiner Telefonnummer. Seine gewichtige Unterschrift nahm fast das gesamte untere Drittel des Bogens ein.
Die Kunde, dass diese Sparkassenfiliale heute besonders großzügig auszahlte, verbreitete sich dank der Hilfe des ersten Kunden zügig unter den Passanten in der Nähe.
Um 9:45 Uhr war dann die vierköpfige Polizeistreife eingetroffen und hatte dem Treiben ein Ende gesetzt. Aber, wie Meinhoff und Beck im Keller der Bank feststellen mussten, war der Tresor inzwischen leer. Nur einige wenige Papiere lagen noch am Boden. Sarah di Sario und Christian Wegmann, die oben den Haupteingang sichern sollten, schafften es nur mit Mühe und gezogenen Waffen, die gierige Menge auf Distanz zu halten.
»Ach, die Geldsäcke wollt ihr beschützen, was?«, rief eine junge Frau mit einem Dreijährigen auf ihrem Arm. »Sagt uns lieber, wann der Strom wieder kommt und warum die Flugzeuge abgestürzt sind. Sagt mir, wann ich endlich Geld abheben kann und wann der Lebensmittelladen da vorn wieder öffnet!« Wütend war die Frau, deren Kind inzwischen zu schreien begonnen hatte, auf di Sario zugegangen. Die hielt ihre Waffe in Richtung der Frau.
»Seht ihr das?«, rief die Frau den Umstehenden zu. »Bedroht eine Mutter mit ihrem Kind! Und du willst Polizistin sein? Pfui, schäm dich!« Sie spuckte Sarah di Sario ins Gesicht.
Die junge Polizistin, erstmals mit einer wütenden Menschenmenge konfrontiert, hatte daraufhin in die Luft geschossen. Wegmann sprang ihr noch in den Arm, ein weiterer Schuss löste sich und noch einer und die vierte Kugel, die Sarah di Sario abfeuerte, traf einen Zwölfjährigen, der etwas abseits auf seinem Fahrrad saß und neugierig zu sah, mitten in die Stirn. Er merkte nicht, dass er getroffen wurde, er fiel einfach nur mit seinem Fahrrad um.
Das Scheppern, mit dem der Drahtesel aufschlug, die glasigen Augen des Jungen und die Einschussstelle auf seiner Stirn, die wie ein drittes Auge genau mittig saß, ließen die inzwischen etwa einhundert Menschen erstarren. Es war fast völlig still, nur ein Motorroller knatterte vorbei und von den Dächern der Häuser war das Gurren balzen der Tauben zu hören, sonst nichts.
Sarah kamen die letzten Sekunden ihres Lebens endlos vor. Sie hatte den Stein langsam auf sich zufliegen sehen. Ein Mann mit Bart hatte ihn vom Gehweg aufgelesen und nach ihr geworfen. Sie sah seine Augen, die Augen eines wütenden Familienvaters, mit einem Zwölfjährigen zu Hause, dessen Fahrrad sie im letzten Winter zusammen repariert und neu lackiert hatten. In seinen Augen flackerte Hass.
Der Stein, er war oval, wie ihr auffiel, und schwarz und weiß marmoriert, zerschnitt langsam die Luft. Sie hatte das Geräusch genau gehört, das er hinter sich herzog und welches sie an Hubschrauberrotoren erinnerte. Je nachdem, wie der Stein sich drehte, machte er ein lauteres oder tieferes Geräusch. Zeitlupenbilder. Zeitlupengeräusche. Als der Stein sie an der Schläfe traf, schoss ein Reflex ihrer Hand das Magazin der Heckler Koch P7 leer. Vier Schuss befanden sich noch im Magazin, vier Treffer, fast alle in der vordersten Reihe. Dann traf sie eine Faust ins Gesicht, eine weitere in den Magen. Sie schoss weiter, aber die Waffe gab nur noch ein hohles Klicken von sich – die Sprache ihrer Wehrlosigkeit.
Als Wegmann die wütenden Gesichter der Menge sah, ließ er seine eigene Waffe fallen und hob die Hände. Eine alte Frau mit dünnen Lippen und Augen, die den Anschein erweckten als würden sie jeden Moment aus ihren Höhlen fallen, bückte sich nach der Waffe, zielte auf Wegmann und verlagerte den Inhalt des Magazins aus der Waffe in Christian Wegmanns Unterleib. Schreiend brach der zusammen, beide Hände fest auf die Wunden gepresst. Dann überrannte ihn der Mob und stürzte sich mit bloßen Händen auf die Polizistin, die benommen auf dem Boden saß.
Von den Schüssen aufgeschreckt, hatten Meinhoff und Beck den Keller verlassen und waren in den Kundenbereich gestürmt. Sie hatten noch gesehen, wie ein Hüne, der den Anschein erweckte, einem übertriebenen Prospekt für Bodybuilder entstiegen zu sein, Sarahs schlaffen Körper über seinen Kopf hob und gegen die Scheibe neben der Eingangstür schleuderte. Die Menge hatte getobt. Meinhoff und Beck blieb kaum mehr Zeit zu reagieren, denn schon hatte man sie entdeckt und die Hetzjagd auf sie eröffnet.
Joachim Beck wurde vor einem offen stehenden Fenster im hinteren Bereich der Bank gestellt. Er hatte die Hände über dem Kopf erhoben. Zuerst waren sie nur zu dritt und hatten ihn voller Hass abschätzig taxiert. Dann war der Bodybuilder hinzugekommen. Die anderen wichen in Erwartung des Kampfes einen Schritt zurück. Der Bodybuilder musterte Beck von oben herab. Er war fast zwei Köpfe größer und doppelt so breit wie der Polizist.
Der erste Schlag hatte Becks Nase zertrümmert, kurz und schmerzvoll. Er hatte ihn leicht seitlich getroffen, sodass sein gebrochenes Nasenbein zur Seite nachgab und seinem Gesicht einen völlig neuen Charakter verlieh. Sofort danach kam der zweite Schlag, der sein rechtes Auge mit Sternen übersäte. Becks Augapfel wurde zusammengequetscht, Äderchen platzten und machten jeden weiteren Blick durch dieses Auge für die kommenden Tage, sollte er das hier überstehen, unmöglich. Einer der Umstehenden, ein südländisch aussehender Junge von höchstens vierzehn Jahren, griff nach Becks Waffe und riss sie ihm aus dem Halfter.
Als der Bodybuilder ihn gepackt hatte und über seinen Kopf hob, hörte Joachim Beck Meinhoffs Stimme. Sein Vorgesetzter bettelte mit sich überschlagenden Worten um sein Leben. Beck flog aus dem Fenster, hörte einen einzelnen Schuss und schlug gegen eine Mülltonne. Als er sein funktionsfähiges linkes Auge öffnete, entdeckte er den Jungen, der mit seiner eigenen Dienstwaffe auf ihn zielte. Beck riss den Kopf zur Seite, gerade noch rechtzeitig, dann zerbarst der Putz an der Wand neben ihm. Gleichzeitig stieg der Hüne durch das Fens ter!
Beck wusste, dass dies die letzte Chance sein würde, sein Leben vorerst zu retten. Er stolperte auf die Beine, verlor dabei einen Schuh und rannte um sein Leben, hinaus auf die Straße vor der Bankfiliale, auf der der Mob inzwischen den Polizeiwagen aufs Dach gekippt hatte und auf ihn einschlug. Er rannte den Weg, den sie noch zu viert hierhergefahren waren, zurück, bis er völlig außer Atem und mit brennenden Lungen endlich die Tür des Polizeireviers hinter sich ins Schloss fallen hörte und glaubte, in Sicherheit zu sein.
Du bist allein! Du bist auf dich gestellt! Niemand wird dir helfen! Diese Worte trieb der Morgen dieses 23. Mai in die Köpfe der Menschen und die längst bezwungen geglaubten archaischen Grundtendenzen des Lebens brachen sich Bahn: Angst und Rücksichtslosigkeit. Man könnte beide Begriffe auch gegen »Selbsterhaltungstrieb» und »Das Recht des Stärkeren» austauschen.
Während die Mehrzahl der Männer, Frauen und Kinder die Nähe von Verwandten und Freunden oder Bekannten suchte, begannen einige wenige, die bisher unter den Zwängen von Gesetzen und gesellschaftlichen Normen unauffällig dahingelebt hatten, etwas Neues und äußerst Verlockendes zu entdecken: die absolute Gesetzlosigkeit. Wie menschliche Ratten witterten sie den Untergang und krochen sie aus ihren Verstecken.
Der Erste Polizeihauptkommissar Frederik Salm, Revierleiter, hatte das Revier verlassen, um, wie er sagte, zu Hause kurz nach dem Rechten zu sehen. Zu Fuß kam er nun zurück und hörte schon von Weitem Lärm und Geschrei.
Etwa fünfzehn zumeist junge Männer waren dem fliehenden Joachim Beck von der geplünderten Sparkassenfiliale die achthundert Meter bis zum Polizeirevier gefolgt. Als sie den verriegelten Haupteingang bemerkten, begannen sie, die quadratischen kleinen Steine des Kopfsteinpflasters herauszubrechen und nach wenigen Minuten hatte das abweisende Gebäude kein einziges intaktes Fenster mehr, glotzte mit schwarzen Augenhöhlen durch Gitterbrillen auf die Steinewerfer und ihre Wut herab.
Der Bodybuilder, der Beck unfreiwillig zur Flucht verholfen hatte, indem er ihn durch das offene Fenster der Bank schleuderte, war inzwischen zum Hinterhof des Reviers geschlichen. Dieser Ort war ihm bestens vertraut. In den vergangenen Jahren hatte man ihn ganze sechs Mal verhaftet und immer wurde der Polizeiwagen hier hinten abgestellt und er von seiner Eskorte in den dunklen Flur zum Revier gestoßen.
Es waren keine großen Sachen, weswegen sie ihn mitgenommen hatten. Einmal Handel mit Anabolika, einmal Nötigung (er schwor heute noch felsenfest, dass die Kleine es genau so gewollt und ihren Spaß dabei gehabt hatte, wenn sie vor dem Richter dann auch alles verdrehte). Die restlichen Festnahmen erfolgten wegen Körperverletzung. Aber war es denn ein Verbrechen, einem Kerl, der dein Mädchen dumm von der Seite anmacht, die Leviten zu lesen? Wo käme man hin, wenn jeder das Mädchen des anderen anbaggern dürfte? Nein, da war sich Daniel Ritter, der Bodybuilder, sicher, irgendwo hört die Freundschaft auf, was er damals dem vermeintlichen Konkurrenten auch überdeutlich erklärt hatte. Mit Hilfe beider Fäuste, versteht sich.
Im Flur traf er auf Storm, den Dienstgruppenleiter. Ritter kannte Storm von einigen Verhören recht gut und erkannte ihn sofort an dessen kahlen Schädel und der gedrungenen Körperhaltung. Storm wäre in einem fairen Kampf, Mann gegen Mann, ein ernstzunehmender Gegner gewesen, aber Ritter hatte keine Lust auf einen fairen Kampf. Was würde das bringen, wem würde das helfen? Ihm bestimmt nichts! Also hatte er sich instinktiv für das Überraschungsmoment entschieden und Storm mit einem gezielten Faustschlag niedergestreckt. Bye bye Bulle, schlaf schön!
Beck spürte, dass mit Storm, der den Hintereingang verschließen wollte, etwas nicht stimmen konnte. Er hätte längst zurück sein müssen!
Joachim Beck saß in einer vergitterten Mausefalle, war die Maus in diesem Spiel, und umzingelt vom Mob. Und einer von ihnen, ein Tier mit glänzenden, zum Zerreißen gespannten Muskelsträngen, drückte bereits behutsam die Hintertür auf und warf einen ersten vorsichtigen Blick in den großen Raum, in dem Joachim Beck gefangen saß. Durch die glaslosen Fensteröffnungen drangen wütenden Rufe herein. »Kindermörder«, riefen sie und »Verrecken sollt ihr.« Steine flogen.
Beck blickte sich um. Wo war der Ausweg?! Hinter dem verschlossenen Haupteingang und den vier vergitterten Fenstern lauerte Gesindel, das nur darauf wartete, ihn zwischen die Finger zu bekommen und zu zerreißen. Der einzige weitere Ausgang führte über einen dunklen Flur zum Hinterhof, durch eine Tür, die Storm hatte sichern wollen. Oder hatte Storm angesichts der unberechenbaren Situation das Weite gesucht?
Becks Blick fiel auf den Stahlschrank hinter Salms Schreibtisch. Der Waffenschrank – voll gestopft mit schussbereiten MP5, Maschinenpistolen made in Germany!
Beck duckte sich und rannte durch den Raum, suchte dabei immer wieder hinter einem Schreibtisch Schutz vor den hereinfliegenden Steinen. Wie erwartet war der Waffenschrank verschlossen. Beck begann den Schreibtisch des Revierleiters zu durchsuchen, riss eine Schublade nach der anderen heraus und verstreute den Inhalt auf dem Boden.
»Suchst du den hier?«
Beck sah auf, wie vom Donner gerührt und halb gebückt hinter dem Schreibtisch eingefroren. Auf der anderen Seite stand Ritter vor ihm, der Bodybuilder, mit einem breiten, unfreundlichen Grinsen auf den Lippen. Seine Augen funkelten eiskalt und mit einem Anflug von Vorfreude.
»He, das hier suchst du doch! Oder etwa nicht, Bulle?!« In der ausgestreckten Hand hielt er einen Schlüsselbund. Beck erkannte daran den markanten Schlüssel zum Waffenschrank, lang und glänzend, mit einem eigentümlichen Doppelbart am Ende. Richtig, fiel es ihm ein, Salm musste, als er das Revier verlassen hatte, den Bund mit allen wichtigen Schlüsseln dem zurückbleibenden Dienstgruppenleiter, also Storm, gegeben haben! Und wenn jetzt dieser hirnlose Muskelberg im Besitz der Schlüssel war, musste Storm … Er weigerte sich, den Gedanken zu Ende zu denken und richtete sich auf.
»Willst du ihn dir nicht holen?« Ritter lächelte. Beck war sicher einer von der Sorte Mann, die sich erst in Uniform als Mann fühlen, dachte er. Ohne den offiziellen Ornat würde er übersehen, eventuell milde belächelt.
Er hielt dem Polizisten die Rettung entgegen und klimperte mit den Schlüsseln. »Komm, kannst sie haben, wenn du willst, Bulle. Musst sie dir nur holen.«
In diesem Moment flog ein weiterer Pflasterstein zwischen die Gitterstäbe hindurch, traf einen Schreibtischstuhl an der Lehne und prallte ab. Der Stuhl drehte sich zweimal um die eigene Achse, während der Stein Daniel Ritters Knöchel traf.
»Au, Scheiße noch mal!«, fluchte der Getroffene und griff sich an den Fuß. »Hört auf, ihr Idioten, ich mach euch gleich die Tür auf!«, brüllte er Richtung Straße, aber da die Fenster von der Straße aus so weit oberhalb lagen, dass keiner ohne Leiter hineinsehen konnte und somit auch niemand Ritter sah, erntete sein Gebrüll nur Hohn und Gelächter.
Beck nutzte den kurzen Augenblick der Unkonzentriertheit seines Gegenübers und hechtete über den Schreibtisch. Er blieb dabei mit einem Fuß an Salms hypermoderner Schreibtischlampe hängen und stürzte kopfüber auf den Boden.
»Na, du hast es aber eilig!« Ritter lächelte böse. Vor ihm lag Joachim Beck hilflos auf dem Rücken. »Du siehst echt scheiße aus, Bulle, weißt du das eigentlich?« Durch das Fenster flog ein weiterer Stein und zerschlug Salms Lampe. »Eh, machst du dir etwa in die Hosen?« Im Schritt von Becks Hose wurde ein dunkler Fleck schnell größer.
»He Leute, der Bulle bepisst sich gerade!«, brüllte Ritter und warf den Schlüsselbund auf den Schreibtisch, um für das, was er jetzt tun wollte, beide Hände freizuhaben.
»Ich an deiner Stelle hätte jetzt auch Angst«, flüsterte Ritter. Beck versuchte, auf dem Rücken liegend und mit weit aufgerissenen Augen, von seinem Gegner wegzurobben − aber mit zwei großen Schritten war der über ihm und setzte dem Polizisten seinen schweren Lederschuh auf die Kehle. »Und jetzt? Ohne deine Knarre und deine schwulen Bullenkumpels bist du ganz schön blöd dran, he? Bepisst dich vor Angst und versuchst einfach wegzukrabbeln, was? Statt, dass du kämpfst wie ein richtiger Mann!« Ritter verlagerte einen weiteren Teil seiner einhundertvierzehn Kilo in den rechten Fuß und drückte Becks Kehle weiter zu. Beck spürte den Knorpel seines Kehlkopfes knirschen. Er riss den Mund weit auf, aber das, was an Luft noch die zusammengepresste Luftröhre passieren konnte und seine Lungen erreichte, konnte bei Weitem nicht den Bedarf des Mannes decken. Mit seiner Atemnot steigerte sich seine Angst und die Angst wiederum ließ ihn noch schneller hecheln. Ritter fand Vergnügen an diesem Spiel und lockerte kurz den Druck in seinem Fuß. Wie ein altersschwacher Asthmatiker sog Beck die Luft tief in die Lungen ein, aber schon schnürte Ritters Schuh seinen Hals erneut zu. Voller Panik tasteten die Hände des Polizisten über den Boden. Einen Stein, dachte er, Gott, gib mir einen Stein! Stattdessen berührten seine Finger eine der vielen Glasscherben. Er lag halb mit dem Gesäß auf ihr, vor Ritters Blick verborgen.
»So, kleiner Bullenpisser, langsam Zeit, Lebwohl zu sagen, he? Bin mal gespannt, ob du schreien kannst, wenn es zu Ende geht. Kannst du schreien Bulle, he, kannst du?« Ritter beugte sich eine Kleinigkeit zu seinem Opfer hinab und verstärkte dabei den Druck, den sein Schuh ausübte. Die grobe Sohle drückte tief in den Hals und hinterließ dunkle Blutergüsse.
Beck packte die lange, schmale Scherbe, auf der er lag. Er griff sie, so fest er konnte, wobei das Glas tief in seine Handfläche und die Finger schnitt. Blutstropfen quollen hervor, Beck biss sich auf die Lippen, riss seinen Arm hoch und jagte die Waffe mit aller Gewalt in Ritters Oberschenkel. Mit der anderen Hand zerrte er sich den Fuß vom Hals und rollte unter dem in die Knie gehenden Gegner zur Seite. Ritter stieß einen überraschend hohen Schmerzensschrei aus – schrill, wie das Quieken eines zur Schlachtbank gezerrten Schweins. Bevor Ritters träger Geist die Situation erfassen konnte, war Beck schon auf den Füßen und trat ihm mit dem noch beschuhten Fuß ins Gesicht. Er legte all seine Wut, seine Todesangst, seine Scham in diesen Tritt und Ritter verlor einen seiner gepflegten Schneidezähne. Beck war für den Bruchteil einer Sekunde versucht, nach dem Schlüsselbund zu greifen und den Waffenschrank zu öffnen − ein Blick auf Ritter, der sich gerade wieder aufrappelte und dabei seinen blutigen Zahn ausspuckte, verriet ihm aber, dass dies keine gute Idee wäre. In Ritters Augen funkelte kalte Mordlust, schon stand er wieder auf beiden Beinen.
Beck ließ die abgebrochene Scherbe fallen, die Spitze steckte noch im muskulösen Oberschenkel des Bodybuilders. Dann hetzte er im Slalom um die Schreibtische und Stühle zum Hinterausgang. Er erreichte den schmalen dunklen Flur, wäre fast über etwas am Boden Liegendes gestolpert (Storm?), als Ritter hinter ihm auftauchte und lautstark nach Unterstützung brüllte.
»Kommt her, kommt hinters Haus! Der Bulle wollte mich umbringen!«
Beck blieb keine Zeit, weiter über das Hindernis im Flur nachzudenken. Ritter war mittlerweile nur noch fünf Meter entfernt, humpelte aber stark.
Ohne einen weiteren Blick zurück begann Joachim Beck, zu rennen. Er rannte mit nur einem Schuh, blutenden Händen und einer gebrochenen Nase, konnte nur mit einem Auge sehen und rannte um sein Leben. So schnell er konnte, versuchte er das Revier und die grölenden Menschen dort hinter sich zu lassen. Er rannte, bis die Lungen wie flüssiges Feuer in seinem Leib brannten, bis er endlich einen Hausflur fünf Straßen weiter erreichte und glaubte, in Sicherheit zu sein.
Als Ritter einsah, dass Joachim Beck ein verlorenes Opfer war, schleppte er sich zurück in den Gang. Vor Kommissar Storm blieb er mit einem bösen Lächeln stehen. Storm lag noch immer bewusstlos am Boden, das dünne Blutrinnsal aus seinem Hinterkopf trocknete langsam. Ritter bückte sich, packte Storm am Kragen und zerrte ihn hinter sich her wie einen Sack Kartoffeln. Vor der verriegelten Eingangstür legte er ihn ab und humpelte zu Salms Schreibtisch. Er griff sich den Schlüsselbund und öffnete den Waffenschrank.
»Geile Scheiße!«, stöhnte er, als er die blinkenden Maschinenpistolen sah. Er griff sich die nächstbeste und folgte dann den Bildern auf einem Plakat, welches innen an der Schranktür hing. Magazin einlegen und entsichern. Kinderleicht! Er fühlte sich so stark, stark wie nie zuvor. Aus der kalten Waffe strömten übermenschliche Kräfte in seine Hand und den kräftigen Körper. Sie ließ ihn fürs Erste den Schmerz im Oberschenkel vergessen. Er humpelte zurück zu Storm und stemmte ihn sich auf die Schulter. Dann schloss er den Haupteingang auf, trat gegen die Tür, die nun bereitwillig aufsprang, und ging nach draußen.
»Ich hab euch was mitgebracht, Leute!«, lachte er und warf Storm vor sich auf den Gehweg. Dann richtete er die Maschinenpistole auf den Bewusstlosen und schoss in einer langen Salve das Magazin leer. Joachim Beck flüchtete in ein Treppenhaus. Dort brach er zusammen. Sein Atem rasselte, er war gerannt wie seit Jahren nicht mehr. Aber jetzt war er wenigstens sicher, wenigstens allein.
Da wurde die alte Haustür, die sich gerade erst mit einem Quietschen hinter ihm geschlossen hatte, aufgestoßen.