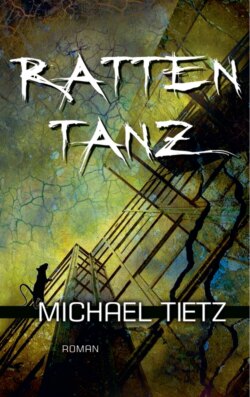Читать книгу Rattentanz - Michael Tietz - Страница 19
14
Оглавление15:00 Uhr, Krankenhaus Donaueschingen
Gestern war die Welt noch in Ordnung. Strom und Wasser und Computer funktionierten so, wie sie funktionieren sollten und für die Menschheit entsprach das Morgen vermutlich dem Heute und Ges tern und war nur mehr dessen logische Fortsetzung. Gestern hatten Punkt zwölf, wie jeden Mittag, die Kirchenglocken der Stadt geläutet. Heute war alles still. Blieb alles still.
Joachim Beck kannte das am Stadtrand liegende Krankenhaus aus eigener Erfahrung. Ein bei einem Einsatz gebrochener Finger war hier gerichtet und eingegipst worden und mindestens zweimal im Monat musste er nach einer geschlichteten Schlägerei mit einem Opfer hierher oder einen betrunkenen Autofahrer einen Blutalkoholtest unterziehen lassen.
Als er jetzt aber den Wartebereich betrat, erkannte er die sonst so beschauliche Einrichtung kaum wieder!
Es herrschte heilloses Durcheinander. Menschen hetzten hinein, wesentlich mehr aber verließen die Klinik. Alles machte den Eindruck einer unkoordinierten, spontanen Evakuierung des Krankenhauses. Zeitgleich suchten immer mehr Verletzte nach Behandlung und schneller Hilfe. Beck drängelte sich an einer älteren Frau vorbei, die ihren Mann in einem Rollstuhl aus der Klinik schob. Ihr liefen Tränen übers Gesicht und er rief vergebens nach einem Taxi. Die Frau weinte, weil sie die Hilf- und Sinnlosigkeit seiner Rufe längst erkannt hatte. Aber die Angst vor der Enttäuschung in seinen Augen hielt sie zurück. Und ließ sie weinen.
Becks zerschnittene Handfläche war mit einer Krawatte notdürftig verbunden. Vor einer Stunde hatte sie endlich aufgehört zu bluten. Salm hatte ihm das schmale Stück Stoff um die Verletzung geknotet und ihn ins Krankenhaus geschickt.
Frederik Salm, sein Vorgesetzter und Leiter des Donaueschinger Polizeireviers, hatte auf dem Weg zurück in seine Dienststelle Joachim Beck mit nur einem Schuh, gebrochener Nase und blutender Hand an sich vorbeirennen sehen. Aus Angst vor dem Lärm, der aus dem nahen Revier zu ihm drang, hatte er sich hinter ein geparktes Auto gekauert. Erst als er halbwegs sicher sein konnte, dass Beck nicht verfolgt wurde, rannte er seinem Untergebenen hinterher.
Beck flüchtete in ein dunkles Treppenhaus und empfing seinen Chef mit kampfbereiten Fäusten.
»Beck? Ich bin es, Salm!« Erleichtert hatte Beck die Angriffshaltung aufgegeben. Er zitterte wie ein frisch geborenes Kalb am ganzen Körper. Das von seinen Fingerspitzen tropfende Blut bildete bereits eine ansehnliche Lache auf dem Steinboden.
Während er Salm von den Vorfällen in der Bank und im Revier erzählte, zerriss eine Maschinengewehrsalve die Stille. Salm zerrte sich die Krawatte vom Hals und verband Joachim Becks Hand. »Versuchen Sie, ins Krankenhaus zu gelangen, das muss genäht werden«, hatte er geraten. »Ihre Nase könnte auch einen Arzt vertragen.« Beck lächelte gequält.
»Und was werden Sie unternehmen?« Salm hatte einige Sekunden geschwiegen und durch Beck hindurchgesehen.
»Ich weiß es nicht.«
So ratlos hatte Beck seinen cholerischen Vorgesetzten noch nie erlebt. »Alles scheint vollkommen aus den Fugen zu geraten. Ich habe Angst, Angst um meine Familie, meine Mitarbeiter, die noch draußen sind, Angst um unsere Stadt, unsere Welt. Ist nur hier alles durcheinandergeraten und in Frankfurt und Stuttgart und Berlin funktioniert das Leben reibungslos und wie gewohnt? Aber wenn ja, warum hilft uns dann niemand?« Salm hatte den Kopf geschüttelt und Beck auf die schwachen Füße geholfen. »Machen Sie, dass Sie ins Krankenhaus kommen. Ich gehe zurück zu meiner Familie.«
Beck kämpfte sich bis in die Ambulanz vor, wo eine überforderte junge Ärztin den auf sie einstürmenden Patienten gegenüberstand. Al le Stühle waren besetzt, und auf den Gängen vor den vier Behandlungskabinen drängelten sich Männer und Frauen. Die Ärztin hastete zu jedem Neuankömmling, konnte sich aber bei keinem zu einer Behandlung durchringen. Heute war der erste Tag, an dem sie, ohne den sicheren Rat eines erfahrenen Kollegen im Hintergrund, allein und eigenverantwortlich arbeiten und entscheiden musste. Zuerst, bis gegen zehn, halfen ihr zwei weitere Assistenzärzte, die man dann aber in die Operationssäle abkommandierte.
Eine resolute, ältere Krankenschwester nahm der jungen Ärztin das Zepter aus der Hand und begann, nach eigenem Gutdünken die Patien ten zu verteilen. »Alle mit leichteren Verletzungen gehen bitte auf Station zweiundzwanzig. Bitte!« Mit gespreizten Armen schob sie einige Verletzte vor sich her. »Bitte, Sie sehen doch selbst, dass wir im Moment hier in der Ambulanz nichts für Sie tun können. Gehen Sie auf die Stationen, bitte.«
Eine rundliche Türkin mit einem schreienden Kind auf dem Arm stieß die Schwester zur Seite und rannte in eine der Kabinen. Der Vierjährige war eine unbeleuchtete Kellertreppe hinabgestürzt und blutete aus einer langen Platzwunde, die sich über die gesamte Stirn zog.
»Ich gehe nix!« Auf der Behandlungsliege lag bereits ein älterer Herr, dessen Symptome für einen Herzinfarkt sprachen. Sie drängelte ihr breites, unter einem derben Rock verborgenes Gesäß neben ihn auf die Liege und drückte ihr Kind fest an sich. »Ich gehen erst, wenn du hast geholfen!«
»Na«, die Schwester hatte Beck entdeckt. Sein Gesicht kam ihr bekannt vor. »Sie hat es aber böse erwischt.« Sie musterte die Reste der Uniform. »Ach stimmt, Sie sind Polizist, nicht wahr?« Beck nickte. »Hatten Sie einen Unfall? Sind die Straßen einigermaßen frei? Man hört ja hier so einiges, aber wissen Sie, ich hatte meinen Kindern versprochen, dass wir heute Nachmittag, nach Dienstschluss, zusammen nach Rottweil ins Bad fahren.« Beck wollte etwas erwidern, aber die Schwester hatte ihn schon am Arm gepackt. »Ach, ist ja jetzt egal! Gehen Sie auf eine Station, vielleicht ist dort noch ein Arzt. Sie sehen ja selbst, wie es hier zugeht! Bin mal gespannt, ob ich pünktlich rauskomme, hab schon genug Überstunden, die ich nicht abbummeln darf. Personalmangel, wissen Sie.« Und schon musterte sie einen weiteren Patienten und entschied, wo er hin sollte, während sie mit diesem den mit Beck begonnenen Monolog fortsetzte.
»Ist Dr. Stiller im Haus?« Beck war noch einmal zurückgekommen. Dr. Stiller war zwar Anästhesist, aber auch der einzige Arzt des Hauses, den er von seinen Besuchen hier noch mit Namen kannte.
»Stiller?« Die Schwester überlegte einen Moment. »Ich glaube, er ist heute auf Intensivstation. Aber es kann auch sein, dass er in den OP musste. Sie wissen ja, heute geht nichts so, wie es sollte. Und dann noch der Personalmangel …«
In den Stationsfluren bot sich Beck kein besseres Bild; überall Menschen, die eilig mit Familienangehörigen oder Freunden das Krankenhaus verließen oder in die andere Richtung unterwegs waren, um jemanden abzuholen. Dazwischen überfordertes Personal, das von Stunde zu Stunde auf seltsame Weise weniger zu werden schien. Die Flure waren nur spärlich beleuchtet und fast alle Türen zu den Patientenzimmern standen weit offen.
Die Klinik bestand aus drei Flügeln und da, wo diese zusammentrafen, lagen Treppenhaus, Aufzüge und in jeder Etage ein geräumiger Wartebereich. Joachim Beck befand sich, der Anweisung der Ambulanzschwester folgend, in der zweiten Etage, wo neben den Operationssälen und der Intensivstation die chirurgischen Stationen lagen. Im Wartebereich blieb er stehen. Um ihn herum pulsierten Angst, Hektik und Unsicherheit und Menschen hasteten durch die Gänge. Es waren nur wenige Schwestern und Pfleger, aber keine Ärzte zu sehen.
In den Sesseln im Wartebereich saßen Patienten, zum Teil im Bademantel und mit Infusionsständer neben sich, andere bereits fertig angezogen und mit gepacktem Koffer. Sie warteten auf jemanden, der sie abholte. Hoffnungsvoll empfingen ihre Augen jeden, der die Etage betrat.
Im Wartebereich saß eine alte Frau mit rundem Gesicht. Unter einem roten Wollkopftuch guckte schlohweißes Haar hervor. Im Gegensatz zu allen anderen, die das Treppenhaus im Auge behielten, saß sie so, dass sie genau sehen konnte, was auf dem Flur zur Intensivstation passierte. Ihre Finger strickten wie automatisiert an einem Socken. Sie wirkte fehl am Platz, da sie als Einzige so etwas wie Ruhe und Gelassenheit ausstrahlte.
Wegen seines ungünstigen Ausblicks war der Platz neben der Alten noch frei. Beck setzte sich.
Erstmals an diesem albtraumhaften Tag kam er etwas zur Ruhe. Er sah sich um. Links von ihm saß die alte Frau, dann kamen das Treppenhaus und die Aufzüge. Die standen still und vor einem der Las ten aufzüge hing ein weißes Bettlaken mit Bügelfalten. Darüber ein Schild mit der Aufschrift »Außer Betrieb!« Wer käme denn heute schon auf die Idee, einen Aufzug zu benutzen?, überlegte Beck. Rechts von ihm, umgeben von Palmen und tief hängenden Strahlern, die in der lichtlosen Halle Sonnenlicht imitieren sollten, standen acht doppelsitzige Bänke – hellblau und mit abwaschbarem Stoff bezogen. Beck schloss die Augen. Das monotone Klappern, das von den Stricknadeln der alten Frau kam, beruhigte ihn etwas. Sein Kopf dröhn te wie ein leerer Kochtopf, der über den Steinboden in der Küche rollt. Ob die Nase wohl wieder gerade würde? Er betastete den geschwollenen Klumpen mitten in seinem Gesicht und das blutunterlaufene Auge. Selbst mit Hilfe der Finger war es nicht möglich, die Lider so weit auseinander zu drücken, dass er hätte sehen können. Salms Krawatte hatte sich dunkel verfärbt, aber die Wunden bluteten nicht weiter.
Als er vor fünf Jahren aus der Nähe von Stuttgart nach Donaueschingen kam, war Joachim Beck dreiundzwanzig. Er war allein und, wie ihm beim Anblick all der Menschen um ihn herum bewusst wur de, auch bis heute allein geblieben. Es gab hier niemanden, um den er sich Sorgen machte, keinen, der sich um ihn sorgte. Eigentlich schade. Und erleichternd! Er wohnte am anderen Ende der Stadt, in einer kleinen Dreizimmerwohnung unterm Dach. Außer einer günstigen Miete hatte die Wohnung den Vorteil, dass er von seiner erhöhten Position aus am Abend einer Frau im Nachbarhaus beim Ausziehen zusehen konnte. Wenn sie ihn ließ! Denn manchmal, so kam es ihm vor, flanierte sie zuerst absichtlich vor dem Fenster ihres hell erleuchteten Schlafzimmers, um dann, wenn sie gerade dabei war die Knöpfe ihrer Bluse zu öffnen, mit sadistischer Freude die Vorhänge langsam zuzuziehen. Sie erinnerte ihn an Manuela, seine Schwester.
Wieso war heute alles so völlig danebengelaufen? Beck dachte an Wegmann, di Sario und Meinhoff. Waren sie tot? So wie Storm? Und was war aus den anderen geworden? Interessierte es jemanden? Beck schüttelte (in Gedanken) den Kopf. Nein. Im Moment beschränkten sich die Interessen der Menschen nur noch auf das, was ihnen wirklich wichtig war. Und das waren in der Regel die Partner, Kinder und Eltern und man selbst. Wer würde da nach ein paar Polizisten fragen?
Vom Treppenhaus drang Lärm herüber. Männerstimmen.
»Du solltest zu einem Doktor gehen, Jungchen.« Die hohe, aber trotzdem angenehme Stimme der Alten tanzte im Singsang der Russlanddeutschen. »Deine Gesicht sieht nicht gesund aus.« Ihre Brille saß auf der rundlichen Nasenspitze. Sie blinzelte ihn kurz über die schmale Fassung hinweg an.
Richtig! Dr. Stiller.
»Ja. Danke.« Er stand mühsam auf und schenkte der alten Frau ein Lächeln.
»Wird bestimmt wieder gut, deine Gesicht!«, lächelte sie zurück und kümmerte sich wieder um die wirklich wichtigen Dinge.
Die Intensivstation, auf der Dr. Stiller hoffentlich arbeitete, befand sich am Ende eines schmalen Flurs. Unterwegs passierte Beck den Eingang zu den Operationssälen, die alle auf Hochtouren liefen. Beck war gerade dabei, die zweiflügelige Milchglastür zur Station aufzuwuchten, als er hinter sich Schreie hörte. Beck drehte sich um und konnte gerade noch erkennen, wie der Bodybuilder, den er im Hinterhof des Reviers glaubte abgehängt zu haben, in den Wartebereich humpelte, gefolgt von drei oder vier Männern. Die meisten von ihnen um die zwanzig oder wenig darüber. Sie lachten, während Besucher und Patienten schrien und versuchten, das Treppenhaus zu erreichen oder in die Stationsflure zurückzuweichen.
Da erkannte Beck den Jungen, der ihm in der Sparkasse seine Waffe entrissen und dann auf ihn geschossen hatte. Der Junge fuchtelte mit einer Pistole in der Luft rum. Dann zeigte einer der anderen Männer in seine Richtung!
Daniel Ritter hatte die Ärztin in der Ambulanz mit körperlicher Präsenz gebeten, ihm die Scherbe aus dem Oberschenkel zu entfernen. Seine Begleiter räumten derweil eine der Kabinen und trugen die Frau, die mit gebrochenem Bein auf der Liege lag, in den Flur. Nach der regelrechten Hinrichtung Storms vor dem Polizeirevier hatte dort einen Moment Stille geherrscht. Die Steinewerfer, vielleicht dreißig Jugendliche, starrten auf Ritter und den durchlöcherten Polizisten zu seinen Füßen. Das war etwas anderes, als sich in der Rolle des Schlächters durch ein Videospiel zu ballern! Das war keiner der blutrünstigen Filme, die nach Mitternacht liefen (Achtung! Diese Sendung ist für Zuschauer unter sechzehn Jahren nicht geeignet!)! Das hier war die Wirklichkeit! Es war real, fand statt und der Mann da auf dem Gehweg war tatsächlich tot! TOT!
Ritter hatte in die Runde geschaut. He, er war der Held!
»Was glotzt ihr so? War doch bloß ’n Bulle!«
Einige traten den Rückzug an, es reichte! In jeder Hand noch einen Stein, war ein Junge mit im Schritt nasser Hose in einem Hauseingang verschwunden, während eine Siebzehnjährige mitten auf der Straße zusammenbrach und hysterisch zu weinen begann. Der Junge mit dem südländischen Aussehen kam auf Ritter zu und hielt ihm Becks leer geschossene Heckler & Koch P7 hin. »Gibt’s da drin frische Munition?« Seine brüchige Stimme holperte noch unentschlossen zwischen Kindheit und Erwachsensein hin und her.
»Klar, Mann.« Er hatte ihn MANN genannt! »Da ist ’n ganzer Schrank voll!«
Mehmet grinste, war dann über Storm hinweggestiegen und an Ritter vorbei ins Revier gegangen.
»Los, kommt rein. Ist alles da, was wir brauchen!«
Das Mädchen schlug wild um sich und schrie: »Mörder! Ihr seid alle Mörder!« Sie wurde von vier Teenagern weggebracht. Sie wehrte sich, versuchte sich zu befreien und schrie: »Die kriegen euch! Euch alle kriegen sie!«
Aber Ritter lachte nur und warf ihr eine Kusshand zu.
»Oder willst du lieber …?« Dabei hatte er obszön mit der geschlossenen Hand den Lauf seiner Maschinenpistole gerieben. Drei lachten über Ritters guten Witz, dann folgten sie ihm und Mehmet ins Revier, um sich zu bewaffnen. Jeder Einzelne der fünf war bereits einmal Gast in diesem Raum gewesen.
Mehmet, in Donaueschingen geborener Sohn türkischer Einwanderer, hatte man mit neun Jahren erstmals festgenommen. Wegen zweier Kaugummis. Sein Vater hatte ihn windelweich geprügelt. Bei den folgenden Diebstählen beteiligte er seinen alten Herrn an der Beute. Mal brachte er ihm eine Flasche Schnaps mit − die der brave Moslem natürlich nicht anrührte, sondern an einen Penner verkaufte −, mal fiel ein Hemd oder ein Paar Wischerblätter ab. Zuletzt brach er Autos auf und räumte aus, was sich irgendwie verkaufen ließ oder er passte die Kleinen hinter der Schule ab und erleichterte sie um ihr Taschengeld. Davon hatte er seinem Vater nichts abgegeben.
Mehmet, fast fünfzehn, wirkte trotz des dunklen Flaums über seiner Oberlippe jünger. Er war klein und zierlich und hatte die schulterlangen, pechschwarzen Haare dick eingegelt und straff zusammengebunden.
Hermann Fuchs war ebenfalls in der Sparkasse mit dabei gewesen. In der Innentasche seines weiten Mantels trug der bisherige Sozialhilfeempfänger zwanzigtausend Euro in einem dicken Geldbündel. Der Start in ein neues Leben! Er konnte seine Verhaftungen wegen Trunkenheit oder Erregung öffentlichen Ärgernisses, vor allem aber die Nächte in der Ausnüchterungszelle des Reviers, nicht mehr zählen.
Mario, neunzehn, und Alex, zweiundzwanzig, waren Brüder, aufgewachsen bei ihrer Mutter, die machte, was ihre Söhne wollten, seit Alex ihr vor neun Jahren sein Taschenmesser an die Kehle gesetzt hatte und darauf hin dann auch das erbetene Geld fürs Kino bekam. Sie waren mehr oder weniger zufällig zum Revier gekommen, angelockt vom Geschrei der Menschen.
»Du blutest, Alter.« Mario hatte sich eine Maschinenpistole über die Schulter geworfen, drei volle Magazine in die Hose gesteckt und dabei auf Ritters Bein gezeigt.
»Weiß ich, Mann. War der Scheißbulle, der abgehauen ist.«
Mario zuckte die Schultern. »Solltest vielleicht ins Krankenhaus, oder?«
Die anderen, inzwischen ebenfalls bis an die Zähne bewaffnet, standen im Halbkreis um ihren Helden herum und nickten.
Zwei Straßen weiter hatten sie einen Geländewagen angehalten, den notgedrungen sehr kooperativen Fahrer zum Aussteigen aufgefordert und waren zur Klinik gefahren.
»Lasst die Knarren hier, macht bloß ’n blöden Eindruck.«
Alex blieb im Wagen, während Daniel Ritter mit seiner unbewaffneten Eskorte die Klinik betrat. Nur Mehmet hatte sich von seiner frisch geladenen P7 nicht trennen können. Er trug sie hinten in der Hose unter seinem T-Shirt (cool!). Und Fuchs glaubte, er müsse seinen neu erworbenen Reichtum mit einer Maschinenpistole schützen, die er unter seinem Mantel versteckt hielt.
Die Ärztin lehnte sich an die Wand und versuchte ihre zitternden Hände vor den Patienten zu verbergen. Nachdem sie die tief eingedrungene Glasscherbe entfernt hatte, verband die Ambulanzschwes ter die Wunde.
»Sie hätten sich ruhig hinten anstellen können«, plapperte diese. »Wir haben hier gerade wirklich genug zu tun. Wenn jeder so ankommen würde wie Sie!« Ritter konnte sich trotz der Schmerzen ein Grinsen nicht verkneifen. »Was soll daran lustig sein? Die arme Frau, die ihr einfach auf den Flur gelegt habt, hat schon zwei Stunden gewartet! Und der Polizist vorhin hatte bestimmt schlimmere Verletzungen als Sie! Aber hat er sich etwa so aufgeführt? Sie sollten …«
»Was für ein Polizist?«, unterbrach Ritter sie barsch und war plötzlich völlig schmerzfrei.
»Na, ein Polizist eben. Weiß nicht, wie er heißt, war aber schon öfter hier, mit Betrunkenen oder so.«
»Wie sah er aus?«
»Klein, mit Bart. Sein Gesicht war furchtbar zugerichtet, oh ja. Und die Hand erst!«
Der Verband war fertig angelegt und Mehmet half Ritter in die Hose. Plötzlich packte Ritter die Schwester und drückte sie gegen die Kabinenwand.
»Und wo ist er hin?« Sein bitterer Atem erinnerte die Schwester an eiternde Geschwüre. Sie wandte den Kopf ab.
»Er hat sich nach einem Arzt erkundigt, nach Dr. Stiller.«
»Und wo finde ich diesen Stiller?« Ritter hatte sie unter den Armen gepackt. Mühelos hob er sie in die Höhe. Die Schwester zögerte nur kurz.
»Er arbeitet auf der Intensivstation. Oder im OP.«
Beck zog hastig die Tür hinter sich zu und suchte nach einem Flucht weg. Seit dem Morgen hatte sich die Intensivstation völlig verändert. Inzwischen waren sämtliche Betten belegt und selbst auf dem Flur lagen zwei Patienten auf schmalen Liegen. Pflegepersonal und Ärzte − neben Stiller war ein junger Arzt im praktischen Jahr anwesend − gaben ihr Bestes, um die Patienten wenigstens mit dem Nötigsten zu versorgen. Aber es war ein fast aussichtsloses Unterfangen, denn während die Station aus allen Nähten platzte, wurden in vier Sälen Notfalloperationen durchgeführt und es war noch immer kein Ende absehbar. Zu allem Überfluss hatte sich eine der Schwestern am Vormittag aus dem Staub gemacht. »Tut mir leid«, hatte sie sich bei Eva Seger entschuldigt, »aber ich muss nach meinen Kindern sehen!« So blieb Eva mit Stefan und einer weiteren Schwester allein zurück.
Eva beneidete ihre Kollegin um diesen Egoismus. Inzwischen war es kurz nach drei und ihre Schicht eigentlich seit zwanzig Minuten offiziell beendet. Zu Hause wartete Lea. Aber Lea, daran zweifelte Eva keinen Augenblick, war bei Susanne und Frieder in guten Händen. Hier allerdings wurde sie gebraucht.
Gebraucht? Sie sah sich um. Brauchten die Verletzten sie wirklich? Hatten die Verletzten überhaupt eine reelle Chance? Sollte sie nicht lieber aus der Klinik rennen, in ihr Auto steigen und verschwinden? Dahin fahren, wo sie hingehörte?
Als sie an Aleksandr Glücks Zimmer vorbeihetzte, lächelte er ihr kurz zu. Vielleicht gehörte sie in diesem Augenblick doch hierher. Beck sah durch das milchige Glas mehrere Schatten näher kommen. Er wusste, wer da kam, er wusste auch, wen sie suchten und noch besser wusste er, was sie mit ihm anstellen würden, sollten sie ihn entdecken.
»Dr. Stiller, da sind Sie ja!« Beck hatte Stiller soeben entdeckt und rannte zu ihm.
»Gehen Sie bitte in die Ambulanz«, wimmelte Stiller ihn ab. Ohne noch einen Blick an den hilflosen Beck zu verschwenden, drehte er sich um und versuchte sich an eine bestimmte Medikamentenkombination zu erinnern. Aber ohne seine geliebten Taschencomputer war er sichtlich hilflos.
»Was wollen Sie?« Eva klang überarbeitet. »Sie sollten Ihre Verletzungen versorgen lassen!«, empfahl sie und kümmerte sich weiter um einen Mann, der vor wenigen Minuten verstorben war. »Sie sehen doch, hier geht es drunter und drüber! Bitte gehen Sie nach unten in die Ambulanz.« Eva entfernte alle Nadeln und Schläuche aus dem Körper des Verstorbenen. Bei der Notoperation war zwar die offene Bauchwunde und der zerfetzte Darm notdürftig geflickt worden, gegen den Kreislaufzusammenbruch, der dann vor vierzig Minuten eintrat, waren Stiller und die anderen allerdings hilflos. Zu viele andere Patienten brauchten Hilfe, zu wenige Ärzte waren abkömmlich. Ges tern hätte der Mann eventuell eine geringe Überlebenschance gehabt, heute nicht.
»Bitte, Sie müssen mir helfen, Schwester!«, flehte Beck. Wie ein gehetztes Tier sah er abwechselnd die Krankenschwester an und zurück in den Flur. »Bitte, ich bin Polizist und in wenigen Augenblicken werden ein paar Männer hier aufkreuzen. Bitte, helfen Sie mir! Die haben versucht mich umzubringen, haben meine Kollegen getötet!«
»Die haben was?!«
»Heißt hier jemand Stiller?« Es war Ritters Stimme, die über die Station brüllte.
Eva sah kurz nach draußen. »Wie sieht er aus?«, fragte sie Beck.
»Wie aus einem Fitnessstudio entflohen. Dann war da noch so ein Kleiner, noch ganz junger, mit Pferdeschwanz und …«
Eva nickte. Sie sah sich in dem Patientenzimmer um. Der Weg zum Notausgang am Ende des Flurs war durch Ritter und seine Kumpane unmöglich und ein Sprung aus dem Fenster zu gefährlich. Auch gab es in dem engen Patientenzimmer nur zwei kleine Schränke für Wäsche und Infusionen und zwei Patientenbetten. In dem einen Bett lag eine Frau, die am Morgen einen Herzinfarkt erlitten hatte, in dem anderen ein Toter.
Eva zog plötzlich das Leinentuch von dem Toten. »Schnell«, befahl sie, »legen Sie sich dazu!«
»Aber …« Beck starrte fassungslos zuerst auf die Leiche, dann auf die Schwester. Der Tote war schlank, mit einem dicken, völlig durchgebluteten Verband am Bauch. Sein Mund stand etwas offen und von seinen Händen, die ihm Eva über der Brust gefaltet hatte, stand der linke Zeigefinger etwas ab, war gekrümmt, als würde er Beck zu sich rufen. Dem lief ein Schauer über den Rücken. Übelkeit stieg in ihm auf.
»Wo ist dieser Stiller?!«, donnerte es aus unmittelbarer Nähe.
»Worauf warten Sie noch?«
Beck atmete tief durch, dann kletterte er in das Bett.
»Rutschen Sie weit runter, aber nicht zusammenrollen!«, befahl Eva. »Und ganz ruhig. Das Bettlaken darf sich nicht bewegen.« Damit deckte sie die noch warme Leiche und Beck, der sich eng an sie schmiegte, ab.