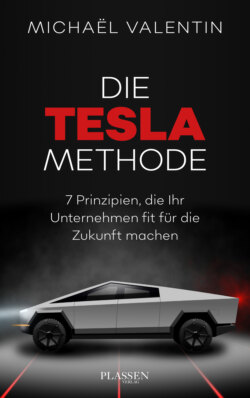Читать книгу Die Tesla-Methode - Michael Valentin - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VORWORT
ОглавлениеEs waren meine jüngsten Beobachtungen zum Zustand der Industrie in den am höchsten entwickelten Ländern, zu ihren Organisationssystemen und dem technischen Fortschritt der vergangenen zehn Jahre sowie zu den aktuellen sozioökonomischen Veränderungen, die mich dazu animiert haben, dieses Buch zu schreiben. Angesichts der zunehmenden Digitalisierung und einer im Niedergang begriffenen Industrie halte ich das Geschäftsmodell und das Betriebs- und Managementsystem des Teslismus für eine mögliche Lösung. Wie und warum ich aber dazu kam, Die Tesla-Methode zu schreiben, erklärt sich meiner Ansicht nach am besten aus meinem persönlichen Kontext.
Nachdem ich 1995 die Schule mit guten Noten abgeschlossen hatte, war ich nicht sicher, was ich studieren sollte. Wäre es nach meiner Familie gegangen, hätte ich unbedingt Arzt oder Notar werden oder in die Politik gehen sollen. Es wäre alles infrage gekommen, nur nicht das produzierende Gewerbe. In einer französischen Kleinstadt schlossen sich gesellschaftlicher Erfolg und Fabrikarbeit schlichtweg aus. Mein Weg in den Industriesektor begann daher erst, als ich auf den Fluren des Gymnasiums, das ich gerade verlassen hatte, eine Freundin traf (ihr Name war Véronique). Mit solchen Noten könne ich unmöglich Medizin studieren, fand sie. Eine Ingenieurwissenschaft schien ihr eher geeignet. Und sie hatte recht. Schließlich hatte ich gleich in mehreren naturwissenschaftlichen Fächern bei den Prüfungen gut abgeschnitten, doch aufgrund meiner kultureller Voreingenommenheit nicht wirklich begriffen, welche akademischen Möglichkeiten sich dadurch boten. Nach ein paar mit Mitabiturienten durchfeierten Nächten begann ich mich nach einem Praktikumsplatz umzusehen. Bauingenieurwesen hatte es mir auf Anhieb angetan: Das schien mir doch eine ganz solide Sache zu sein – kein Wunder, schließlich war dabei ja auch Beton im Spiel.
Als ich es bis zum Vorarbeiter gebracht hatte, rief mich ein Freund an, der an der renommierten technischen Hochschule Ponts et Chaussées studierte. Sein Spezialgebiet war die Produktion, und er träumte davon, irgendwann eine Fabrik zu leiten. Ich ging ebenfalls dorthin, und einen Monat später stand ich in einer Michelin-Fabrik im irischen Ballymena. Dort infizierte ich mich mit dem Industriefieber. Jeden Tag rollen dort über 1.000 Reifen aus den mehr als drei Meter hohen Öfen. Für einen jungen Studenten wie mich war das ein eindrucksvoller Anblick. Nach den Reifen wollte ich wissen, wie Autos produziert werden. Ich war absolut fasziniert davon, wie so ein Metallblech aus dem Walzwerk kommt und sich in wenigen Stunden in eines der komplexesten Systeme verwandelt, die der Mensch je erfunden hat – ein Produkt, von dem weltweit an jedem Tag der Woche über 140.000 Stück erzeugt werden.
Diese Begeisterung führte mich weiter auf meinem Weg in die Industrie. Im Verlauf meiner Ausbildung wurde ich befördert und leitete ein Team von Wartungstechnikern. Da erkannte ich allmählich die Stärke dieses einträglichen Sektors. Viele betrachten die Industrie stereotyp als starr und öde, übersehen dabei aber, wie oft es eigentlich um den Faktor Mensch geht. Mein Team und ich, wir entwickelten uns rasch zu einer versierten schnellen Eingreiftruppe und taten alles, was in unserer Macht stand, um zu verhindern, dass die Fertigungsstraßen stillstanden. Unsere Lösungen setzten stets beim Teamwork an und bei den Herausforderungen, die damit einhergingen: Man musste aufmerksam zuhören, aber dennoch auch unbequeme Entscheidungen treffen können. Manchmal stützten sich diese auf einen Konsens, doch ganz einfach war das nie. Warum? Weil die Fertigung eine komplexe Angelegenheit ist, die viel Mut erfordert. Tentakelartige Logistikketten sind komplex. Produkte, die aus Zigtausenden von Komponenten bestehen – und in ebenso vielen Variationen vorkommen –, sind komplex. Der Betrieb von Organisationen im Zeitalter der glücklichen Globalisierung ist komplex. Und sogar einfache Herstellungsprozesse sind komplex. Doch wiederum gilt: Das Herzstück der Produktion oder Rohstoffverarbeitung sind die Menschen – auch wenn immer ein paar darunter sind, die krampfhaft versuchen, ihr Gesicht zu wahren, indem sie so tun, als hätten sie alles unter Kontrolle.
Natürlich gibt es neben all dieser Komplexität auch noch die schlichte Schönheit eines Umfelds, in dem die Arbeiter an den Maschinen Tag für Tag Hand in Hand mit Technikern, Ingenieuren und Forschern arbeiten. Das ist ein unglaubliches Abenteuer. Jeder Beteiligte hat seinen eigenen sozialen Hintergrund, doch sie alle wirken zusammen, um das System zu optimieren. Das ist sicherlich eine Herausforderung – aber hey, wirklich unglaublich spannend. Ein wahrhaft einzigartiges menschliches Abenteuer.
Als ich in die Beraterbranche wechselte, blieb mir diese Begeisterung unvermindert erhalten und verdrängte bald die Skepsis, mit der ich die Beraterwelt betrachtete. Als Unternehmensberater hatte ich die Möglichkeit, Hunderte von Fabriken zu besuchen, mit verschiedenen Teams zusammenzutreffen und mich in unzählige komplexe und aufregende Fragen zu vertiefen, und zwar in einer Vielzahl von Sektoren: Schwerindustrie, Mechanik, Chemie, Pharmaindustrie, Bioproduktion, Werkzeugmaschinen, Konsumgüter und sogar handwerkliche Unternehmen, die sich im Luxussektor halten konnten, obwohl der Markt von all den neuen Technologien überschwemmt wurde. Ich lernte, dass es so etwas wie „die Industrie“ gar nicht gab, sondern dass sie in Wirklichkeit viele Gesichter hatte.
Damit sind wir schon im Jahr 2008. Damals litt der Fertigungssektor unter schlechter Presse. 30 Jahre lang hatten die Fabriken in Frankreich eine „Fabless“-Strategie verfolgt, und viele betrachteten die Fertigung als eine Aktivität, deren Zeit abgelaufen war. Im Trend lag die Vorstellung, dass Dienstleistungen in den nächsten Jahren die Hauptrolle spielen würden. Die Eliten erkannten dies und richteten ihre Politik auf die Sektoren aus, die ihrer Ansicht nach zukunftsträchtig waren. Frankreich hatte damals einen mächtigen Trumpf im Ärmel. In den 1980er-Jahren lieferten sich die französische und die deutsche Automobilindustrie ein Kopf-an-Kopf-Rennen, bis die deutschen Hersteller eine Hegemonialstellung errangen und Japan oder auch China weltweit ebenfalls ein stärkeres Gewicht erlangten. 2008 waren die Würfel schon gefallen, und alles war anders. Meine früheren Klassenkameraden waren Finanzanalysten, Trader oder Internetspezialisten geworden. Das produzierende Gewerbe nahm kaum einer richtig ernst. Im Fernsehen wurde laufend über Fabrikschließungen berichtet. Im Wahlkampf sprachen die Politiker von „Rettungsplänen“ für die Produktion. Alle waren sich einig: Der Industriesektor war ernsthaft krank und vermutlich nicht zu retten.
Die Krise, die 2008 einsetzte, war für verschiedene Länder ein Weckruf. Nachdem Frankreich fast 30 Jahre lang versucht hatte, seine Produktion ins Ausland auszulagern, musste sich das Land der Frage stellen, wie seine Gesellschaft aussehen sollte. War es wirklich sinnvoll, Geräte, die von Franzosen verwendet wurden, oder Spielzeug für deren Kinder oder die Kleidung, die sie trugen, erst um die halbe Welt zu verschiffen, damit sie in einem französischen Einkaufswagen landen konnten?
Nach und nach etablierte sich ein neues Phänomen. Die Digitalisierung nahm verschiedene Sektoren im Sturm, und bald war nur noch von Big Data, maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz die Rede. Unternehmen, die 15 Jahre zuvor noch nicht existiert hatten, wiesen inzwischen einen Marktwert auf, der 50 Prozent des französischen Bruttoinlandsprodukts entsprach. 2018 stammten die zehn am höchsten bewerteten Unternehmen der Welt aus dem Technologiesektor – acht aus den Vereinigten Staaten und zwei aus China. Natürlich entfielen gleichzeitig nur 25 der global führenden 100 Firmen auf Europa. Der deutsche Riese Siemens, der größte Industriekonzern Europas, hielt sich mit Mühe auf Platz 62 der Liste.
Die Digitalisierung hatte stärkere wirtschaftliche und politische Folgewirkungen, als wir gedacht hatten. Trump, der Brexit, Salvini, die Gelbwestenbewegung – diese Phänomene sind der Ausdruck des auf mehr Souveränität ausgerichteten Volkswillens. Dahinter steckt jedoch ein weitaus stärkeres, strukturbedingtes Phänomen, das nur wenige beim Namen nennen: die Deindustrialisierung der benachteiligteren Regionen der Industrienationen. Ihre Bürger fühlen sich, als habe sie die galoppierende Globalisierung ihrer Freiheit beraubt. Die großen Ballungszentren, die sich lange Zeit als Partner ihrer umliegenden ländlichen Regionen geriert hatten, gingen nun eigene Wege. Globalisierung bedeutete, dass kleine Provinznester mit kostengünstigen Ländern konkurrieren mussten, was zur Schließung von Fabriken, zu Gewinneinbrüchen im Einzelhandel und zu steigender Arbeitslosigkeit führte. 1970 war das Département Vosges, aus dem ich stamme, Frankreichs führendes Industrierevier. 2017 hatte sich das Blatt gewendet. In der Region Île-de-France rund um Paris waren 57 Prozent aller Erwerbstätigen als Angestellte beschäftigt. In Vosges lag diese Zahl nur bei 15 Prozent. Das französische Moseltal war am Ende – wie so viele andere ähnliche Gegenden in Frankreich oder anderen Ländern mit einstmals stolzer Industrietradition. Doch wie können Frankreich oder ähnliche Industrienationen ihr Wirtschaftsmodell erhalten, wenn sich gleichzeitig ein Großteil der Bevölkerung abgehängt fühlt?
Hier setzt Die Tesla-Methode an. Dieses Buch soll zur Wiederbelebung der Industrie beitragen, indem es aufzeigt, wie Elon Musks Unternehmen Tesla Vorbild für die Verjüngung unseres Industriesektors sein kann – und welche Prinzipien diesem notwendigen Wandel zugrunde liegen. Die Tesla-Methode verkörpert eine einzigartige Chance – als Bestandteil dessen, was verschiedene Stimmen als Industrie der Zukunft oder Industrie 4.0 oder auch als intelligente Fertigung bezeichnen.
Worauf das alles hinausläuft? Ganz einfach: Man nimmt zwei Bedrohungen – die zunehmende Digitalisierung und die zerfallende Industrie – und verwandelt sie in eine fantastische Chance.
Die Technologie explodiert förmlich, und es liegt an uns, das zu unserem größtmöglichen Vorteil zu nutzen. In den meisten Industrienationen sind alle Voraussetzungen für den Erfolg gegeben – ganz gleich, ob sie sich wie „Start-up-Nationen“ verhalten oder nicht. Durch die Kreuzung von Industrie mit Technologie – also Software, künstlicher Intelligenz et cetera –, aber auch, indem sie auf die Kompetenzen von Betriebswirten und herausragenden Ingenieuren setzen, können Frankreich und andere Länder ihre Industrie in die nächste Phase – die der Plattformbildung – überführen, da bin ich sicher. Die Anforderungen sind allerdings immens. In Frankreich halten 75 Prozent aller Führungskräfte aus der Industrie einer aktuellen PwC-Umfrage zufolge Industrie 4.0 derzeit für das wichtigste Thema. Doch 80 Prozent wissen noch nicht, wie sie damit umgehen sollen. Ihnen mangelt es an Sachverstand, an Erfahrung und manchmal auch an Vision. Die Fertigung ist in Frankreich für Technologie mehr oder weniger Neuland. Dabei ist sie der Sektor, der in der Vergangenheit von der Wissenschaft am meisten profitiert hat und auf den 80 Prozent der gesamten Forschung und Entwicklung entfallen.
Kompetenzen, bewährte Praktiken, eine Vision – all das lässt sich den vom Tech-Sektor entliehenen Praktiken und Ideen entnehmen, die Tesla und viele andere in diesem Buch beschriebene Unternehmen in ihren Organisationssystemen erfolgreich eingesetzt haben.
Ich glaube, die Tesla-Methode kann der Industrie aus der Bredouille helfen. Sie kann aber noch viel mehr. Durch Wiederbelebung der Industrie in den vielen Ländern, in denen sie zusammenbricht, geben wir unseren Volkswirtschaften und Bruttoinlandsprodukten natürlich die dringend benötigten Impulse – und tragen gleichzeitig zur Lösung ökologischer Probleme bei: durch Verlagerung betrieblicher Aktivitäten ins nahe gelegene Ausland und kürzere Entfernungen. Ganz zu schweigen von den zusätzlichen Vorteilen, die im Abbau gesellschaftlicher Spannungen durch Wiederanbindung bisher vernachlässigter Zonen an die großen Ballungszentren bestehen. Wir können uns ein erneuertes sozioökonomisches System zurückerobern, in dem wir wieder eine Vertrauensbeziehung zwischen den Eliten und den Menschen aufbauen.
Im Rahmen meiner Beratertätigkeit habe ich eine große Zahl von Fabriken besucht und mit vielen Spitzenmanagern gesprochen. Mit meiner Hilfe entwickeln sie Ideen, die das künftige Wachstum ihrer Unternehmen beschleunigen können. Manchmal sind diese Ideen Teil ihres Kerngeschäfts, manchmal greifen sie auf andere Tätigkeitsbereiche über. In beiden Fällen fehlen den Führungskräften meist die Zeit und die Methodik, daran anzuknüpfen. Ich hoffe, Die Tesla-Methode wird dazu beitragen, die Informations- und Prozesslücken zu füllen, vor denen solche Manager stehen, und dabei jedem Leser Einblick in die Industrie von morgen geben.